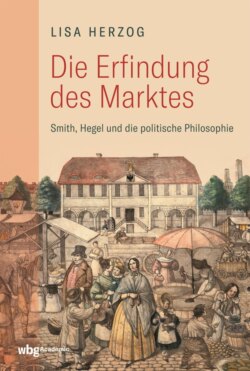Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 6
Vorwort
zur deutschen Übersetzung Zwei missverstandene Giganten
ОглавлениеEs gibt wenige historische Denker, deren Werk so sehr von Klischees überlagert wird, wie das bei Adam Smith und Georg Wilhelm Friedrich Hegel der Fall ist. Das dürfte für den deutschen Sprachraum kaum weniger gelten als für den englischen, auch wenn hier die Sympathien vielleicht anders verteilt sind. Smith, das ist der allgemeinen Vorstellung nach der kaltherzige Ökonom, der das Eigeninteresse pries und die Metapher von der „unsichtbaren Hand“ in die Welt setzte, die eben jenes Eigeninteresse zum Nutzen des Gemeinwohls umleiten würde. Dabei entwickelte die Kombination aus einem Satz – das Zitat über das „Eigeninteresse des Bäckers, Metzgers und Brauers“, das in vielen Ökonomie-Lehrbüchern angeführt wird – und einer von Smith lediglich zweimal verwendete Metapher ein Eigenleben, das das reichhaltige, nuancierte Werk des schottischen Aufklärers komplett überlagerte. Im Fall von Hegel sind es Begriffe und Metaphern wie der „Weltgeist“, der „Kampf um Anerkennung“ oder die „Eule der Minerva“, die Teil des kulturellen Gedächtnisses wurden. Darüber hinaus gilt er vielen als obskurer Metaphysiker, der irgendwie über Kant hinausgehen wollte, dabei aber die Klarheit auf der Strecke ließ.
Als ich im Herbst 2008 begann, das Thema „Smith und Hegel“ für meine Doktorarbeit anzuvisieren, waren es diese bis weit in die akademische Philosophie hinein vorherrschenden Klischees, die dazu führten, dass ich viele verständnislose Blicke erntete, verbunden mit kaum verhohlenem Spott. Meine Absicht, mich mit Hegel auseinanderzusetzen, kommentierte ein analytisch geprägter britischer Mitdoktorand mit der Frage: „Aren’t you worried that it will muddle your thinking?“ Smith dagegen galt als Ökonom, nicht als Philosoph, und interdisziplinäre Fragestellungen wurden, allen Lippenbekenntnissen zum Trotz, mit viel Misstrauen betrachtet. Glücklicherweise fand ich mit Alan Ryan und Mark Philp zwei Betreuer, die immun gegen diese Vorurteile waren und mich ermutigten, tiefer in die Gedankenwelten dieser beiden Autoren einzutauchen. Als ich, beladen mit gedanklichen Fundstücken und vielleicht wirklich ein bisschen „muddled in my thinking“, wieder daraus auftauchte, halfen sie mir, die Ergebnisse in eine geordnete Form zu bringen, aus der eine Doktorarbeit und schließlich das Buch Inventing the Market. Smith, Hegel, and Political Theory wurde.
Smith und Hegel teilen eine Eigenschaft, die dazu führt, dass sie sowohl faszinierend als auch in Teilen schwierig zu verstehen sind: Ihre Überlegungen reichen von ganz konkreten Alltagsfragen bis hin zu metaphysischen Spekulationen der abstraktesten Art. Der intellektuelle Ehrgeiz, mit dem sie ans Werk gingen, ist atemberaubend: Beide waren Systemdenker, die sämtliches Wissen ihrer Zeit, oder doch zumindest weite Teile davon, integrierend zusammenführen wollten; beide lasen breit und wild über alle Disziplingrenzen hinweg. Derartiger intellektueller Ehrgeiz wird heute mit Misstrauen gesehen; die durchprofessionalisierte und gleichzeitig stark prekarisierte akademische Welt schafft gerade für junge Wissenschaftlerinnen starke Anreize, sich mit Detailfragen statt mit größeren Zusammenhängen zu beschäftigen. Heute scheint auch kaum noch denkbar, alle empirischen und theoretischen Ansätze, die für ein bestimmtes Phänomen relevant sein könnten, integrieren zu wollen, zumindest nicht, wenn man alleine arbeitet, statt die Kräfte in gemeinsamen Projekten zu bündeln. Dennoch ist das, was Smith und Hegel versucht haben – ob es ihnen gelungen ist, darüber lässt sich trefflich streiten – auch heute noch dringend nötig: die Synthese zumindest bestimmter Teilbereiche, orientiert an konkreten Fragestellungen, um die größeren Linien sichtbar zu machen, die in der Vielzahl der Details allzu oft verschwimmen.
Sowohl Smith als auch Hegel waren außerdem Autoren, deren Texte nicht immer unmittelbar zugänglich sind – das gilt insbesondere für Hegel –, die aber auch ihre genialen rhetorischen Momente hatten. Das trifft vor allem auf die eingangs zitierten Metaphern zu, die „unsichtbare Hand“, die „Eule der Minerva“, aber auch für zahlreiche kürzere, recht anschauliche Vignetten, Beispiele menschlicher Interaktion, die größere Prinzipien veranschaulichen sollen. Allerdings birgt diese rhetorische Brillanz auch die Gefahr der Verselbstständigung, des Aus-dem-Kontext-gerissen-Werdens, einer Form von Desinteresse am Werk der Autoren als Ganzem, das die postmoderne Rede vom „Tod des Autors“ auf eine ganz andere Weise wahr werden lässt. Die Fälle von Smith und Hegel werfen interessante Fragen nach so etwas wie einer „Ethik der Metaphern“ auf: Sollte man so packende Bilder, die gleichzeitig so leicht missbraucht werden können, überhaupt in die Welt setzen? Aber können Autoren überhaupt absehen, welche Metaphern oder Redewendungen welche Wirkung entfalten, was zum geflügelten Wort wird und was in Vergessenheit gerät? Es scheint in jedem Fall geboten, parallel zu einer „Ethik der Metaphern“ auch über eine „Ethik des Lesens“ nachzudenken, die diesen beiden Autoren gegenüber sicherlich einiges nachzuholen hätte, angesichts all der vielen allzu verkürzenden, teilweise ideologisch getriebenen Lesarten, die sich über die Jahrzehnte hinweg angesammelt haben.