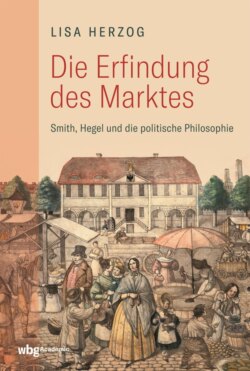Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 12
1 Einführung: Auf der Suche nach „dem Markt“ 1.1 Einleitung
ОглавлениеWohin würde man sich begeben, um „den Markt“ zu Gesicht zu bekommen? Auf das Parkett der Wall Street? Zum nächstgelegenen Bauernmarkt am Samstagmorgen? Zu einer Recruitingmesse, auf der sich große Unternehmen und Hochschulabsolventinnen, die „high potentials“, gegenseitig umwerben? Zu den berühmten Thunfisch-Auktionen in Tokio? Oder sollte man im Internet nach Zahlen zu Angebot und Nachfrage, Produktion und Verbrauch, Währungskursen und Außenhandelsbeziehungen suchen?
All dies sind Beispiele für, und Dimensionen von, „Märkten“. Reden wir jedoch über „den Markt“, so meinen wir etwas, das darüber hinausgeht. Wir meinen das komplexe System, in dem Menschen kaufen und verkaufen, in dem sie Geld, Güter, Arbeit, Zeit und Fähigkeiten anbieten. Wir alle nehmen täglich in unseren Rollen als Arbeiterinnen, Kunden und Investorinnen daran teil. Wie Adam Smith vor mehr als 200 Jahren schrieb, lebte in einer postfeudalen Gesellschaft „jedermann durch Tausch […] oder wird gewissermaßen ein Kaufmann“.1 Unsere Gesellschaften sind, in unterschiedlichem Ausmaß, zu „Marktgesellschaften“2 geworden: Es sind ausdifferenzierte Gesellschaften, deren ökonomische Sphäre durch individuelle Eigentumsrechte, die Verfolgung von Eigeninteressen, hochgradige Arbeitsteilung und komplexe gegenseitige Abhängigkeiten charakterisiert ist. Ihre ökonomische Sphäre ist eine Marktökonomie, die nach ihren eigenen Gesetzen und Prinzipien funktioniert, anstatt auf anderweitigen sozialen Beziehungen aufzusetzen. Obwohl es mehr als eine politische Form gibt, die Marktgesellschaften annehmen können, sind bestimmte politische Strukturen – insbesondere die Herrschaft des Rechts (rule of law) – erforderlich, damit Märkte sich ausbreiten können. Die politische Sphäre kann ihrerseits durch Märkte beeinflusst werden, insbesondere durch Finanzmärkte. Daher wird der Gesamtcharakter unserer Gesellschaften zu einem gewissen Grad durch die Existenz des Marktes bestimmt. Sein Vorhandensein hat einen großen und dauerhaften Einfluss auf unser Leben und auf unser materielles Wohlergehen, aber auch auf unsere sozialen Beziehungen, darauf, wie wir einen Großteil unserer Zeit verbringen, sowie auf unsere Vorstellungen von Erfolg und Misserfolg.
Zur Beschreibung des Marktes wurden verschiedene Bilder verwendet. Für manche ist er ein Monster, ein Dämon, der seine eigenen Kinder verschlingt wie der Gott Kronos. Für die nächsten ist er eine riesige Maschine, die Dinge von einem Ort zum anderen transportiert, was Bilder von großen industriellen Werkhallen mit zahllosen Rohren und Fließbändern wachruft. Für andere ist er ein darwinistischer Dschungel, in dem nur die „Fittesten“ überleben – während er für wieder andere ein großes Sportereignis ist, bei dem, durch eine wunderbar wohlwollende Gestaltung der Regeln, nicht nur die siegreiche Mannschaft, sondern auch alle anderen profitieren, die daran teilnehmen.
Diese Theorien oder die Bilder, die durch sie hervorgerufen werden, wurden von sehr verschiedenen Denkerinnen und Denkern entworfen. Der Markt und seine Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaften wurden von Philosophen und Psychologinnen, Historikern und Romanautorinnen beschrieben. Am meisten haben sich natürlich Wirtschaftswissenschaftler mit Märkten beschäftigt. Während es umstritten ist, was für eine Art Wissenschaft die Wirtschaftswissenschaft ist, ist auf jeden Fall klar, dass Märkte und ihre Struktur für sie zentral sind.
Die moderne Wirtschaftswissenschaft orientiert sich methodisch stark an der klassischen Physik und arbeitet mit abstrakten, auf Mathematik basierenden Modellen. Von zentralem Interesse ist die Frage der Effizienz, und der Markt wird normalerweise als eine Institution verteidigt, die effiziente Ergebnisse ermöglicht. In den Modellen einführender Lehrbücher werden Märkte häufig mithilfe von zwei Linien beschrieben, die sich überkreuzen, oder in Form von Kurven, die am Gleichgewichtspunkt einen Maximalwert erreichen. In Modellen zu Forschungszwecken wird die wechselseitige Abhängigkeit verschiedener Märkte mithilfe komplexer mathematischer Gleichungen wiedergegeben, die unter Verwendung von Daten der Vergangenheit kalibriert werden. Doch die Finanzkrise des Jahres 2008 hat gezeigt, dass diese Art der Modellbildung an inhärente Grenzen stößt: Nur eine Handvoll Wirtschaftswissenschaftler hatte bemerkt, dass auf den amerikanischen Immobilien- und Finanzmärkten etwas schieflief, bevor es zu spät war. Zahlreiche Kommentatorinnen haben daher, was die Modellierung komplexer ökonomischer Phänomene betrifft, grundlegende Veränderungen gefordert, doch die Auseinandersetzung zwischen den Traditionalistinnen und den Reformern ist noch nicht abgeschlossen.
Andere, sogenannte „heterodoxe“ Strömungen wie zum Beispiel die „österreichische Schule“, die Sozioökonomie oder die feministische Ökonomie haben viele dieser formalen Modelle und ihre Fokussierung auf Gleichgewichtszustände kritisiert. Diese heterodoxen Ansätze verwenden weniger harmonische Bilder zur Beschreibung des Marktes und sind ihm gegenüber häufig sehr viel kritischer eingestellt als die Traditionalisten. Bisher ist es ihnen jedoch noch nicht gelungen, einen größeren Einfluss darauf zu gewinnen, wie die Wirtschaftswissenschaft verstanden, gelehrt und für die Politikberatung eingesetzt wird.
Viele Fragen in Bezug auf Märkte werden allerdings innerhalb dieses Fachs überhaupt nicht beantwortet. Zahlreiche interessante Aspekte von Märkten – zum Beispiel das Wesen ökonomischen Handelns, die Auswirkung des Marktes auf gesellschaftliche Beziehungen oder seine Bedeutung für unser Verständnis von Freiheit – sind in den Prämissen der Marktmodelle versteckt und werden als selbstverständlich vorausgesetzt, wenn Wirtschaftswissenschaftlerinnen mit ihnen arbeiten. Häufig muss eine umfassende Übersetzung vom Fachjargon in die Alltagssprache vorgenommen werden, um diese impliziten Voraussetzungen ans Licht zu bringen – was nicht überraschend ist, da diese Modelle zur Beantwortung anderer Fragen entworfen wurden. Indem sie auf die akademische Arbeitsteilung und das Selbstverständnis der Wirtschaftswissenschaft als von anderen Sozialwissenschaften und der Philosophie unterschieden verwiesen, haben viele Ökonomen die Verantwortung für philosophischere Fragen an andere Denkschulen delegiert, sofern sie deren Legitimität überhaupt anerkennen. Um tiefergehende Fragen bezüglich der Bedeutung des Marktes für, und seiner Auswirkung auf, unser Leben zu stellen – also bezüglich seiner existenziellen Seite, könnte man sagen – muss man daher andere Disziplinen ins Spiel bringen.3
Ein offensichtlicher Kandidat für diese Aufgabe ist die politische Philosophie.4 Ihr Beitrag scheint insbesondere dann nötig, wenn man nicht nur deskriptive, sondern normative Fragen dazu stellen möchte, wie Märkte aussehen und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen. Märkte sind nicht nur ein Aspekt des Privatlebens von Individuen, sie sind soziale Phänomene. Sie finden innerhalb eines Rahmens von Gesetzen und Institutionen, wie zum Beispiel Eigentumsrechten, statt, die zu den Kerngegenständen der politischen Philosophie gehören.5 Sie wirken sich auf zahlreiche politische Fragen aus, einschließlich denen nach der Verwirklichung von Idealen wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Man könnte daher erwarten, dass politische Philosophinnen etwas über Märkte zu sagen haben, indem sie nicht nur die Einsichten von Wirtschaftswissenschaftlern, sondern auch von Psychologinnen oder Soziologen, die andere Aspekte der ökonomischen Welt erforscht haben, als Ausgangspunkt nehmen oder diese zusammenführen.
Allerdings hat der Markt in der politischen Philosophie der letzten Jahrzehnte keine größere Rolle gespielt. Dies ist vermutlich das Ergebnis einer Reihe von Annahmen über die Aufgaben der politischen Philosophie und die Natur des Marktes. In seiner bahnbrechenden Studie Eine Theorie der Gerechtigkeit definiert John Rawls die Aufgabe der politischen Philosophie als die Auseinandersetzung mit der Grundstruktur der Gesellschaft.6 Bei dieser Grundstruktur geht es um den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen auch Märkte stattfinden. In einer gerechten Gesellschaft stellt die Grundstruktur sicher, dass die Verteilungsergebnisse der Wirtschaft mit den Prinzipien der Gerechtigkeit übereinstimmen: mit der gleichen Verteilung von Freiheiten und Chancen und dem „Differenzprinzip“, das besagt, dass Ungleichheiten zum größten Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft führen sollten.7 Der Schwerpunkt des Interesses richtet sich daher auf diesen institutionellen Rahmen und führt damit weg von den Märkten selbst. Die implizite Annahme, die hier gemacht und wohl von vielen Theoretikerinnen nach Rawls geteilt wurde, ist, dass Märkte als solche keine normativ relevante Angelegenheit sind, sondern dass sie ein „System“8 bilden, dessen Verteilungsergebnisse durch die ihnen zugrundeliegenden Regeln bestimmt werden. Wenn angenommen wird, dass es bei Märkten nur um ihr Verteilungsergebnis geht, ist es durchaus verständlich, dass sie selbst oder die Bilder, die man von ihnen hat, aus normativer Sicht keiner besonderen Aufmerksamkeit bedürfen und dass sie nur auf der abstraktesten Ebene thematisiert werden. Ein Philosoph in der Tradition des Sozialvertrags, David Gauthier, geht sogar so weit, vom Markt als einer „moralfreien“ Zone zu sprechen und zu behaupten, die Notwendigkeit von Moral entstünde gerade deshalb, weil die Welt kein Markt mit vollständigem Wettbewerb sei.9 Während diese radikale Behauptung an seinem neo-Humeschen Verständnis von Moral hängt, scheint die Annahme, dass im politischen Denken nicht der Markt, sondern das, was ihn umgibt, behandelt werden sollte, weiter verbreitet zu sein. Häufig scheint der Markt das geisterhafte „Andere“ der Institutionen zu sein, auf die sich politische Philosophinnen konzentrieren: Etwas, das gezähmt und eingeschränkt, jedoch nicht selbst thematisiert werden muss.10
Im Gegensatz zu diesem vorherrschenden Ansatz beschreiben pluralistische Gerechtigkeitstheoretiker wie Michael Walzer und David Miller den Markt als eine soziale Sphäre unter vielen, in denen bestimmte Güter jeweils nach den ihnen inhärenten Prinzipien konzipiert, hergestellt und verteilt werden. Miller verteidigt beispielsweise den Grundsatz des Verdienstes als Prinzip der Gerechtigkeit für den Arbeitsmarkt.11 Ein zentraler Schwerpunkt seiner Theorie, und noch mehr von Walzers Sphären der Gerechtigkeit, ist jedoch nicht der Markt als solcher, sondern die Frage nach den Grenzen des Marktes, was Walzer als „blockierte Tauschvorgänge“ bezeichnet.12 Das auf dem Markt herrschende Tauschprinzip darf nicht in andere Sphären eindringen, denn „[d]ie Moral des Basars gehört in den Basar“ – und nur dorthin.13 Die Frage nach den Grenzen des Marktes wurde in den letzten Jahrzehnten von einer Reihe von Denkerinnen und Denkern wie Elizabeth Anderson,14 Michael Sandel,15 und Debra Satz gestellt.16 Sie beschäftigten sich beispielsweise mit der Frage, ob Leihmutterschaft, menschliche Organe oder der Militärdienst auf Märkten „zu Waren gemacht“ werden sollten. Bei der Beantwortung solcher Fragen helfen einem mikroökonomische Lehrbücher oder die aktuellen Ausgaben von Econometrica nicht weiter; es bedarf vielmehr einer ernsthaften philosophischen Diskussion.
Das Thema Märkte ist jedoch nicht nur für diese spezifischen Fragen von Bedeutung. Die Grundthese dieses Buches ist, dass unser Verständnis des Marktes – ob wir ihn als ein Monster oder eine Maschine, als einen Dschungel oder eine Rennbahn sehen – nicht nur ein Randthema der politischen Philosophie, sondern von zentraler Bedeutung für sie ist. Um diese Bedeutung sichtbar zu machen, bedarf es nicht einer weiteren technischen Erörterung von Märkten. Was wir brauchen, ist vielmehr eine philosophische Betrachtung, die den Einfluss des Marktes auf unser Leben untersucht. Dies hilft nicht nur bei der Entwicklung besserer politischer Theorien und nähert diese den Fragen des realen Lebens an. Es ist auch für ein besseres Selbstverständnis als Bürgerinnen von Marktgesellschaften erforderlich, von denen jede Smith zufolge „gewissermaßen ein Kaufmann“ geworden ist. Zu erörtern sind Themen wie die Bedeutung der Märkte für unsere Identität, für unser Verständnis von Gerechtigkeit und für die Frage, auf welche Weise wir frei oder unfrei sind.
Diese Fragen sind heute so dringlich wie eh und je. Die Finanzkrise von 2008 hat deutlich gemacht, wie groß der Einfluss der globalisierten Wirtschaft auf das politische Geschehen und auf das Privatleben von Bürgerinnen und Bürgern geworden ist. Nach dem Ende des Kommunismus waren die Diskussionen über eine umfassende Alternative zum Kapitalismus abgeflaut. Es scheint, dass wir auf die eine oder andere Weise mit dem Markt leben müssen. Das lässt jedoch ein breites Spektrum an Möglichkeiten offen, wie genau mit ihm zu leben ist und wie wir mit seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaften umgehen. Wie sowohl die intellektuelle als auch die reale Geschichte des Kapitalismus zeigen, ist er kein monolithisches System, sondern er kann in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Formen und einen unterschiedlichen Charakter annehmen – und bis zu einem gewissen Grad liegt es an uns, wie wir diese Fragen beantworten. Als Individuen und als politische Gemeinschaften müssen wir entscheiden, wie wir uns zu den Märkten verhalten und wie wir unterschiedliche Werte mit ihnen oder gegen sie verwirklichen wollen. Um über diese Möglichkeiten nachzudenken, müssen wir Märkte in all ihren Dimensionen betrachten und ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen ernst nehmen. Deshalb müssen Märkte ein Thema für die politische Philosophie sein.
In dieser Situation lohnt es sich, zu den Texten derjenigen zurückzukehren, die über die Marktgesellschaft in ihren Anfängen nachgedacht und Ideen über den Markt entwickelt haben, die unser Leben bis heute beeinflussen: Sowohl als gedankliche Konstrukte als auch in Form von Institutionen und Gepflogenheiten, die aus ihnen hervorgegangen sind. Keynes prägte das Bonmot, dass „Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben […] gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen“ sind.17 Wenn wir innerhalb von Märkten agieren, haben wir alle irgendwelche vagen Vorstellungen davon, was dies bedeutet und welche Auswirkungen es hat – und es ist wahrscheinlich, dass auf die eine oder andere Weise die Ideen eines „verblichenen Ökonomen“ Teil dieser Annahmen sind. Politische Denkerinnen, deren Aufgabe es ist, unsere Vorstellungen von der gesellschaftlichen Welt explizit zu machen, sind von dieser Gefahr nicht ausgenommen.18 Eine sinnvolle Methode, dieses Problem anzugehen, besteht darin, jene Denker der Vergangenheit einer erneuten Betrachtung zu unterziehen, deren Ideen zur Gestaltung unserer gegenwärtigen Kategorien, Ideen und Annahmen beigetragen haben. Ihre Argumente zu untersuchen bedeutet nicht, „Geschichte um der Geschichte willen“ zu betreiben, sondern hilft uns dabei, unsere eigene Zeit in neuem Licht zu sehen und sie auf eine tiefere, bewusstere Weise wahrzunehmen.
Das Ziel dieses Buches ist, die von Adam Smith und Georg Wilhelm Friedrich Hegel entwickelten Modelle der Marktgesellschaft in vergleichender Perspektive zu analysieren. Beide gehören zu den umstrittensten – und am häufigsten falsch dargestellten – Denkern der letzten 250 Jahre. Wenn man dagegen ihre Schriften genauer betrachtet, so kommt man nicht umhin, von der Scharfsinnigkeit und Reichhaltigkeit ihrer Auffassungen des Markts, seiner Bedeutung und seines Verhältnisses zur Gesellschaft als Ganzer beeindruckt zu sein. Smith und Hegel entwickelten Prototypen von Modellen des Marktes, deren Einfluss bis heute stark nachwirkt. Die vorliegende Studie analysiert und vergleicht diese beiden Ansätze und zeigt, inwieweit sie für zentrale Themen der politischen Philosophie von Bedeutung sind: für Identität und Gemeinschaft, Verdienst und Gerechtigkeit, das Verhältnis zwischen verschiedenen Dimensionen der Freiheit sowie für die Geschichtlichkeit sozialer Institutionen.
Adam Smith,19 der 1723 in der schottischen Stadt Kirkaldy geboren wurde, wird häufig als „Vater“ der Wirtschaftswissenschaft bezeichnet. Aber bevor er 1776 seine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes veröffentlichte, war er Professor für „Moralphilosophie“ – in dem weiten Sinne, in dem dieser Begriff zu seiner Zeit verwendet wurde. Sein erstes Buch, die Theorie der ethischen Gefühle, erntete bei seiner Veröffentlichung 1759 großes Lob. In Edinburgh und Glasgow hatte Smith zahlreiche Fächer gelehrt, darunter Rhetorik, Jurisprudenz, Logik und „natürliche Theologie“. Als Privatlehrer eines jungen Adligen war er nach Frankreich gereist, wo er die crème de la crème der französischen Aufklärung kennen gelernt hatte, darunter die sogenannten „Physiokraten“, die führenden Wirtschaftstheoretiker dieser Epoche. Als lebenslanger Junggeselle und Mitglied zahlreicher gelehrter Vereine und Gesellschaften verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens als Zollkommissar – eine Tatsache, die denjenigen zu denken geben sollte, die ihn in die Reihen der undifferenzierten Huldiger des freien Marktes einordnen wollen, und dabei meist nur einen Satz aus seinem umfangreichen Werk zitieren: den berühmten Satz über das Eigeninteresse „des Fleischers, Brauers oder Bäckers“, das uns mit unserem Abendessen versorge.
Smiths Verständnis des Marktes ist in vielerlei Hinsicht der Prototyp für die „klassisch-liberale“ Sicht auf den Markt: Der Markt schafft Reichtümer und verteilt Güter und Dienstleistungen an alle Mitglieder der Gesellschaft. Er ist eine wohltätige Institution, die Gesellschaften zu einem Zustand des Überflusses führt, in dem es allen besser geht. Kurz gesagt: Trotz einer Reihe von Vorbedingungen und Vorbehalten löst der Markt Probleme. Dieses Verständnis des Marktes steht am Anfang einer Tradition, die Denker wie David Ricardo, J. S. Mill, F. A. von Hayek und James Buchanan einschließt und sich auf Schlüsselbegriffe wie Individualismus, Eigentumsrechte und „spontane Ordnung“ konzentriert.20 Besonders in ihrer „Chicagoer“ Version hat diese Richtung der Wirtschaftswissenschaft erhebliche Kritik hervorgerufen, die Smith mit angegriffen hat, als gehöre er zu ihren Anstiftern. Doch anders als die Karikatur, zu der Smith geworden ist, glauben lässt, ist seine Zustimmung zum Markt nicht bedingungslos. Seine Überlegungen über die menschliche Natur und das gesellschaftliche Zusammenleben sind viel differenzierter, als man normalerweise annimmt – vieles von dem, was in der heutigen Wirtschaftswissenschaft aufgrund ihrer Mathematisierung und Spezialisierung fehlt, findet sich bei Smith.21 Der Anstieg der Forschung über Smith in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass er ein äußerst interessanter Gesprächspartner für diejenigen ist, die heute über Moral, menschliche Natur und Gesellschaft nachdenken.22
Georg Wilhelm Friedrich Hegel23 wurde 1770 als Sohn eines Staatsbeamten am Hof von Stuttgart geboren. Er studierte an der Universität Tübingen, einer Brutstätte des deutschen Idealismus in der Zeit nach der kantischen philosophischen Revolution. Er arbeitete als Privatlehrer, bevor er 1801 in Jena seine Universitätslaufbahn begann. Diese wurde durch mehrere Jahre als Redakteur einer Tageszeitung und als Direktor eines Gymnasiums unterbrochen, und führte ihn dann nach Heidelberg und schließlich nach Berlin. Nur wenige seiner Schriften – darunter die Phänomenologie des Geistes, die Enzyklopädie und die Grundlinien der Philosophie des Rechts – erschienen zu seinen Lebzeiten im Druck, doch zahlreiche Vorlesungsaufzeichnungen, sowohl von ihm selbst als auch von seinen Schülern, sind erhalten geblieben und wurden im 19. und 20. Jahrhundert herausgegeben. Hegel war einer der Hauptvertreter des deutschen Idealismus, und während das Interesse an seiner Philosophie Höhen und Tiefen sah, kann seine Bedeutung für die europäische Philosophiegeschichte kaum bestritten werden. Darüber, ob sein Einfluss positiv oder negativ zu bewerten ist, herrscht freilich Uneinigkeit. Hegel steht im Ruf, „einer der abstrusesten und unzugänglichsten Denker zu sein“,24 besessen von logischen Kategorien und der Geschichte des Weltgeistes. Doch dieses Klischee steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass er auch eine sehr bodenständige Seite hatte. Er war ein begeisterter Zeitungs- und Zeitschriftenleser und verfolgte die politischen Ereignisse seiner Zeit mit großem Interesse. Er dachte intensiv über die junge Wissenschaft der Ökonomie nach, die an der Wende zum 19. Jahrhundert aufzublühen begann. Eine zentrale Frage seiner politischen Philosophie ist, wie eine Gesellschaft zu verstehen ist, in der der Markt, eine ausgesprochen moderne Institution,25 einen Platz hat. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1821 entwerfen das prototypische Modell einer Marktwirtschaft, die in ihrer eigenen Sphäre Freiheiten genießt, jedoch durch andere Institutionen, insbesondere durch den über ihr stehenden Staat, eingehegt wird. Der Markt ist hier ein notwendiges Element einer modernen Gesellschaft, das wichtige Werte wie Freiheit – zumindest eine gewisse Art von Freiheit – und Individualität verkörpert. Er ist jedoch auch zutiefst problematisch: Er setzt Kräfte frei, die die soziale Ordnung zerstören können, und er schafft enorme wirtschaftliche Ungleichgewichte und Ungleichheiten. Kurz gesagt, so sehr der Markt benötigt und geschätzt wird: Er schafft Probleme. Es muss daher ein Gleichgewicht gefunden werden, das dem Markt die ihm gebührende Bedeutung zugesteht, aber seine Auswirkungen begrenzt.
Die Tradition, die auf diesem Ansatz aufbaut, ist weniger klar umrissen als die klassische liberale Tradition. Sie würde jedoch zum Beispiel die deutsche „historische Schule“ in den Wirtschaftswissenschaften26 und die Anfänge der Soziologie27 einschließen, und es gibt eine „Familienähnlichkeit“ mit der Richtung der politischen Philosophie, die als „Kommunitarismus“ bezeichnet wurde.28 Eine zweite Linie führt von Hegel zum britischen Idealismus und von dort zum britischen Sozialliberalismus, zum Beispiel über Thomas Hill Green.
Es dürfte schwer sein, auf der Suche nach Denkerinnen, die nach der Bedeutung des Marktes befragt werden können, geeignetere Kandidaten zu finden. Smith und Hegel entwerfen eine soziale Welt, die in vielerlei Hinsicht unserer eigenen gleicht: Eine Marktgesellschaft, die durch eine Tauschwirtschaft gekennzeichnet ist und in der die sozialen Beziehungen fließend sind, statt durch die statischen Hierarchien der feudalen Welt festgelegt zu sein. Für Smith und Hegel waren diese Phänomene relativ neu, zumindest, was ihre eigenen Länder betrifft.
Während Smith vor der ersten großen Industrialisierungswelle in Großbritannien schrieb,29 erhielt Hegel Nachrichten über die Entwicklung im Vereinigten Königreich durch Zeitungen und Zeitschriften. Deutschland hingegen war zu seiner Zeit noch weitgehend vorindustriell geprägt. Smith und Hegel untersuchten die Marktgesellschaften ihrer Zeit mit der Alternative vormoderner Gesellschaften im Hinterkopf. Dabei gingen sie von der Überlegenheit des modernen Modells aus, ohne es als selbstverständlich zu betrachten. Beide teilten jedoch auch die Auffassung, diese moderne Gesellschaft sei von Natur aus stabil und nicht nur eine Übergangsphase auf dem Weg hin zu anderen Formen. Für Smith und Hegel war demnach das, was beim Übergang zur Marktgesellschaft auf dem Spiel stand, nicht nur eine theoretische Frage, sondern auch Teil ihrer eigenen Lebenserfahrung. Die Lektüre ihrer Texte kann uns daher dabei helfen, uns darüber bewusst zu werden, woran wir uns gewöhnt haben, und eine kritische Distanz zu unserer gegenwärtigen Situation zu gewinnen.
Was ihre Schriften für uns außerdem besonders wertvoll macht, ist, dass sie sie zu einer Zeit verfassten, in der die Arbeitsteilung in der akademischen Welt gerade erst begonnen hatte, sodass wir von ihrer außergewöhnlich breit angelegten Betrachtungsweise profitieren können. Diese umfasste die Wirtschaftswissenschaften, die Gesellschaftstheorie im weiteren Sinne, Geschichte, Moralphilosophie und Psychologie, um nur die relevantesten Fachgebiete zu nennen. Sowohl Smith als auch Hegel waren systematische Denker, deren Ziel es war, diese verschiedenen Bereiche und ihr unterschiedliches Vokabular in Gesamtdarstellungen zu integrieren, die die natürliche und soziale Welt und den Platz des Menschen in ihr von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus beschreiben. Smith und Hegel stellen daher Fragen, die heute durch die Aufteilung zwischen den Disziplinen und Fakultäten oft verloren gehen. Die akademische Spezialisierung hat gewiss zahlreiche Vorteile, doch ihr Preis ist, dass Fragen, die an der Grenze verschiedener Fachgebiete liegen, oft weniger Aufmerksamkeit erhalten als solche, die für das Selbstverständnis einzelner Disziplinen zentral sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig wären, sowohl aus theoretischer Sicht als auch im Hinblick auf die dringlichsten Probleme der realen Welt. Die umfassenden intellektuellen Systeme von Denkerinnen und Denkern der Vergangenheit zu untersuchen, ist daher eine Gelegenheit, die Fachgrenzen zu überschreiten. Es hilft, bestimmte Probleme und Fragen zu sehen, die sonst unsichtbar bleiben, und darüber nachzudenken, wie sich der Dialog zwischen den Disziplinen fördern lässt.30
Angesichts dieser Tatsachen ist es überraschend, dass ein systematischer Vergleich von Smith und Hegel zum Wesen und zur Bedeutung des Marktes bisher nicht unternommen wurde. Die einzige größere vergleichende Studie ist Norbert Waszeks Buch The Scottish Enlightenment and Hegel’s Account of ‚Civil Society‘.31 Es bietet eine äußerst nützliche und reichhaltige Analyse der Übermittlung des schottischen Denkens in die deutschsprachigen Länder und von Hegels Reaktion darauf. Durch die Wahl einer kontextualistischen Methode verzichtet Waszek allerdings darauf, Hegels politisches Denken zu berücksichtigen – vor allem übergeht er explizit seine Erörterung des Staates32 – und wird damit Hegels Modell einer modernen Marktgesellschaft insgesamt nicht gerecht. Außerdem will er Smiths und Hegels Denken nicht für gegenwärtige Probleme in der politischen Theorie fruchtbar machen; insgesamt ist Waszeks Ansatz daher eher historisch als philosophisch.
Der Grund, warum das Potenzial eines systematischen Vergleichs von Smith und Hegel zur Bedeutung des Marktes noch nicht erkannt wurde, könnte in der Rezeptionsgeschichte liegen, die wiederum durch die Trennung zwischen den akademischen Disziplinen gekennzeichnet ist. Smith wurde traditionell als Ökonom gesehen, und die Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes wurde oft mit dem Ziel gelesen, die Anfänge späterer ökonomischer Theorien darin zu finden. Von der Philosophie wurde Smith erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als einer der ihren wiederentdeckt; die allgemeine Wahrnehmung ist jedoch immer noch sehr stark die als „Vater der Ökonomie“, der mit neoliberalen Ideologien in Verbindung gebracht und aus diesem Grund als philosophischer Denker nicht ernstgenommen wird. Hegel wird dagegen oft als Prototyp eines deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts gesehen, der deren typische Merkmale – seltsamer Fachjargon und wilde metaphysische Fantasien – aufweist. Obwohl in den letzten Jahrzehnten das Interesse an seinem Denken in der englischsprachigen Philosophie neu erwacht ist, werden zahlreiche Forschungsarbeiten nach wie vor nur auf deutsch veröffentlicht.
Die Bilder, die man sich von Smith und Hegel gemacht hat, sehen daher sehr unterschiedlich aus – was allerdings mehr über die Entwicklung der akademischen Disziplinen seit ihrer Zeit als über Smith und Hegel selbst aussagt. Stellt man sie in ihren historischen und intellektuellen Kontext, so zeigt sich schnell, dass die Vorstellungen, die sie so unterschiedlich erscheinen lassen, anachronistische Klischees sind. Es ist das Verdienst von Waszeks Buch, den großen Einfluss von Smith, und des schottischen Denkens im Allgemeinen, auf Hegel nachgewiesen zu haben. Das vorliegende Buch bestätigt Waszeks zentrale These, indem es zeigt, dass Smiths und Hegels Auffassungen des Marktes und seiner Rolle in der Gesellschaft viel ähnlicher sind, als man oft annimmt. Wie es einer vergleichenden Studie angemessen ist, wird der Schwerpunkt allerdings auch darauf liegen, wie sie sich voneinander unterscheiden, ebenso wie auf ihren unterschiedlichen Grundannahmen in Bezug auf das Wesen des Menschen und die metaphysischen Grundlagen der sozialen Welt, die ihren Auffassungen des Markts auf subtile Weise eine gänzlich andere Nuancierung verleihen. Smith und Hegel eignen sich für eine vertiefte vergleichende Analyse besonders gut, weil sie an den beiden Enden einer Skala von Positionen darüber stehen, wie viel Spielraum dem Markt gegeben werden sollte, wobei sie beide die Auffassung vertreten, dass einige Argumente zugunsten des Marktes angeführt werden können und dass ihm in einer wohlgeordneten modernen Gesellschaft ein gewisser Platz eingeräumt werden sollte.
Dies ist auch der Grund dafür, warum Hegel und nicht Marx als Gegenstück zu Smith ausgewählt wurde. Obwohl Marx’ Schriften über den Markt – die von Hegels Darstellung beeinflusst sind – voller inspirierender Einsichten sind, wird der modernen Marktgesellschaft hier der drohende Zusammenbruch diagnostiziert, der aus ihren inneren Widersprüchen resultiere, und sie wird letztlich abgelehnt. Dies war auch für viele spätere marxistische Denkerinnen ein Grund dafür, den Markt keiner detaillierten Analyse zu unterziehen, da sie hofften, er werde sowieso früher oder später „überwunden“. In Hegels politischer Philosophie dagegen werden die Probleme und Widersprüche des Marktes zwar deutlich erkannt, jedoch nimmt er an, dass sie in einer geordneten Gesellschaft eingedämmt werden können. Heute, fast 150 Jahre nach der Veröffentlichung von Marx’ Kapital, scheint die Frage, ob Märkte wirklich durch politische Strukturen eingedämmt werden können, wieder offen: nach Phasen einer ziemlich erfolgreichen „Zähmung“ des Marktes scheint in der gegenwärtigen globalisierten Welt der Einfluss der Finanzmärkte auf die nationalen Regierungen größer als je zuvor. Dennoch ist unklar, ob eine marxistische Alternative, die nicht die bürgerlichen und politischen Freiheiten untergräbt, wie es in den meisten kommunistischen Ländern der Fall war, verfügbar und wirklich wünschenswert ist. Smith und Hegel stehen trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten in einer liberalen Tradition im weiten Sinne, für die wirtschaftliche Freiheiten mit anderen Arten von Freiheiten innerhalb eines stabilen gesellschaftlichen Ganzen vereinbar sind. Die Analyse ihres Denkens, und insbesondere ihrer kritischeren Bemerkungen, versetzt uns in die Lage, eine immanente eine Kritik der liberalen Tradition zu entwickeln, die das Ziel hat, sie zu reformieren und zu verbessern, die aber ihre Grundüberzeugungen teilt.33 Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Probleme scheint eine solche Kritik dringend geboten.
Der Schwerpunkt des liberalen politischen Denkens lag lange auf Gesellschaften, die als mehr oder weniger geschlossene Systeme betrachtet wurden. In den letzten Jahren hat das Interesse an Fragen der internationalen Gerechtigkeit, über die Grenzen des Nationalstaates hinweg, zugenommen. Es ist offensichtlich, dass diese Fragen viel mit Märkten zu tun haben, da das Wirtschaftsleben der verschiedenen Staaten zunehmend mit dem Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung verwoben ist. Unterschiedliche Perspektiven auf den Markt führen zu unterschiedlichen Beurteilungen dieses Prozesses. Dennoch ist es sinnvoll, sich zunächst auf die Rolle und Bedeutung des Marktes innerhalb einer Gesellschaft zu konzentrieren – nicht nur, weil Nationalstaaten in der heutigen Welt immer noch eine große Rolle spielen, sondern auch, weil wir auf diese Weise begriffliche Werkzeuge erhalten, die wir dann zur Auseinandersetzung mit internationalen Fragen verwenden können.
Was sich aus dem Vergleich von Smith und Hegel ergibt, ist die Möglichkeit, das Wesen und die normative Bedeutung des Marktes sowie seine Rolle und seinen Platz in einer Marktgesellschaft nuancierter und detaillierter zu verstehen. Dabei kommen eine Reihe von Themen in ihrem Denken zur Sprache, die bisher nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten haben, wie zum Beispiel das durchgängige Thema der „Absichten der Natur“ bei Smith oder die Bedeutung des Begriffs der Bildung für Hegels Verständnis des Arbeitsmarktes. Der Vergleich zeigt, dass sowohl Smith als auch Hegel den Markt als Teil einer differenzierten Gesellschaft sehen, in der unterschiedliche Logiken des Handelns in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären ihren Platz haben. Er zeigt allerdings auch, dass Unterschiede in den metaphysischen Annahmen über das Wesen des Kosmos und der Gesellschaft sie zu unterschiedlichen Antworten führen, wenn es um die genaue Rolle des Marktes geht.
Insgesamt ergibt sich aus der vorliegenden Untersuchung jedoch eine These, die über das Interesse an Smith und Hegel hinausgeht: Sie zeigt, dass es von Bedeutung ist, wie wir über den Markt denken. Denn für viele Aspekte dessen, was wir für eine lebenswerte Gesellschaft halten, macht dies einen entscheidenden Unterschied. Wenn wir unsere Annahmen über den Markt nicht explizit machen, ist es wahrscheinlich, dass wir vage Ideen „irgendeines längst verblichenen Ökonomen“ mitschleppen, und uns von ihnen beeinflussen lassen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir diese Fragen in die Diskussion einbringen, können sie uns dabei helfen, Einsichten in unsere eigenen Denkvoraussetzungen zu erlangen, sowie in die Gründe, aus denen heraus wir bestimmte Vorschläge annehmen oder ablehnen. Dies ist nicht nur für Politikwissenschaftlerinnen, sondern auch für jeden anderen wünschenswert, der das eigene Leben in einer Marktgesellschaft reflektiert, zum Beispiel beim Nachdenken über Einkommensgerechtigkeit, darüber, was es bedeutet „Humankapital“ zu besitzen, und über die Arten von Freiheit, die uns der Markt gewährt. Je genauer wir begreifen, was der Markt für uns leisten kann oder auch nicht, desto besser erkennen wir, was getan werden kann, um auf seinen Stärken aufzubauen und seine Probleme abzumildern.
Ein Leitmotiv dieser Studie ist der Kontrast zwischen der Auffassung, dass der Markt ein natürlicher „Problemlöser“ ist, die Smith im Großen und Ganzen vertritt, und der Position, dass der Markt als eine spezifische historische Errungenschaft zu sehen ist, die durch menschliche Institutionen ermöglicht wurde und bestimmte wichtige Prinzipien verkörpert, jedoch auch Probleme schafft, wie Hegel es sah. Wie bereits erwähnt und weiter unten ausführlich beschrieben, werden vier Themen in ihrem Verhältnis zum Markt näher erörtert: die Beziehung zwischen Individuum und Gemeinschaft; Fragen der sozialen Gerechtigkeit, mit einem Schwerpunkt auf Fragen des Verdienstes und der sozialen Inklusion; die Beziehung zwischen verschiedenen Dimensionen der Freiheit auf Märkten; sowie die Geschichtlichkeit von Märkten. Dies sind Schlüsselkategorien für das Nachdenken über Märkte, sie sind jedoch auch Gegenstand ausführlicher Debatten in der zeitgenössischen politischen Philosophie und Theorie. An vielen Stellen werden Verbindungen von Smith und Hegel zu diesen Diskussionen des 20. und 21. Jahrhunderts hergestellt.
Die Studie wendet sich damit an zwei Adressatengruppen. Zum einen interpretiert und erörtert sie Smiths und Hegels Verständnis des Marktes und seines Platzes in der Gesellschaft, wobei der vergleichende Ansatz neue Perspektiven aufzeigt. Dies dürfte für Philosophinnen oder Philosophiehistoriker, die über Smith oder Hegel arbeiten, aber auch für Ökonominnen von Interesse sein, die sich für das Denken des Gründervaters ihrer Disziplin und einen seiner frühen Kritiker interessieren. Andererseits dürfte die Frage, was es bedeutet, in einer Marktgesellschaft zu leben, und welche Kategorien und gedanklichen Werkzeuge wir verwenden können, um darüber nachzudenken, für politische Philosophinnen von Interesse sein, die an vielen zeitgenössischen Debatten beteiligt sind, zum Beispiel über den Gegensatz zwischen „liberal“ und „kommunitaristisch“ oder über den Begriff des Verdienstes. Für diese Debatten ist es ausschlaggebend, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, in hohem Maße „vom Austausch“ leben.