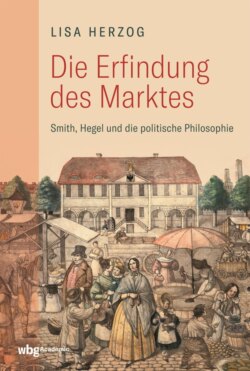Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 9
Freie Märkte – oder Rückkehr des Feudalismus?
ОглавлениеDie Finanzkrise von 2008 hat eindrücklich gezeigt, dass die Vorstellung von sich selbst regulierenden Märkten, zumindest in Bezug auf Finanzmärkte, höchst problematisch ist. Dass „financial deepening“, die immer stärkere Aufspaltung von finanziellen Risiken und der Handel mit ihnen, zu gesamtgesellschaftlichen Effizienzgewinnen führen würde, die letztlich allen zugutekämen, und dass die Akteurinnen auf Finanzmärkten so rational seien, dass sich Blasen gar nicht erst bilden könnten – diese makroökonomische Orthodoxie erwies sich als folgenschwerer Fehler, der zahlreiche Unschuldige mit in seinen Strudel riss. Smith, der – übrigens sehr zum Unmut von Jeremy Bentham – für die Regulierung von Zinssätzen argumentiert hatte, damit nicht zu viel Kapital in die Hände risikoliebenderer Spekulanten geraten würde, wäre vermutlich entsetzt gewesen, hätte er erfahren, dass sein Name und seine Metapher der „unsichtbaren Hand“ für die „Liberalisierung“ der Finanzmärkte herangezogen wurden.
Dass die Interessen der „merchants“ und die der Bevölkerung als Ganzer – insbesondere der Masse der arbeitenden Bevölkerung, deren Wohl Smith besonders am Herzen lang – oft in Spannung zueinander stehen, das lässt sich bei Smith direkt nachlesen. Auch, dass diese „merchants“ gerne versuchen, die Regierung auf ihre Seite zu ziehen und Gesetze zu ihren Gunsten zu erlassen (oder Gesetze zu ihren Ungunsten zu verhindern), war für Smith eine Offensichtlichkeit. Smiths egalitäre Grundhaltung, zusammen mit seinem Gespür für Eigeninteresse und Machtstreben, hätten ihn vermutlich schnell durchschauen lassen, dass vieles von dem, was sich an der Wallstreet und den anderen Finanzplätzen der Welt abspielte, nicht unter die Kategorie „gesellschaftlich förderliche freie Märkte“ fällt, sondern unter die Kategorie eben jener „merchants“, die ihre wirtschaftliche Macht einsetzen, um die politische Macht zu ihren Gunsten zu beeinflussen, um damit ihre wirtschaftliche Macht weiter auszubauen, etc. – ein Zyklus, der stärker an die feudalen Strukturen erinnert, gegen die Smith anschrieb, als an seine Vision einer freien Marktgesellschaft.
2012, kurz vor diesem Buch – aber zu spät, um noch darauf eingehen zu können –, erschien ein vielbeachtetes Werk der Institutionenökonomie: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (deutsch 2013: Warum Nationen scheitern. Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut), von Daron Acemoglou und James A. Robinson. Die Autoren verwenden dabei die Begrifflichkeit von „inklusiven“ und „extraktiven“ Institutionen, um einen Gegensatz zu beschreiben, der der Sache nach auch schon bei Smith angelegt ist: Ist der gesetzliche Rahmen einer Gesellschaft derart gestaltet, dass die Masse der Bevölkerung sich wirtschaftlich betätigen und am wachsenden Wohlstand teilhaben kann, oder wird jeder wirtschaftliche Zugewinn von einer kleinen Elite abgeschöpft? Ohne hier in die methodologische und substantielle Debatte über dieses Buch einsteigen zu wollen, scheint mir, dass es einen wahren Kern enthält, den auch Smith schon erkannt hatte: Märkte müssen zugunsten der Masse der Bevölkerung gestaltet werden, man kann nicht annehmen, dass sie von alleine so sind. Das Rahmenwerk muss stimmen, sonst können sich die positiven Wirkungen von Märkten nicht entfalten. Damit lässt sich Smith auch in eine Linie zu manchen Ideen der ordoliberalen Schule stellen – eine Verbindung, die Mark Reiff in einem auf meinem Buch aufbauenden Artikel im Adam Smith Review kürzlich ausführlich diskutierte.8