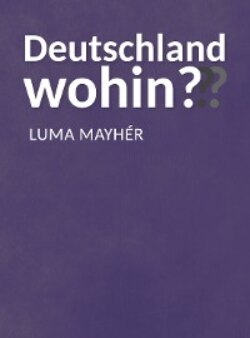Читать книгу Deutschland wohin??? - Luma Mayhér - Страница 10
1.2 Deutschland nach der Wiedervereinigung
ОглавлениеAm 3. Oktober 1991 wurde Deutschland durch den Beitritt Ostdeutschlands bzw. der DDR zur Bundesrepublik wiedervereinigt. In Berlin fand dazu eine große Veranstaltung auf der Straße Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor statt. Dort standen in Reichstagsnähe die Rednertribünen mit den Politikern. Als Besucher der damaligen Veranstaltung bin ich heute noch über so viel Unvermögen entsetzt. Als musikalische Untermalung wurde nicht etwas Heiteres gewählt, das Aufbruchsstimmung suggeriert, sondern für den Anlass eigentlich unpassende, vor allem durch dumpfes Trommeln geprägte Musik. Noch unangenehmer waren die in den Himmel gerichteten Laserstrahlen. Sie waren damals für größere Veranstaltungen modisch und gang und gäbe. Sie erinnerten aber in fataler Weise an die letzten Tage des Dritten Reiches. Berlin wurde noch bis zum 20. April 1945 von alliierten Bombern angegriffen, auch reine Wohngebiete. Die Abwehrwaffen, die bis zum Schluss funktionierten, waren die Flakgeschütze auf den großen Luftschutzbunkern, z. B. dem Bunker am Bahnhof Zoo oder am Humboldthain. Von dort wurde mit großen Scheinwerfern der Himmel abgeleuchtet, um alliierte Bomber abzuwehren. Deshalb suggerierten die Laserstrahlen ein z. T. nahezu identisches Himmelsbild wie in den letzten Tagen des Untergangs des Hitlerreiches. Berliner, die 1945 diese Zeit miterlebten, waren über die Darbietung entsetzt. Wie konnte man so etwas machen? Dem dafür zuständigen Personen fehlte es offensichtlich an Geschichtskenntnissen. Das ist zwangsläufig auch für die für die Organisation dieser Veranstaltung verantwortlichen politischen Entscheidungsträger in Frage zu stellen. Zum Abschluss der Veranstaltung fand ein gewaltiges, langes Feuerwerk statt. Es war endlos, ohne große Höhepunkte, letztlich so langweilig, als wenn es von einem betuchten Neureichen stammt, der viel Mittel verpulvern kann, aber keine kreativen Ideen hat. Diese Ausrichtung ließ ahnen, dass die Wiedervereinigung noch erhebliche Probleme nach sich ziehen wird.
Durch den Beitritt Ostdeutschlands zur Bundesrepublik galt nun das Grundgesetz für das gesamte Deutschland. Ostdeutschland wurde zügig angepasst. Die Verhandlungen, auf westdeutscher Seite von Wolfgang Schäuble geführt, waren eindeutig auf Übertragung und Angleichung Ostdeutschlands an die westdeutschen Verhältnisse ausgerichtet. Damit wurden auch wichtige Chancen vertan. Letztlich gibt es kaum ein Staatssystem, in dem alles negativ ist, wie umgekehrt kein System fehlerfrei sein, nur Positives aufweisen kann. Deshalb hätte die Wiedervereinigung auch die Chance zur kritischen Bilanz der Bundesrepublik und zur Fortentwicklung bieten können. Bei Eliminierung der negativen Ausprägungen und Erhaltung und Fortentwicklung der positiven Ausprägungen Ostdeutschlands und Westdeutschlands war diese Chance zumindest theoretisch gegeben. Das wäre sicher auch für ostdeutsche Bürger ein Signal gewesen sich aktiv einzubringen. Entsprechende Vorschläge entwickelte eine gemeinsame Arbeitsgruppe Westberliner und Ostberliner Hochschullehrer, an der ich mitwirkte, in ihrer Resolution zum 3.10.1990. Die politische Reaktion darauf war enttäuschend, höfliche belanglose Antwortschreiben, einige auch von Staatssekretären. Eine Ausnahme war der neue brandenburgische Ministerpräsident Stolpe. Er antwortete in einem vierseitigen handgeschriebenen Brief an Prof. Rainer Mackensen, den Organisator dieser Gruppe.
Zu den nicht genutzten Chancen gehört z. B. der starke Rückgang der zumindest in quantitativer Hinsicht hervorragenden Versorgung Ostdeutschlands mit Kindergärten und Krippen. Für die Krippen wurde die Versorgungsausstattung der ehemaligen DDR bis heute, also über 30 Jahre später, nicht wieder erreicht. Die Verkehrsanbindung ländlicher Regionen, die zwar heute wesentlich moderner und komfortabler ist, hat aber zugleich zum massiven Rückbau des Streckennetzes geführt. Als besonders nachteilig erweist sich die damalige massive Ausrichtung auf eine privatwirtschaftlich ausgerichtete ambulante Gesundheitsversorgung durch Einzelpraxen. Dafür wurden in ländlichen Regionen die Polikliniken flächendeckend aufgelöst, obwohl sich damals westdeutsche Experten nachdrücklich für deren Erhalt aussprachen (u. a. Knieps in BZ). Inzwischen sind die Folgen verheerend, denn in ländlichen Räumen bricht immer mehr die gesundheitliche Grundversorgung weg. Das gilt inzwischen auch für westdeutsche Regionen und dort selbst für die Randbezirke von Großstädten. Nun versucht man mit vergleichbaren Einrichtungen, die jedoch privatwirtschaftlich betriebenen werden, gegenzusteuern, nur werden diese heute nicht mehr als Poliklinik, sondern als MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) bezeichnet. Ein Teil der Polikliniken hätte man damals auch privatisiert erhalten können, nur widersprach das der westdeutschen Ausrichtung. In Anbetracht der großen Probleme beginnt sich die strikte privatwirtschaftliche Ausrichtung der ambulanten medizinischen Versorgung zu lösen. Bei Bedarf kann heute ein MVZ auch in kommunaler Trägerschaft betrieben werden, wie es bereits in der Gemeinde Katzenellenbogen in Hessen erfolgte. Ähnlich war die Abwicklung der ostdeutschen Gemeindeschwestern. In Anbetracht der negativen Folgen wurden später an das System der Gemeindeschwester anknüpfende neue Modelle entwickelt. Zunächst das AGnES-Konzept (Arztentlastende, Gemeindenahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention) mit dem Hausärzte Krankenbesuche EDV-gestützt an besonders ausgebildete Mitarbeiter delegieren können und einige Jahre später daran anknüpfend das Modell der (NäPa) Nicht ärztliche Praxisassistentinnen, die für ähnliche Aufgaben, nämlich vor allem für Hausbesuche , eingesetzt wird, nur anstatt Gemeindeschwester unter anderen Namen.
Die Probleme und Herausforderungen waren enorm. So fehlte das Landesrecht in den neuen Bundesländern, das erst aufgebaut werden musste. Die Zeit überbrückte man mit so genannten Vorschaltgesetzen, die aber nur begrenzt den Herausforderungen entsprachen. Außerdem fehlten dem ostdeutschen Personal auch die Praxis- und Anwendungserfahrungen. Diese Zeit wurde von den großen Handelsketten der Verbrauchermärkte genutzt, um auf der „grünen Wiese“ fernab von den Siedlungszentren ihre großen Einkaufsstätten zu errichten. In Westdeutschland waren diese Märkte wegen der nachteiligen Wirkungen für die innerstädtischen Einkaufseinrichtungen stark reglementiert. In Ostdeutschland fand in dieser „rechtsfreien“ Zeit ein derartiger Ausbau statt, so dass dort schon Ende der 90er Jahre die Verbrauchermärkte über mehr Einkaufsfläche verfügten als in Westdeutschland.
Die größten Herausforderungen lagen jedoch in der Wirtschaftsentwicklung, der Wohnversorgung und der angemessenen Ausstattung mit funktionierender, zeitgemäßer Infrastruktur. Die Wirtschaftsentwicklung führte sehr schnell zum Zusammenbruch des Großteils ostdeutscher Betriebe, soweit diese nicht durch westdeutsche Firmen übernommen wurden. Wesentliche Bereiche der Energiewirtschaft DDR wurden aufgelöst, damals diskret als Abwicklung bezeichnet. So vor allem der Braunkohleabbau. Die Kernprobleme lagen aber in der anderen Wirtschaftsstruktur und geringeren Produktivität.
In der DDR waren ca. 52 % der Beschäftigten im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe beschäftigt und entsprechend weniger im Dienstleistungssektor. In der Bundesrepublik beschäftigte damals das produzierende und verarbeitende Gewerbe nur noch etwa 33 % der Arbeitnehmer, bei entsprechend höherer Produktivität. Allein durch die strukturelle Anpassung wurde etwa ein Drittel der ostdeutschen Arbeitskräfte, trotz guter Qualifikation, nicht mehr vom Arbeitsmarkt benötigt. Die ostdeutschen Betriebe, die diese Zeit der radikalen Umstrukturierung überlebten, hatten nun oft eine hochmoderne Ausstattung, teilweise mit höherer Produktivität als viele westdeutsche Betriebe. Deshalb war der Arbeitskräftebedarf in diesen Betrieben noch geringer. Außerdem brachen für die ostdeutschen Betriebe die Vertriebsstrukturen und der Großteil der angestammten Handlungsbeziehungen weg, denn der Großteil der Handelsverträge oblag in der DDR nicht den Betrieben, sondern dem zuständigen Ministerium. Das Ministerium und damit die nahezu ausschließlich in dessen Zuständigkeit liegenden Vertriebsstrukturen waren mit der Auflösung der DDR nicht mehr existent. Zudem befanden sich die Länder des ehemaligen Ostblocks im Umbruch mit umfassenden wirtschaftlichen Veränderungen, die ebenfalls zur weitgehenden Auflösung der alten Handelsbeziehungen Ostdeutschlands führten.
Die wirtschaftliche Umstrukturierung und Anpassung Ostdeutschlands war nicht vom uneingeschränkten Erfolg begleitet. Das Konzept, mit dem die weitgehend staatlichen Betriebe, Kombinate und Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften durch die Treuhandgesellschaft des Bundes in einem sehr kurzen Zeitraum radikal privatisiert wurden, musste nahezu zwangsläufig zum Zusammenbruch weiter Teile der ostdeutschen Wirtschaft führen. Dadurch wurden nur Betriebe gewinnträchtig, die sich mit begrenztem Aufwand dazu hochrüsten ließen oder die westdeutsche Firmen zur Liquidierung aufkauften, um sie zur Marktbereinigung abzuwickeln (zu schließen) und sich so deren Konkurrenz zu entledigen. Zudem fand damit ein weitgehender Besitzübergang der überlebenden ostdeutschen Betriebe in westdeutsches und ausländisches Kapital statt, denn entsprechend dem Staatensystem der DDR fehlte es den Ostdeutschen an Privatkapital, um in diesen Prozess einzusteigen. In der frühen Nachkriegszeit der Bundesrepublik gab es da ganz andere Beispiele, wie die erst über einen längeren Zeitraum erfolgte Privatisierung des VW-Konzerns, zumal sich dort bis heute der Staat mit seinem immer noch bestehenden Firmenanteil Einfluss sichert. Aus dieser positiven Erfahrung hätte man lernen und die wirtschaftliche Umstellung etwas behutsamer und variantenreicher vornehmen können.
Eine wichtige Chance für die wirtschaftliche Entwicklung wurde zudem vertan. Damals waren die wachstumsstarken westdeutschen Regionen bereits vom zunehmenden Fachkräftemangel betroffen. Das hätte dazu führen können, dass sie dort Filialbetriebe errichten, wo es ausreichend freie Fachkräfte gab, also in Ostdeutschland. Stattdessen verfügte die Bundesregierung, wer innerhalb eines halben Jahres keine Beschäftigung findet, muss ein Arbeitsangebot in Westdeutschland annehmen, wenn nicht wesentliche familiäre oder soziale Gründe gegen den Umzug sprechen. Diese Vorgabe nutzten viele Firmen. Zu dieser Zeit fuhren u. a. Autobusse vor den ostdeutschen Arbeitsämtern vor und warben Interessenten für Vorstellungsgespräche bei großen westdeutschen Firmen an, einschließlich des kostenlosen Hinund Rück-Transports. Die Offerten wurden häufig angenommen. Nur die westdeutschen Firmen rekrutierten längst nicht alle Interessenten, sondern vor allem die gut und überdurchschnittlich qualifizierten. Durch diese Maßnahmen fand am Arbeitsmarkt ein gewisses Ausbluten des ostdeutschen „Humankapitals“ zum Vorteil der westdeutschen Entwicklung statt. Für mich war es unbegreiflich, dass sich dagegen die ostdeutschen Landesregierungen nicht massiv zur Wehr setzten. Diese Entwicklung hat mit anderen Einflüssen zu größerer Abwanderung aus Ostdeutschland geführt. Mehr als eine Million Ostdeutsche wanderten nach Westdeutschland, vor allem jüngere Personen, bei weitaus weniger Gegenbewegungen. Die Altersstruktur hat sich dadurch umgekehrt. Die Ostdeutschen, die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung ein deutlich geringeres Durchschnittsalter als die westdeutsche Bevölkerung aufwiesen, haben durch diese Abwanderungen und die damals gleichzeitig stark gesunkene Geburtenquote heute ein deutlich höheres Durchschnittsalter als die Einwohner Westdeutschlands.
Ostdeutschland wies nach der Wiedervereinigung größte Probleme in der Wohnraumversorgung auf. Eine Hinterlassenschaft der DDR. Der DDR gelang es im gesamten Zeitraum ihrer Existenz trotz größter Bestrebungen nicht, dieses Problem zu lösen. Deshalb bemühte sich der Bund nach der Wiedervereinigung massiv gegenzusteuern. Vor allem mittels großzügiger Steuerabschreibung sollte Kapital nach Ostdeutschland bzw. in die neuen Bundesländer gelenkt werden, um dort die Wohnversorgung zu lösen. Außerdem erhoffte man sich davon ähnliche positive Wirtschaftsimpulse, wie sie Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg durch die massive Wohnbauförderung der 50er Jahren erfuhr. Gleichfalls gab es umfangreiche, gut dotierte Förderprogramme zur Wohnhaussanierung, um die häufig maroden Bauzustände zu beheben. Die Wohnungsnot konnte so tatsächlich in wenigen Jahren in weiten Gebieten Ostdeutschlands beseitigt werden. Sie kehrte sich nun aber in eine Überversorgung um. In Anbetracht des hohen Bevölkerungsrückgangs Ostdeutschlands durch die hohe Abwanderung der Bevölkerung schrumpfte die Einwohnerzahl. Zudem wurde diese Entwicklung noch durch den starken Geburtenrückgang verstärkt. Als Folge standen alsbald in sehr vielen Gemeinden weitaus mehr neu gebaute und sanierte Wohnungen zur Verfügung, als nachgefragt wurden. Auch diese Entwicklung war frühzeitig absehbar und Experten haben davor gewarnt. Ich gehörte damals als wissenschaftlicher Direktor eines Bund-Länder-Forschungsinstituts auch dazu. Die Bundesregierung brauchte aber noch Jahre, um zu reagieren. Es dauerte so lange, dass die Funktion des Wohnungsmarktes infolge des inzwischen weitaus zu hohen Überangebotes massiv gefährdet war. Zur Stabilisierung der Entwicklung wurde nun für Ostdeutschland ein milliardenschwer ausgestattetes Förderprogramm zum Abbruch von Wohngebäuden aufgelegt. Eine Geldvernichtung größten Ausmaßes, die bei zügiger Reaktion auf die warnenden Expertenstimmen vermeidbar gewesen wäre.
Die Entwicklung führte zu weiteren Auswüchsen. So stiegen z. B. die Verkaufspreise für neue Apartments nach der Bekanntgabe der neuen hohen möglichen Steuerabschreibungen enorm an. In einer der besonders nachgefragten ostdeutschen Metropolen erhöhten sich deshalb die Preise innerhalb einer Woche bis zu 40 %. Westdeutschen Kapitalanlegern wurden Hausprojekte durch hohe Steuerabschreibungen von Bauträgergesellschaften mit Garantiemiete von 26 DM/qm schmackhaft gemacht, obwohl damals in Ostdeutschland der durchschnittliche Mietpreis unter 6 DM/qm lag. Das wussten die meisten Westdeutschen nicht und griffen bei diesen garantierten traumhaften Offerten und hohen Steuerabschreibungsmöglichkeiten zu. Die Ernüchterung kam bald, als diese Miete bei weitem nicht am Markt realisierbar war und sich durch Auflösung der Bauträgergesellschaft die Garantie verflüchtigte. Verdruss gab es auch mit der großzügigen Sanierungsförderung. In der sächsischen Stadt Döbeln kamen z. B. Mitte der 90er Jahre die Experten zur Stadtentwicklung zu dem Ergebnis, dass bestimmte Wohnhochhäuser der ehemals städtischen Wohnungsgesellschaften (inzwischen privatisiert) zukünftig keine Marktchancen haben und deshalb aus Kostengründen abzubrechen seien. Die Vertreter der Gesellschaften waren entsetzt, denn davon waren über 80 Wohnungen betroffen, die wenige Jahren zuvor mit den günstigen Sanierungskrediten hergerichtet wurden. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie sie eigentlich vor einer derartigen Kreditvergabe üblich ist, wurde von der Landesaufbaubank, die die Mittel vergab, wohl nicht verlangt. Die Kreditnehmer waren damit überfordert, denn diese Zusammenhänge und die Marktentwicklung konnten sie damals als Ostdeutsche, die Jahrzehnte nur Defizite in der Wohnraumversorgung zu bewältigen hatten, nicht erkennen. Aus meiner Sicht gab es hier große Unterlassungssünden der Bank, denn diese hätte den Überblick haben und entsprechende Prüfungen einfordern müssen. Es erscheint fast so, als wenn manche dieser Banken vor allem darauf aus waren, einen hohen Umsatz an Fördermitteln zu erreichen.
Ein weiteres zwiespältiges Feld war die Infrastrukturversorgung. Ostdeutschland wies große Defizite auf, von den oft maroden Straßen, fehlenden Gewerbeflächen bis zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung oder auch den Wohnfolgeeinrichtungen der Daseinsvorsorge. Auch dagegen stemmte sich der Bund mit großzügigen, umfangreichen Förderprogrammen. Das wurde auch von unseriösen Akteuren genutzt. So wurden z. B. vielen Kommunen in Hinblick auf die hohen Fördergelder viel zu große Anlagen zur Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abwassersysteme oder große Gewerbegebiete an Standorten, wo diese nie benötigt werden, aufgeschwatzt. Das brachte Maklern bei Grundstücksgeschäften und sonstigen Akteuren sowie den Planern und Ingenieuren hohe Profite ein. Für die Kommunen folgten daraus aber oft gewichtige Nachteile. Zu große Trinkwassersysteme und Kläranlagen verursachen hohe Unterhaltskosten, so dass auf die Einwohner unverhältnismäßig hohe Gebühren zukamen oder die Kommunen die Kosten mit hohen Zuschüssen ausgleichen mussten. Die Gewerbegebiete verursachen ebenfalls Folgekosten, die an den Kommunen hängen blieben, wenn sich kaum Betriebe ansiedelten. Zudem wurden dort häufig nur Zweigbetriebe errichtet, deren Gewinne am Stammsitz des Unternehmens, also in den alten Bundesländern und nicht in der betreffenden Gemeinde, zu versteuern waren. Hier berieten, prüften und kontrollierten die Förderstellen und Aufbaubanken viel zu wenig.
Die Akteure der vielen übergroßen „Fehlplanungen“, mit denen die Honorare in die Höhe getrieben wurden, kamen in der ersten Zeit weitgehend aus den alten Bundesländern. Ohne „Wessis“ ging nichts. Manche Ostdeutschen haben aber schnell gelernt und ebenfalls entsprechend agiert. So gab es z. B. ein Förderprogramm für kommunale Entwicklungsplanungen, das erst bei 160.000 DM gedeckelt war. Mir sind persönlich ostdeutsche Akteure in Erinnerung, die daraufhin ihnen bekannten Bürgermeistern die Wichtigkeit eines Entwicklungskonzeptes darlegten. Zugleich zeigten sie der Gemeinde auf, wie sie die Planung ohne eigene Kosten bekämen. Die Förderbestimmungen schrieben zwar der Gemeinde einen Eigenanteil von 25 % vor, aber der war zu umgehen. Dafür boten die Akteure der Gemeinde an, in dieser Höhe etwas abzukaufen. Damit es sich lohnt, sollte die Gemeinde den Höchstsatz von 160 Tsd. DM beantragen, denn damit konnte eher ein umfassendes Konzept erstellt werden. Der Eigenanteil der Gemeinde wurde z. B. damit beschafft, dass alte, nicht mehr benötigte Akten, unter der Voraussetzung der Auftragserteilung, von den Akteuren für 40.000 DM abgekauft wurden. Damit konnte die Gemeinde den vorgeschriebenen Eigenanteil für die höchste Fördersumme quasi ohne eigene Kosten leisten. Natürlich gab es neben diesem negativen Beispiel von West- und Ostakteuren etliche seriöse Akteure und Macher, die sich redlich um die Entwicklung Ostdeutschlands bemühten. Es gab aber eben auch die anderen – und dies leider häufig.
Fehlplanungen und deren bauliche Realisierung sind aber auch auf ostdeutsche Behörden zurückzuführen. Beispielhaft sind dafür die technische Infrastruktur wie auch der Neubau von Schulen. Es wurden nicht nur aufgrund falscher Beratungen zu große Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen gebaut, sondern auch weil Behörden für ländlichen Räumen häufig große zentrale Anlagen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung bevorzugten. Diese Anlagen entsprachen durchaus dem zum Zeitpunkt der Planung ermittelten Bedarf. Sie waren also nicht überdimensioniert – zunächst nicht. Die zukünftige Entwicklung des enormen ostdeutschen Einwohnerrückgangs wurde aber nicht einbezogen. Mit dem Einwohnerrückgang ging auch der Bedarf an Trinkwasser sowie an der Abwasserentsorgung zurück. Die neu errichteten großen zentralen Anlagen bedingen aber in ländlichen Räumen für die Auslastung ihrer Kapazitäten sehr große bzw. weite Ver- bzw. Entsorgungsnetze. Wenn das Trinkwasser aufgrund zu geringer Entnahme in den Netzen zu lange steht bzw. nur einen sehr langsamen Durchfluss aufweist, beginnen sich in den Rohren Schwemmstoffe zu lösen, die das Wasser verunreinigen. Es kann dadurch zu einer Verkeimung kommen. Dann müssen die Netze aufwendig gespült werden. Wenn der Durchsatz (Durchfluss) des Abwassers zu gering ist, kann es zu Verstopfungen und Geruchsbelästigungen kommen, was ebenfalls aufwendige Netzspülungen erfordert. Führen die Spülungen zur deutlichen Verdünnung des Abwassers, sterben in unseren modernen, vollbiologischen Kläranlagen die dafür erforderlichen Mikroorganismen ab und die Klärfunktion bricht zusammen. Auf diese Probleme wurde angesichts der ostdeutschen Einwohnerentwicklung von Experten frühzeitig hingewiesen, mit der Empfehlung dezentrale und semizentrale Anlagen mit flexiblen Nutzungskonzepten zu errichten. Damit hätte man die Probleme vermeiden oder zumindest stark vermindern können. Diese Warnungen und Empfehlungen wurden aber längere Zeit ignoriert, wie ich selbst bei meiner Beratung eines ostdeutschen Bundeslandes erfahren musste.
Ähnlich waren letztlich auch Fehlentscheidungen in der Schulplanung. Bei der Errichtung neuer Schulen, insbesondere in ländlichen Räumen die neuen großen, zentralen Berufsschulstandorte, wurde häufig die bevorstehende Schülerentwicklung nicht beachtet. Dabei war anhand der Anzahl der in Krippen und Kindertagesstätten betreuten Kinder eindeutig der bevorstehende Schülerrückgang und damit sinkende Kapazitätsbedarf ersichtlich. Die Folgen dieser Behördenausrichtung waren dann teilweise Berufsschulen, die nur noch zum Teil genutzt wurden, aber hohe, eigentlich vermeidbare Unterhaltskosten verursachten.
Ostdeutschland wies damals sowohl hervorragende Naturgebiete auf, die sich häufig im guten Zustand befanden, als auch erhebliche Umweltschäden. Umweltschäden gab es vor allem durch den Braunkohletagebau, aber auch durch den Uranabbau der WISMUT in Sachsen und Thüringen sowie durch punktuelle Einzelfälle wie die Teerseen bei Nobitz. Allein für die Sanierung der Hinterlassenschaft der WISMUT wurden Anfang der 90er Jahre etwa fünf Milliarden DM veranschlagt, damals eine gewaltige Summe. Diese Maßnahme ist inzwischen seit langem erfolgreich abgeschlossen. Die Landschaftsschäden der Braunkohlegebiete südlich von Leipzig sind mit enormem Aufwand in eine attraktive naturräumliche Freizeit-Seen-Landschaft umgewandelt worden. Dafür erfolgten die Flutung der einstigen Abbaugruben und eine massive Aufforstung der Landschaft.
Heute kann man resümieren, unter der Regierung Kohl fand ein enormer Mitteltransfer nach Ostdeutschland statt. Es wurde viel erreicht. Es gibt dort keine Wohnungsnot mehr. Die Warenversorgung entspricht dem westdeutschen Niveau. Die Ortsbilder haben sich durch umfassende Sanierungshilfen wesentlich verbessert. Die damals marode Infrastruktur befindet sich heute überwiegend im guten Zustand. Zugleich wurde aber auch durch falsche Konzepte und oft unzulängliche oder fehlende fundierte Prüfungen in enormem Ausmaß Geld vergeudet. Das Konzept zur wirtschaftlichen Angleichung wies große Schwächen auf, wie der immer noch bestehende Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland zeigt. Viele Betriebe, die Probleme für die strukturelle Anpassung hatten oder an denen aus marktwirtschaftlicher Sicht keine Investoren aus Westdeutschland und dem Ausland Interesse fanden, wurden dichtgemacht, oder in der damaligen Sprache der dafür zuständigen Treuhandgesellschaft des Bundes „abgewickelt“. Größere ostdeutsche Investoren gab es nicht, da in der DDR nur der ostdeutsche Staat über die erforderlichen Ressourcen verfügte und der war ja mit der Wiedervereinigung aufgelöst worden. Die Entwicklung führte zur umfassenden Freisetzung ostdeutscher Arbeitskräfte. In Ostdeutschland wurde damals etwa jeder dritte Ostdeutsche, trotz seiner im europäischen Vergleich guten Ausbildung und vieler Umschulungen, dauerhaft arbeitslos. Dabei hat sich die oben angesprochene Verpflichtung zur Umsiedlung arbeitsloser ostdeutscher Fachkräfte besonders nachteilig ausgewirkt. Hiermit entfiel ein möglicher wichtiger Anreiz für westliche Firmen, Betriebsstätten in Ostdeutschland zu übernehmen oder zu errichten. Dadurch und wegen konjunktureller Einbrüche waren die 90er Jahre, insbesondere die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, von hoher bis sehr hoher Arbeitslosigkeit geprägt. Sie betrafen nun auch Westdeutschland, wenngleich in geringerem Ausmaß. Zugleich bewirkte die Entwicklung eine anhaltende Abwanderung junger Menschen aus Ostdeutschland. Sie galt nun nicht nur wie anfangs für junge Männer, sondern später im fast noch stärkeren Maße für ostdeutsche Frauen. Diese Entwicklung hatte auch langfristige nachteilige Folgen. Spätestens seit der Jahrtausendwende bzw. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung wird die Entwicklung in den neuen Bundesländern durch den Fachkräftemangel benachteiligt.
Besonders bedauerlich sind die nicht genutzten Chancen durch die Ablehnung jeglicher Errungenschaften Ostdeutschlands zu Gunsten einer weitgehendsten Ausrichtung auf die westdeutschen Systeme. Als Beispiel sei auf die Verkehrsanbindung in ländlichen Räumen verwiesen. Heute verfügen diese Räume über hochmoderne, bequeme Verkehrsmittel, aber dafür werden etliche Ortschaften nicht mehr vom öffentlichen Personennahverkehr angefahren, z. B. in der Region Greifswald über ein Viertel der Dörfer. Die Grundversorgung im Gesundheitswesen ist wie oben angesprochen (S. 43-44) gleichfalls ein Beispiel für damaliges Versagen, vor allem die Schließung der Polikliniken und Abschaffung der Gemeindeschwestern zugunsten rein privatwirtschaftlicher ambulanter Versorgungsstrukturen. Die inzwischen aufgetretenen Versorgungsprobleme wären vermeidbar gewesen, wenn man die betreffenden DDR-Institutionen erhalten und weiter entwickelt hätte anstatt sie zugunsten einer rein privatwirtschaftlichen Ausrichtung abzuschaffen. Aber es geht nicht nur um ungenutzte Chancen, sondern um die Veränderungen in der Wirtschaftspolitik. Wie die in der Einleitung angeführten Befürchtungen verschwindet mit der Ablösung der sozialistischen Staaten die Systemkonkurrenz, die für Ludwig Erhards Modell der sozialen Marktwirtschaft wesentlich war. Damit wird eine Entwicklung in Richtung Kapitalismus begünstigt, wie das soziale Auseinanderdriften in Deutschland belegt.