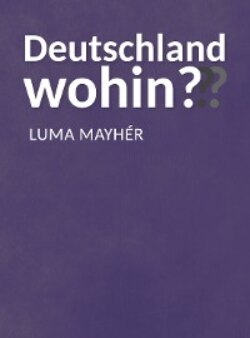Читать книгу Deutschland wohin??? - Luma Mayhér - Страница 12
1.4 Die Zeit unter Kanzlerin Merkel
ОглавлениеFrau Merkel hat die Bundestagswahl gegen den damaligen Kanzler Schröder mit einer bis dahin historisch äußerst knappen Mehrheit gewonnen. Ohne das Zerwürfnis Schröders mit Oskar Lafontaine wäre ihr das kaum gelungen. Der abgewählte Kanzler Schröder gratulierte seiner Konkurrentin nicht zum Erfolg, wie etwa Helmut Schmidt, der nach dem Misstrauensvotum dem zukünftigen Kanzler Kohl gratulierte. Stattdessen sprach er in der Fernsehübertragung nach der Wahl von einer israelischen Lösung (Mit der der unterlege Staatschef zunächst weiter regieren kann, bis er entsprechend der zuvor getroffenen gemeinsamen Vereinbarung durch seinen siegreichen Konkurrenten abgelöst wird). Das war für damalige deutsche Situation unsinnig. Wie auch immer, durch diesen Schrödervorstoß unterblieb eine kritische parteiinterne Reflexion des sehr knappen Wahlerfolgs von Angela Merkel, vielmehr stellte sich nun die CDU voll hinter die neue Kanzlerin Merkel. Die Kanzlerschaft von Frau Merkel hatte ich damals sehr begrüßt, wie später auch die Präsidentschaft von Joachim Gauck. Damit wurden die beiden höchsten politischen Positionen Deutschlands von zwei Ostdeutschen besetzt. Das erschien mir wichtig und richtig. Denn die Ostdeutschen konnten sich zunächst parteipolitisch kaum wirksam gruppieren, zum einen wegen der abgewirtschafteten SED, die sie ja quasi grade „verjagt“ hatten, und zum anderen, weil sie bei null anfangen mussten. Sie hatten nicht die Organisationsstrukturen und waren noch nicht mit dem eingespielten politischen Parteiensystem Westdeutschlands vertraut. In Sinne einer Wiedervereinigung war es gleichfalls wichtig, eine gemeinsame Parteienlandschaft aufzubauen. Mit der ostdeutschen Besetzung der Spitzenämter war aus meiner Sicht ein sinnvoller und richtiger Anfang erfolgt. In der Kanzlerschaft von Frau Merkel sah ich einen weiteren positiven Aspekt. Damit wurde dieses Amt endlich auch mal von einer Frau besetzt.
Die Kanzlerin Merkel regierte erfolgreich von 2005 bis 2009 in einer Koalition mit der SPD, von 2009 bis 2013 mit der FDP, von 2013 bis 2018 erneut mit der SPD, mit der sie in ihrer voraussichtlich letzten Phase auch bis 2021 regieren wird. In diese Zeit war Christian Wulff, der spätere Bundespräsident, Ministerpräsident des von der CDU regierten Niedersachsen. Herr Wulf schaffte es, die Landesfinanzen von Niedersachsen durch rigoroses Sparen zu stabilisieren, u. a. auch durch massive Kürzungen der Mittel im Wissenschaftsbereich. Er setzte dann an der Universität Hildesheim die Verleihung der Ehrendoktorwürde für seinen Freund Carsten Maschmeyer durch, obwohl dieser weder über ein abgeschlossenes Studium noch über wissenschaftliche Meriten verfügte (Beward, M., 2012, Google 28.3.2019). Angeblich hatte die Bürgerschaft die Verleihung vorgeschlagen. Für die betreffende niedersächsische Universität ein heikler Vorgang. Die Behandlung dieses Vorgangs konnte ggf. Auswirkungen auf die weitere Mittelausstattung haben. Herr Maschmeyer bekam die Ehrendoktorwürde. Ministerpräsident Wulff hielt dann an der Universität die Laudatio zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an seinen Freund Maschmeyer. Als Wissenschaftler, der lange Vorsitzender der Promotionskommission seiner Fakultät war, kann ich diese Verleihung nur äußerst kritisch sehen. An meiner Universität hätte ich bei einem derartigen Vorgang mein Amt aus Protest vorher niedergelegt.
Nach dem plötzlichen Rücktritt von Bundespräsidenten Köhler 2010 wurde Christian Wulff zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Die plötzliche Kandidatur und Wahl von Christian Wulff zum Bundespräsidenten ist irritierend. Ein Ministerpräsident ist in seinem Bundesland die Spitzenperson seiner Partei. Das spricht dafür, dass er sich mit Vollblut für das Amt und die Umsetzung der politischen Linie seiner Partei, die er letztlich selbst mitprägte und bestimmte, einsetzt. Herr Wulff konnte das anscheinend von einem Tag zum anderen ablegen und sich nun der Wahl des auf Neutralität verpflichteten Bundespräsidenten stellen. Das ist für mich absolut unglaubwürdiger Opportunismus. Frau Merkel unterstützte und befürwortete trotzdem diese Wahl. In Tageszeitungen gab es damals Mutmaßungen, dass Christian Wulf ein Konkurrent für die Kanzlerin werden könnte und sie deshalb seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten unterstützt. Rückblickend bin ich der Auffassung, Herr Wulff hatte nie das Format eines wirklichen Konkurrenten für Kanzlerin Merkel. Christian Wulff ist dann bekanntlich nach einer Kontroverse mit der Bildzeitung, in der er Drohungen gegenüber dieser Zeitung aussprach, sowie wegen eines gegen ihn gerichteten strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zurückgetreten. Aus meiner Sicht war erfreulich, dass nun Joachim Gauck zum neuen Bundespräsidenten gewählt wurde.
In der Zeit unter Kanzlerin Merkel gab es einige weitere einschneidende Veränderungen. Der unter Bundeskanzler Schröder 2002 eingeleitete Einsatz der Bundeswehr als Verbündeter der Nato in Afghanistan wurde zunehmend kriegerischer (2.2.3, S. 149). In Anbetracht der wachsenden internationalen Aufgaben der Bundeswehr und der begrenzten Ressourcen erfolgt unter Verteidigungsminister von Gutenberg eine umfassende Reform mit der Abschaffung der Wehrpflicht und Umstrukturierung zu einer wesentlich kleineren Berufsarmee. Die Chance zur Umwandlung der nun erlassenen Wehrpflichtzeit in die Verpflichtung eines sozialen Jahres wurde wohl aus wahltaktischen Gründen von der Regierung nicht genutzt. Theo von Gutenberg verlor bekanntlich wegen nachgewiesener Plagiatsfälle seiner Dissertation den Doktortitel (Er hat 1919 mit einer neu erarbeiteten Dissertation zu Recht promoviert). Das führte zu seinem Rücktritt. Nicht viel später wies man der damaligen Ministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, ebenfalls Plagiatsstellen in ihrer Doktorarbeit nach. Für eine Ministerin, die für den Wissenschaftsbereich zuständig ist, war das besonders verwerflich und enttäuschend. Frau Schavan trat aber erst nach ihrem nicht erfolgreichen juristischen Widerstand zurück.
Diese Ereignisse sind der Kanzlerin Merkel in keiner Weise anzulasten. In ihrer Regierungszeit war die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland von großem Erfolg geprägt und vom gleichzeitigem wachsenden Einfluss Deutschlands in der EU, in besonders enger Kooperation mit Frankreich. Allerdings muss anerkannt werden, dass trotz der Kritik an Kanzler Schröder mit dessen Sozialabbau und Steuerpolitik wichtige Voraussetzungen für den Erfolg der deutschen Wirtschaft geschaffen wurden. Den von Schröder eingeleiteten Wirtschaftserfolg schrieb die breite Bevölkerung aber der Regierung Merkel zu, denn unter ihrer Kanzlerschaft wurden die Erfolge realisiert. Die sozialen Opfer blieben hingegen an der SPD hängen, da der erhebliche Sozialabbau schließlich unter dem SPD-Kanzler Schröder stattfand.
Die Kanzlerschaft Merkel war aber zugleich auch mit steigenden deutschen Beiträgen zur Finanzierung der EU verbunden. In Deutschland wuchs der Wohlstand, aber die Verteilung veränderte sich allmählich scherenartig. Die Zahl der Wohlhabenden und sehr Wohlhabenden nahm zu, aber umgekehrt auch die Personenzahl der ärmeren Bevölkerung, etwa wie das Spreizen einer sich öffnenden Schere ( 3.4 Soziale Spaltung). Mit den nominal steigenden Einkommen stieg letztlich auch die Belastung durch die Steuerprogression, obwohl sich die Inflationsquote auf verhältnismäßig niedrigem Niveau bewegte. In Anbetracht, dass in der Steuerprogression die inflationsbedingte Geldentwertung keine Berücksichtigung fand und eine Anpassung der Steuersätze an die Entwicklung weitgehend unterblieb, wurden im zeitlichen Verlauf immer mehr Personen, vor allem auch Mittelständler, von höheren Progressionssätzen betroffen. Für Spitzenverdiener veränderte sich kaum etwas. Deshalb wird die soziale Einkommensspaltung im erheblichen Maße von der Steuerpolitik der Bundesregierung mit verursacht, wie im Abschnitt „Soziale Spaltung“ näher dargelegt ist.
In der Rentenentwicklung und deren Perspektiven zeichneten sich neue Probleme und Herausforderungen ab. Durch die weiter angestiegene Dauer der Lebenszeiten und der langen Ausbildungszeiten müssen, wie oben dargestellt wurde (S. 1.3, S. 58-59), die Renten für immer mehr Rentner und diese für immer längere Zeiträume von einer demografisch bedingt rückläufigen Bevölkerung bei sinkender Lebensarbeitszeit erbracht werden. Jungen, die im Jahr 2000 geboren werden, haben statistisch eine Lebenserwartung von ca. 75 Jahren, Mädchen von ca. 81 Jahren. Für Kinder, die 2020 geboren wurden, erhöht sich die Lebenserwartung bereits auf etwa 79 bzw. 84 Jahre. Die Altersversorgung muss also immer länger gezahlt werden. Zudem haben sich die Ausbildungszeiten deutlich verlängert. Der Großteil der jungen Menschen tritt deshalb erst nach dem 20. Lebensjahr in die Berufsausübung ein. Erst dann zahlen sie Rentenbeiträge. 2010 lag die durchschnittliche Bezugsdauer der Versicherungsrenten bei 18,5 Jahren, 2018 war sie bereits auf 20 Jahre gestiegen (Angabe der Rentenversicherungsträger vom 17.6.2019). Bei Männern betrug der Anstieg 16,2 J. auf 18 J., bei Frauen von 20,9 J. auf 21,8 J. Deshalb werden für die Renten immer mehr Mittel benötigt. Zugleich steht eine ansteigende Altersarmut bevor. Aufgrund der unter Schröder und Riester eingeführten Rentenformel sind die Rentenbezüge schon heute auf durchschnittlich 48 %, also weniger als die Hälfte des letzten Nettolohns, abgesunken. Zudem sind Renten zu versteuern und ebenfalls davon Sozialabgaben zu begleichen. Bei einer Beibehaltung der Schröder-Riester-Rentenformel steht ein weiteres Absinken der Renten mit entsprechendem Anstieg der Altersarmut bevor.
In Anbetracht der absehbar ansteigenden Rentenprobleme wurden von der Regierung Merkel zwei wichtiger Schritte zum Gegensteuern eingeleitet: die Anhebung der Lebensarbeitszeit und Grenzen für den Ruhestandseintritt. Der bis dahin geltende Ruhestandseintritt bei Vollendung des 65. Lebensjahres erfolgt zukünftig erst bei Vollendung des 67. Lebensjahres. Diese Veränderung vollzieht sich aber über eine langsame, allmähliche Anhebung, so dass der Ruhestandseintritt mit 67 Jahren erst 2030 erreicht wird. Der Weg ist richtig, denn die Rentenprobleme sind im hohen Maße auf die steigende Lebenserwartung zurückzuführen. Schließlich hat sich die Lebenserwartung seit Einführung des Ruhestandseintritts von 65 Jahren um nahezu 50 % erhöht! Außerdem sind viele Personen heute auch noch im Alter leistungsfähig, wie übrigens ein Großteil der Politiker älter als 65 Jahre ist. Die Gewerkschaften liefen gegen diese Veränderungen Sturm. Sie befürchteten, dass dadurch die Kündigungszahlen älterer Arbeitnehmer steigen und es verstärkt zu deren Altersarbeitslosigkeit mit entsprechenden sozialen Folgen kommen würde. Nun sind Altersrenten und Altersbeschäftigung zwei ganz unterschiedliche Sachebenen, aber die Befürchtungen der Gewerkschaften sind aufgrund der Arbeitsmarkterfahrungen verständlich und nachvollziehbar. Die Gewerkschaften setzten deshalb mit der SPD durch, dass Personen beim Nachweis von 45 Arbeitsjahren bereits bei Vollendung des 63. Lebensjahr in die Rente gehen können, also ein Schritt in die entgegengesetzte Richtung. Unter Rentenaspekten ist das katastrophal. Das gilt umso mehr, da jüngere Arbeitnehmer, die heute die Renten für diese Art von Frühverrentung erarbeiten, diese Vergünstigung mit Sicherheit nicht erfahren werden. Im Gegenteil, es spricht vieles dafür, dass sie später länger als bis zur Vollendung des 67. Lebensjahr arbeiten müssen.
Zur Begrenzung des Absinkens der Renten wurde in der 16. Wahlperiode des Bundestages von der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD gesetzlich geregelt, dass bis 2025 das Rentenniveau nicht unter 48 % sinken und die Rentenbeiträge der Beschäftigten nicht über 20 % steigen dürfen. Wenn es jedoch bei der unter Kanzler Schröder und seinem Sozialminister Riester geschaffenen Rentenformel bleibt, wird sich die Entwicklung danach sehr verschärfen. Nach diesen Festlegungen würden die Renten von ihrem heutigen Niveau von 48,1 % des Durchschnittslohnes bis 2030 stufenweise auf ca. 45,8 % und bis 2032 auf 44,9 % absinken(WK 29.11.2018). Die Entwicklung wird zusätzlich noch dadurch verschärft, dass immer mehr Arbeitskräfte vorzeitig aus dem Beruf ausscheiden und in Rente gehen. Zum einen weil der heutige hohe Arbeitszeitdruck und Terminstress zu physischen Leiden führen, wie die hohe Zunahme an Burnout -Patienten belegt, und zum anderen wegen der durchgesetzten Möglichkeit, bereits mit 63 Jahren in Rente zu gehen.
Angesichts der 2018 gezahlten Durchschnittsrenten von 1.193 € für Männer und 667 € Rente für Frauen ist das bevorstehende Absinken der Renten kaum zu verkraften, zumal von den Renten auch noch Krankenkasse und Steuern sowie die steigenden Mieten zu bezahlen sind. Außerdem werden bei Beibehaltung der Schröder/Riester Rentenformel die Renten auch nach 2032 weiter sinken. Es ist absehbar, etliche Altersbezüge würden dann unter die Höhe der Grundsicherung absinken. Daher kam die Forderung, dass das Rentenniveau zumindest bis 2025/2026 nicht unter die heutigen 48 % absinken darf. Aber wie geht es dann weiter? Die SPD versucht derzeit zumindest den Anspruch auf eine soziale Grundsicherung nach 35 Arbeitsjahren durchzusetzen. Der Arbeitnehmerflügel der CDU sprach sich dafür aus, Personen, die im Alter von der finanziellen Grundsicherung abhängen, einen Rentenzuschlag von 25 % zu gewähren. Sie argumentieren, dass Personen, die ihr Leben lang arbeiteten und für die Renten einzahlten, im Alter nicht weniger Einkommen erhalten dürfen als Personen, die nie Rentenbeiträge leisteten (WK 22.11.2018). Der SPD-Politiker und derzeitige Finanzminister Scholz forderte das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren. Die Umsetzung dieser Forderungen würde aber erhebliche Zuschüsse an Steuermitteln erfordern, insbesondere, wenn in nächster Zeit die geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter eintreten. Immerhin hat die Kanzlerin ihre vor zwei Jahren erfolgte Verlautbarung revidiert, dass sie bis 2030 keinen Handlungsbedarf für die Renten sieht.
Von der Regierung wurde 2019 schließlich eine so genannte Expertenkommission unter dem Namen „Verlässlicher Generationenvertrag“ eingesetzt, die Vorschläge für die zukünftige Sicherung und Gestaltung der Renten erarbeiten sollte. Der 12-köpfigen Kommission unter der Leitung des Kanzleramtschefs gehörten die Fraktionsvorsitzenden bzw. deren Stellvertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD, die Gewerkschaft, die Arbeitgeberverbände sowie Experten aus Ökonomie und dem Sozialbereich an. Außerdem nahmen die Deutsche Rentenversicherung und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales an den Sitzungen teil. Die Vertreter von Politik und Interessenverbänden hatten somit ein merkliches Übergewicht gegenüber den Experten. Die Ergebnisse im Abschlussbericht werden eher kritisch bewertet, vor allem wegen der überwiegend nur allgemeinverbindlichen, wenig präzisen Aussagen und Empfehlungen. In der Publikation des Paritätischen Gesamtverbandes Fachinformation Arbeit-Renten, Sozialpolitik heißt es dazu „Der Bericht ist damit eine Enttäuschung, notwendige Maßnahmen zur besseren und nachhaltigen Absicherung im Alter und zur Stärkung der Rentenversicherung muss die Politik unabhängig davon treffen“. Diese Ergebnisse können eigentlich nicht verwundern, die Politik hat sein längerem um dieses brisante Thema „einen Bogen gemacht“. Mit fortschreitendem Zeitverlauf nimmt die Brisanz aber massiv zu. Deshalb wiegt es umso schwerer, dass die Politik seit Merkels Kanzlerschaft tunlichst vermeidet, sich mit diesem schwierigen Thema realistisch auseinanderzusetzen.
Die Regierung unter Kanzlerin Merkel hatte 2013/2014 eine weitere große Herausforderung zu bewältigen, den weltweiten Bankencrash. Nur mit dem Einsatz sehr hoher öffentlicher Mittel konnten die beteiligten deutschen Banken vor dem Zusammenbruch bewahrt und somit auch das Geld bzw. die Einlagen vieler Bürger gerettet werden. Dabei unterlief der Regierung jedoch ein schwerwiegender Fehler. Sie versäumte es, für die Hilfeleistungen aus Steuergeldern die finanzielle Mitwirkung der Vorstände zu vereinbaren, d. h. letztlich der Personen, die für das Debakel mit verantwortlich waren. So entrichteten die betreffenden Banken wie immer am Jahresende Bonuszahlungen in Millionenhöhe an ihre Vorstände. Das sind somit Zahlungen aus Mitteln der Steuerzahler, die von der Bundesregierung zur Bankenrettung eingesetzt wurden, mit denen nun aber auch die Boni an Personen bezahlt wurden, die für das Desaster verantwortlich waren. Ein unglaubliches Versäumnis der Regierung, das zu Recht großen Verdruss bei den Steuerzahlern bzw. der Bevölkerung brachte. An dieser Art unausgewogener Wirtschaftshilfe der Merkel-Regierung knüpfte auch die 10 Mrd. € Hilfe zur Lufthansarettung an. Trotz dieser hohen Staatshilfe kam die Lufthansa zunächst ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Ticket-Rückerstattungen nicht nach (WK 10.8.2020). Es bleibt völlig unverständlich, dass bei dieser hohen Staatshilfe nicht entsprechende Regelungen vereinbart wurden, die Bewilligung der Hilfe an die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen durch die Lufthansa zu knüpfen.
Mit fortschreitender Regierungszeit konzentrierte sich Frau Merkel zunehmend auf die EU, zumindest soweit es die Zeitungsberichte wiedergeben. Zum Thema demografischer Wandel, trotz der Wichtigkeit bezüglich der Renten und der zukünftigen Fachkräfteversorgung und vieles mehr, hat sich Frau Merkel kaum geäußert, höchstens dahingehend, dass Zuwanderungen gegen den Fachkräftemangel notwendig seien. Gleichfalls nahm in ihrer Regierungszeit die Bürokratisierung und das Verbots- und Vorschriftenwesen der Verwaltung stark zu, was letztlich auch etwas an das Staatswesen und die Regierung der DDR erinnert. Frau Merkel kündigte zwar mitunter an, dagegen vorgehen zu wollen, aber offensichtlich ohne Nachdruck und Folgen, wie die wachsende Bürokratisierung belegt.
Große Herausforderungen brachte Mitte des letzten Jahrzehnts die Flüchtlingswelle, die zu bewältigen war. Die EU-Mitglieder Italien, später auch Spanien erfuhren zwar seit langem hohe Flüchtlingszuwanderungen, aber die hatten diese Länder selbst zu bewältigen. Nach den EU-Regelungen des Dublin Abkommens ist zunächst das Land für die Flüchtlinge zuständig, in dem diese zuerst einreisten. Die anderen europäischen Nationen, auch Deutschland, hielten sich zurück. 2014 schwoll der Flüchtlingsstrom bekanntlich extrem an und erreichte 2015 einen Höhepunkt. Die Flüchtlinge kamen nun nicht mehr wie bislang vorwiegend über das Mittelmeer, sondern auch auf dem Landweg. Der Großteil der Zuwanderungen wanderte über die Türkei, Griechenland und den Balkan ein. Deren bevorzugtes Ziel war Deutschland, in dem 2015 etwa 870.000 Flüchtlinge zuwanderten (siehe Abschnitt 3.6).
Diese Zahl war schwer zu bewältigen. Von Kanzlerin Merkel kam ihr bekannter, inzwischen auch berüchtigter Ausspruch „Wir schaffen das“. Am Anfang war das aber kaum der Fall. Die zunächst nahezu unkontrollierten Zuwanderungen hatte die Verwaltung weit überlastet, zumal bei den zuvor erfolgten Personalabbau auch etliche Kräfte für Asylverfahren davon betroffen waren. Die Mutmaßung, dass mit den vielen unkontrollierten Zuwanderern auch gezielt Attentäter des IS (sogenannten Islamischen Staates) zuwandern, wies der damalige Innenminister Thomas de Maiziere als abwegig zurück. Der Innenminister hielt es für undenkbar, dass sich diese Personen den Gefahren der Meeresüberfahrt aussetzen und deshalb per Flugzeug einreisen. Für mich ein unglaublicher Unsinn , den der damalige Innenminister verlauten ließ. Es handelte sich schließlich um Personen, die bedingungslos ihr Leben für ein Attentat einsetzen wollten. Die Äußerung von de Maiziere erfolgten aber wohl kaum wegen fehlender Informiertheit und unfassbarer Fehleinschätzung, sondern im bewussten Taktieren, um der aufkommenden Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und ihrer Regierung entgegenzuwirken. Derart unsinnige Aussagen von einem Minister sind aber schlichtweg als unwürdig und unglaublich einzustufen, zumal diese selbst einfältigen , uninformierten Bürgern auffällt und für die Glaubwürdigkeit der Regierung abträglich ist. Die späteren leidvollen Ereignisse belegen eindeutig die Fehleinschätzung der Verlautbarungen des Ministers.
In Abweichung von der Politik der Kanzlerin wollte Bayern als bundesdeutsches Grenzland die jährliche Aufnahme für die Bundesrepublik auf eine Maximalzahl begrenzen. Die Kanzlerin widersprach dem und bemühte sich um eine Quotenlösung zur Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Mitgliedsstaaten, jedoch ohne die Ausrichtung zuvor hinreichend abzustimmen. Das trugen nicht alle EU-Staaten mit. Eine Flüchtlingsaufnahme stieß vor allem in den die osteuropäischen Staaten auf Ablehnung, da sie schon durch ihre junge Mitgliedschaft in der EU hoch gefordert waren. Sie mussten ihr Staatssystem wie auch die Wirtschaftsstruktur darauf umstellen und deren Bevölkerung war von den Reisebeschränkungen geprägt und daher noch längst nicht so weltoffen wie die Westeuropas. Deshalb hatten sie wegen der ganz anderen Kultur und Wertpräferenzen der meisten Flüchtlinge große Bedenken. Der Kanzlerin gelang schließlich ein Abkommen mit der Türkei. Mit hohen Hilfszahlungen und Beitritts- sowie Visabefreiungsoptionen für die Türkei sollte die Zuwanderung kontrolliert in überschaubare Bahnen gelenkt werden. Nach dem Putschversuch in der Türkei wandelte Staatspräsident Erdogan das Land zunehmend in ein undemokratisches Despotentum um, das mit den Werten der EU nicht vereinbar ist. Deshalb kam es nicht zur Visafreiheit für Türken und die Beitrittsverhandlungen mit der EU wurden quasi eingefroren, bei zunehmenden Spannungen mit Präsident Erdogan und seinem Land. Die offene, letztlich türkeifreundliche Zuwanderungspolitik der Kanzlerin und Bundesregierung führten bei dem massiven Demokratieabbau der Türkei in Deutschland zum gesellschaftlichen Verdruss und zur Polarisierung. Das gilt vor allem auch wegen der mäßigen Regierungsaktivitäten und des mäßigen Mitteleinsatzes gegen soziale Probleme in Deutschland, der zur Auseinanderspreizung der Sozialschichten führt.
Angesichts der niedriger Renten und wachsenden Armut vieler Deutscher sahen etliche Bürger die hohen deutschen Aufwendungen für Flüchtlinge und für hohe Zahlungen an die EU zunehmend kritisch. Deshalb stellt sich für viele die Frage, ob nicht ein Teil dieser Mittel besser zur Unterstützung der sozial schwachen eigenen deutschen Bevölkerung einzusetzen wäre. Das wird von der Regierung verneint, mit der Argumentation der menschenrechtlichen Verpflichtungen und der Wichtigkeit der EUBeziehungen für die deutsche Wirtschaft. Viele Unternehmen haben durch die EU evtl. Marktvorteile und erzielen so hohe Gewinne, nur kommt davon bei denen „da unten“ kaum etwas an. Thilo Sarrazin hat als ausgewiesener Finanzfachmann zudem nachgewiesen, dass sich damals mit der Einführung des Euro die Exporte der deutschen Wirtschaft nicht wesentlich erhöhten (Thilo Sarrazin: Europa braucht den Euro nicht, München 2012). Die hohen Beträge, die nun der Staat für die Flüchtlingspolitik plötzlich bereitstellen kann und die bei weitem über den Kosten einer Rentenaufwertung liegen, haben bei vielen Personen zum Umdenken geführt. Wieso sind dafür die Mittel offenbar problemlos da, aber nicht für uns, fragen sich viele aus den unteren Schichten und zunehmend auch aus der unteren Mittelschicht. Die Gesellschaft begann sich in einem Maß zu teilen, wie es seit der Gründung der Bundesrepublik nicht denkbar war (3.4 Soziale Spaltung). Diese soziale Spreizung hat in der Regierungszeit unter Kanzlerin Merkel deutlich zugenommen, ohne dass dieser Entwicklung entgegengewirkt wurde.
Insgesamt hat sich die Bundesrepublik Deutschland unter der Kanzlerschaft Merkel vor allem wirtschaftlich und von der Beschäftigungsquote her gut entwickelt, nur die ungleiche Wohlstandsverteilung wirft schwerwiegende Fragen auf. Zudem wurden selbst in der CDU kritische Stimmen gegen die Kanzlerin laut, da das ursprünglich konservative Profil dieser Partei immer weniger zu erkennen ist. Die CDU hat sich unter der Führung von Merkel zur Partei der Mitte entwickelt und ist damit in vielen Bereichen der nach der Ära Schröder veränderten SPD -Politik nahe. Diese Entwicklung und die gute Bewältigung von Differenzen mit dem Koalitionspartner SPD wurden häufig als besonderes Verdienst und Politikvermögen der Kanzlerin hervorgehoben. Kritische Stimmen führen diesen scheinbaren Verdienst jedoch eher darauf zurück, dass die politische Ausrichtung für die Kanzlerin eher nachrangig ist und ihr Agieren sowie ihre Bestreben in erster Linie aus der Absicherung ihrer Macht und Stellung als Kanzlerin resultieren. Deshalb fallen ihr Kompromisse mit der SPD leicht. Zudem hielt sie sich aus dem Regierungsgeschehen der einzelnen Ministerien immer mehr raus, was ebenfalls das Konfliktpotential mit ihren Koalitionspartnern reduzierte. Zu wichtigen Themen, die die deutsche Bevölkerung sehr bewegen, wie die Wohnungsnot in den Verdichtungsräumen, die soziale Spreizung, Defizite in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge, Folgen des demografischen Wandels oder dass ein hoher Anteil der Bevölkerung die Meinungsfreiheit gefährdet sieht, hörte man kaum Verlautbarungen der Kanzlerin. Ihr Hauptinteresse hatte zunehmend die EU, wo sie aktiv an deren Entwicklung mitwirkte. Aufgrund der hohen Zahlungsverpflichtungen und vielfachen Mittelbeiträge Deutschlands wurde ihre dortige Mitwirkung von etlichen Mitgliedsstaaten, wie vor allem Beneluxländer oder des Baltikums auch sehr geachtet. Nach den Berichten der deutschen Medien man kann fast sagen auch hofiert.
Bei der einseitigen Regierungspolitik, insbesondere der Bereitstellung sehr hoher Mittel zur Bewältigung der Flüchtlingszuwanderungen und den teilweise gravierenden Defiziten für die Versorgungsbelange der deutschen Bevölkerung, fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger von der Politik nicht mehr vertreten. Da diese Entwicklung großenteils in einer Koalition mit der SPD stattfand, sprechen viele auch der sozialdemokratischen Partei die Vertretung sozialer Positionen ab. Der CDU und SPD wird die Migrationspolitik mit den enorm hohen Aufwendungen bei fehlender oder niedriger Unterstützung bedürftiger einheimischer Bürger angekreidet. Das gilt schon wegen der vielen Rentner, Kinder oder alleinerziehende Mütter, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Die Folgen sind ein Heer von Verdrussund Protestwählern, die sich nun oft der AfD zuwenden. Eine gefährliche Entwicklung, die im erheblichen Maße den etablierten Parteien zuzuschreiben und letztlich auch ein Resultat der Kanzlerschaft von Angela Merkel ist. Damit stellt sich wie oben angeführt die Frage: Deutschland wohin? Stimmt unser System noch? Stimmen die Bestandteile des Systems und dessen Elemente noch?