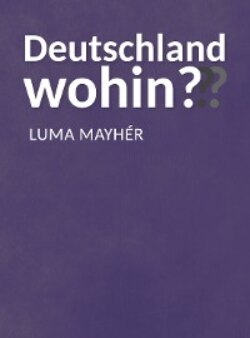Читать книгу Deutschland wohin??? - Luma Mayhér - Страница 9
1.1 Die Zeit nach dem Krieg bis zur Wiedervereinigung
ОглавлениеNach dem von Deutschland entfachten Krieg lag das Land in weiten Teilen in Trümmern und wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Viele Innenstädte waren stärker zerbombt, als es die heutigen Fernsehberichte von 2018–2019 von den Kriegsschauplätzen im Nahen Osten zeigen. Die Not war groß. In Berlin sind 1945–46 manche Bürger wegen der viel zu geringen Nahrungsversorgung verhungert. Der Winter 45/46 hatte Minustemperaturen bis 20 Grad, die bei fehlendem Heizmaterial und oft nur notdürftige verschlossenen Fenstern (Das Glas war durch Druck von Bomben oder Granaten zerborsten) zu ertragen waren. Dennoch, die Bevölkerung machte sich an den Aufbau, häufig war Tatkraft statt jammern angesagt. Die Frauen, die so genannten Trümmerfrauen, räumten die Straßen frei, denn es fehlte an Männern. Die expansive Vereinnahmungspolitik der Sowjets führte alsbald zur deutschen Teilung, Blockade Berlins und Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit der Währungsreform sowie zur Gründung der DDR mit ihrer Ostmark-Währung. In Europa fand eine stringente Teilung statt. Das sowjetisch beherrschte Osteuropa mit kommunistischer Ausrichtung stand dem demokratisch, kapitalistisch orientierten Westeuropa gegenüber. Die damit verbundene strikte Trennung wurde zutreffend als Eiserner Vorhang bezeichnet. Die sowjetische Blockade Westberlins verschärfte die Situation. Durch die Luftbrücke der Alliierten wurde die Stadt am Leben gehalten. Infolge des damals kaum behinderten Verkehrs in Berlin wurde aber durch die vielfachen Familienbeziehungen ebenfalls auch von Ostberlin die Versorgung Westberlins erheblich unterstützt. Zudem war die Ostberliner Versorgungslage während der Blockade deutlich besser als die Westberlins. Trotz aller Leistungen hätte die Luftbrücke für die Versorgung kaum ausgereicht.
Weite Teile der Bevölkerung waren zunächst sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland nach vorne ausgerichtet. Im Westen orientierte sich die Jugend vor allem an den USA. Das galt für die Musik vom Rock ’n’ Roll bis zum Jazz und gleichfalls für Kleidung (Einzug der Jeans) und die lockeren amerikanischen Umgangsformen, die im Gegensatz zur damals noch sehr konservativ ausgerichteten deutschen Gesellschaft standen. Jeans und Freizeithemden begannen Anzug, weißes Hemd und Schlips abzulösen, wenngleich nur sehr langsam und über einen jahrzehntelangen Zeitraum. Für den Westteil galt: nicht in der Vergangenheit rühren, sondern am Aufbau mitwirken. Das Überwechseln ehemaliger Nazis in die neue Entwicklung und ihr Fußfassen in der neuen Politik waren zumindest in Westdeutschland verhältnismäßig problemlos. Ein Beispiel ist der badenwürttembergische Ministerpräsident Filbinger, der als Kriegsrichter selbst noch nach der deutschen Kapitulation, also nach Kriegsende, einen fahnenflüchtigen jungen deutschen Soldaten hinrichten ließ. Zudem fanden etliche Juristen aus der NS-Zeit, einschließlich Richter und Staatsanwälte, wieder ein Unterkommen in der Justiz der neuen Bundesrepublik. Von den höchsten Bundesrichtern hatte die Mehrzahl eine NS-Vergangenheit. Die 50er Jahre waren zugleich die Aufbaujahre Westdeutschlands, in denen die wesentlichen materiellen Kriegsschäden behoben wurden. Auch in der DDR gab es trotz anderslautender Propaganda den Aufstieg von Personen mit NS-Vergangenheit, wenngleich in weitaus geringeren Anteil als in der Bundesrepublik.
Für die sechziger Jahre waren vor allem das wirtschaftliche Wiedererstarken Westdeutschlands prägend sowie die Wiederbewaffnung Deutschlands durch die neue Bundeswehr. Die erfolgte allerdings als fest integrierter Bestandteil im westlichen Militärbündnis Nato. In Ostdeutschland vollzog sich sukzessiv eine Umstellung der Wirtschaft zur Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild. Diese Entwicklung war mit umfassender Enteignung der Wirtschaft und der Landwirtschaft verbunden. Gleichfalls fand auch in Ostdeutschland eine Wiederbewaffnung als NVA (Nationale Volksarmee) statt, die vergleichbar mit der Nato in einem osteuropäischen Militärbündnis, dem Warschauer Pakt, unter Führung der Sowjetunion eingebunden war. Der Berliner Mauerbau 1961 verschärfte die politische Situation und zementierte die Teilung der Stadt. Die Sowjets drohten den Viermächtestatus der Stadt und damit das Anwesenheitsrechte der Westalliierten aufzuheben. Durch den klaren Widerstand der USA, die nach dem Mauerbau symbolisch eine zusätzliche Brigade nach Berlin entsandten, wurde die Drohung gegen Westberlin nicht mehr verfolgt. Zudem stattete der damalige Vizepräsident der USA Johnson Berlin alsbald einen symbolischen Besuch ab. Der erste Besuch des damaligen Bundeskanzler Adenauers nach dem Mauerbau fand erst Wochen später statt.
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre begann in Deutschland endlich die juristische Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Sie war längst überfällig. Etliche andere Staaten haben auch Kriege begonnen, vor allem im Zuge des imperialistischen Kolonialismus im Jahrhundert vor der Naziherrschaft. Aber die furchtbaren Gräueltaten der Nazizeit übertreffen alles andere an Unmenschlichkeit. Deren mit der bürokratischen Akribie und Präzision von Industrieprozessen durchgeführte Mordmaschinerie in den Konzentrationslagern hat eine einmalige Dimension von Grausamkeit und ist die größte Schändung und Schande des deutschen Volkes und Deutschlands. Deshalb waren die Auseinandersetzung und Aufarbeitung dieser Zeit und juristische Ahndung der Täter unverzichtbar für die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu einem demokratischen Rechtsstaat. Von 1963 bis 1965 fand schließlich der Auschwitzprozess statt, mit dem die Schrecken und Unmenschlichkeiten des NS-Regimes selbst für politisch nicht interessierte Bürger/-innen in ihrem furchtbaren Ausmaß deutlich wurden. In Ostdeutschland kam es damals ebenfalls zu Prozessen, so 1966 gleichfalls zu einem Auschwitzprozess. In der Folge gab es in Westdeutschland eine Vielzahl weiterer Prozess. Die angeklagten Personen, oftmals ehemalige Entscheidungsträger und Offiziere, beriefen sich häufig auf Befehlsnotstand (d. h., sie waren für die Taten nicht verantwortlich, sondern die höheren Stellen, die ihnen dazu den Befehl erteilten, den sie in ihrer soldatischen Pflicht auszuführen hatten). Die Prozesse führten daher längst nicht immer zur Verurteilung oder beinhalteten nur verhältnismäßig geringe Strafen. Sie hatten aber zur Folge, dass weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem der Jugend, die verheerenden Grausamkeiten der NS-Zeit verdeutlicht wurden. Häufig war damit die Frage nach der Vergangenheit der eigenen Eltern verbunden. Das stets auf Ordnung und Pflichterfüllung ausgerichtete Leben der Älteren bekam tiefe Risse. Ohne diese Bürokratie und bürokratische Pflichtausrichtung eines Großteils der Elterngeneration wären die schrecklichen Auswüchse der NS-Zeit kaum möglich gewesen, selbst wenn die meisten Bürger nicht unmittelbar an den Gräueltaten beteiligt waren. Der Generationskonflikt war da und eskalierte zunehmend Ende der sechziger Jahre.
Der Vietnam-Krieg verschärfte die Generationskontroverse, da manches für Kriegsverbrechen durch die Amerikaner sprach. Der Besuch des persischen Schahs in Berlin 1967 führte zum „Überkochen“. Vor dem Rathaus schlug eine persische Begleitmannschaft mit Holzlatten auf deutsche Demonstranten ein, weil diese Anti-Schah-Plakate hochhielten. Diese Handlungen erfolgten direkt vor deutschen Polizisten (die zur geordneten Absperrung der Zuschauer dort waren). Die Attacken der persischen Schlägertruppe waren ein eindeutiger Rechtsbruch, der unter den Augen deutscher Polizisten geschah, die aber in keiner Weise dagegen eingriffen. Für diese Untätigkeit hätten gegen die betreffenden Beamten strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet werden müssen. Obwohl das Geschehen klar sichtbar vom Fernsehen übertragen wurde, blieben die Polizei und Justiz passiv und tatenlos. Wenig später kam es vor dem Deutschen Opernhaus dann zu dem besonders traurigen Ereignis. Der Kriminalpolizist Kujath erschoss mit einem Kopfschuss aus dichter Nähe den flüchtenden Studenten Benno Ohnesorg von hinten. Ohnesorg hatte zuvor an keinen Handlungen gegen Polizisten mitgewirkt. In Anbetracht seiner Kleidung, dünne Sommerhose und knappes T-Shirt, war auch eindeutig sichtbar, er ist unbewaffnet. Als der Todesschuss fiel, verfolgten Polizisten in Überzahl flüchtende Studenten und Passanten. Der Todesschuss war nicht zu begreifen, was wohl auch in ersten Reaktionen von anderen beteiligten Polizisten geäußert wurde. Dennoch, der Schütze wurde vor Gericht freigesprochen.
Das etablierte Berlin, einschließlich des Bürgermeisters Alberts, stand hinter dem Schahbesuch und gegen die Studenten. Einzig der damalige Präsident der Berliner Akademie der Künste, der international renommierte Architekt Hans Scharoun, wagte es Position zu beziehen. Scharoun sah die Tötung eines unbewaffneten Demonstranten durch eine gezielte Polizeikugel als ein derart gravierendes Ereignis an, dass er für die folgende Woche sämtliche Veranstaltungen der Berliner Akademie der Künste absagte. Das bekam in der vor allem durch die Bildzeitung und deren Berliner Pendant BZ (Berliner Zeitung) des Springerverlages nahezu beherrschten Öffentlichkeit kaum jemand mit. Die Reaktion der Berliner Polizeiführung war zudem äußerst zweifelhaft. Nach dem Todesschuss wurde offensichtlich gezielt das Gerücht verbreitet, von Seiten der demonstrierenden Studenten sei ein Polizist erschossen worden. Das heizte die Stimmung und Aggressivität der Polizisten noch an. Erst im Verlauf der nächsten vierundzwanzig Stunden sickerte nach und nach der wahre Sachverhalt durch, dass ein Polizist den Studenten Ohnesorg erschoss. Es ist zu vermuten, dass diese Vorgehensweise System hatte, denn die gleiche Gangart praktizierte später die Berliner Polizeiobrigkeit unter dem gleichen damaligen Innensenator Neubauer, als der terrorverdächtige, aber unbewaffnete von Rauch erschossen wurde.
Die Berliner Entwicklung ließ Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik aufkommen und war wohl letztlich auch die Initialzündung für die 68er Bewegung. Hinzu kam der Verdruss über das alte System und die Vorwürfe gegenüber den Älteren angesichts der Gräueltaten des NS-Regimes. Das Vorgehen der USA in Vietnam wurde in die Nähe der NS-Taten gerückt und entsprechend angeprangert. Gleichzeitig wandten sich die 68er gegen die traditionelle Familienstruktur. Die war geprägt durch den Mann, der als „Ernährer“ arbeiten ging und das Sagen hatte, und die Frau, deren vorrangige Aufgabe in der Haushaltsführung und Versorgung der Kinder lag. Kinder galten für Familien als Selbstverständlichkeit. Jeder hatte da seine Pflicht zu erfüllen, was auch für die Arbeitsverhältnisse galt. Die 68er sahen in dieser Grund- und Pflichtstruktur und der damit verbundenen Bürokratie eine der Wurzeln, die letztlich mit die Gräueltaten des NS-Regimes ermöglichten. Statt Unterordnung zur Pflichterfüllung wurde Selbstverwirklichung proklamiert. Die traditionelle Familie mit der eindeutigen Benachteiligung der Frauen wurde abgelehnt, bis hin zur grundsätzlichen Infragestellung. Familie stellte die Presse danach lange Zeit als „Auslaufmodell“ dar. Mit diesen Veränderungen setzten sich die 68er auch massiv für die Gleichberechtigung der Frauen ein, wie ebenfalls für die Ablösung der alten spießig, prüden Moralvorstellungen und für sexuelle Freizügigkeit. Letzteres erhielt durch das Aufkommen der Antibabypille einen zusätzlichen Schub. Der Zeitpunkt dieser Veränderungen im Rollenverständnis junger Frauen sowie die neue sexuelle Freizügigkeit (Wohnungen wurden vorher überwiegend nur an Ehepaare vermietet, Verstöße konnten nach dem sogenannten Kuppelparagraphen geahndet werden) und die unkomplizierten, sicheren Verhütungsmöglichkeiten sind identisch mit dem Zeitpunkt, von dem an in der Bundesrepublik der demografische Wandel einsetzte. Statt Bevölkerungswachstum fiel die Geburtenrate nun deutlich unter die Substanzerhaltung. Seitdem liegen die Geburten bis heute fast anhaltend etwa ein Drittel unter der Sterberate (3.7, 236, 237-238). Die 68er stellten in vielen Bereichen die Vorgaben des alten Systems in Frage, insbesondere auch das Verwaltungshandeln. Bürgerproteste und Aktionen gegen reale oder auch vermeintliche Verwaltungswillkür nahmen zu. Sie hatten damals durchaus Folgen für die Verwaltungsbürokratie und bewirkten einen Rückgang von übermächtigem Verwaltungshandeln und Verwaltungswillkür.
Im Rückblick lässt sich heute resümieren, die 68er Bewegung hat Wichtiges vorangebracht und erreicht, aber eben nicht nur im uneingeschränkten positiven Sinne. Die deutsche Vergangenheit wurde von dieser Bewegung im Wesentlichen auf die Zeit 1933 bis 1945, mit den Naziauswüchsen in den zwanziger Jahren sowie auch mit deutlicher Kritik an die Zeit des letzten deutsche Kaiserreich reduziert. Die umfassenden kulturellen Beiträge und die Bereicherung, wie sie u. a. von Goethe und Schiller ausgingen, fanden nur sehr nachrangige Beachtung. Das Gleiche galt für viele deutsche Leistungen in Kultur und Wissenschaft, die mit der Kriegsführung des NS-Regimes nicht zu tun hatten. Die Wehrmacht und ihre Soldaten wurden fast grundsätzlich als Kriegsverbrecher oder Verbrechenbeteiligte eingestuft. Laut der Berechnung von Experten hatten sich schließlich etwa 20.000 Wehrmachtssoldaten an den Gräueltaten beteiligt. Das galt als Orientierung und nicht, dass demnach von den 3 Millionen deutscher Soldaten 2.980.000 Soldaten den Kriegsdienst leisteten, ohne sich an den Gräueltaten direkt zu beteiligen. Bei dem Großteil der Soldaten handelte es sich zudem nicht um Freiwillige, sondern um Personen, die eingezogen wurden. Dem konnten sie sich kaum entziehen, denn eine Wehrdienstverweigerung wurde damals mit der Todesstrafe geahndet.
Für die Zeit der 68er wird in den Publikationen fast immer ein massiver Generationskonflikt, vor allem zwischen Eltern und ihrem 68er Nachwuchs, unterstellt. Den hat es bestimmt vielfach gegeben, aber längst nicht in dem Ausmaße, wie ihn überwiegend die Presse und Literatur darstellen. Ich hatte selber überhaupt keine Probleme mit meinen nächsten Anverwandten über diese Zeit und Auswüchse zu reden und zu diskutieren, zumal mich meine Mutter von klein auf massiv gegen Hitler und die Taten der NS-Zeit erzog (Mein Vater, der damals wie die meisten Männer per Zwang zur Wehrmacht eingezogen wurde, fiel dem Krieg zum Opfer). Unsere Familie hat noch wenige Tage vor Kriegsende durch die auch dann noch anhaltende Bombardierung von reinen Wohngebieten ihre Wohnung und nahezu ihr gesamte/s Habe und Gut verloren. Ich war nicht der Einzige, in dessen Familien die Hitlerzeit kein Tabu war und über deren Schreckenszeit den Kindern berichtet wurde, wie mir aus den damaligen Gesprächen mit Freunden in Erinnerung ist. Es gab aber auch Gegenbeispiele. Die Mutter eines Freundes stellte an Hitlers Geburtstag ein gerahmtes Bild im Wohnzimmer auf, mit einer Kerze davor. Meine persönlichen Erinnerungen waren mit hoher Wahrscheinlichkeit keine außergewöhnlichen Ausnahmen. Vielmehr ist von sehr unterschiedlicher Betroffenheit und einem vielschichtigen Umgang mit der Vergangenheit in den einzelnen Familien auszugehen. Die Verleugnung der NS-Zeit und Vergangenheit und den daran angelehnten Generationskonflikt mag es in manchen Familien gegeben haben, aber in vielen auch nicht.
Die 68er bejubelten und glorifizierten auch den Massenmörder Mao. Gegen die Annexion Tibets gab es von ihnen genauso wenig Proteste wie von den damals etablierten Parteien. Umso stärker und intensiver waren die Proteste und Aktionen gegen die USA und den Vietnamkrieg. Die Stimmung hatte sich völlig gegen die USA gedreht. Als 1961 die USA nach der Grenzschließung und dem beginnenden Mauerbau zur symbolischen Unterstützung Westberlins über die Interzonenautobahn eine zusätzliche Brigade nach Berlin entsandten, warteten viele West-Berliner an der Autobahnkreuz Wannsee, um die Ankunft der Soldaten zu bejubeln. Ich war auch dabei. Bevor die Soldaten in amerikanische Kasernen fuhren, vollzogen die Fahrzeuge mit ihren Soldaten eine Rundfahrt über etliche Hauptstraßen Berlins. Sie wurden von der am Straßenrand wartenden begeisterten Bevölkerung beklatscht und mit Blumen beworfen. Nun, sieben Jahre später war das ganz anders. Beklatscht wurden sie nirgends mehr, aber auf etlichen Demonstrationen geschmäht. Als geborener Berliner, der die gesamte Zeit miterlebte, hatte ich ein sehr ungutes Gefühl, denn ohne die dezidierte Haltung der USA wäre wohl damals die Geschichte für Westberlin anders verlaufen. Fragwürdig war für mich auch manches Agieren der 68er Bewegung an den Universitäten, zumindest an der Technischen Universität in Westberlin. Studenten der 68er hatten zutreffend Mängel und Schwächen der Universität und deren Verwaltung aufgedeckt und vernünftige Konzepte zur Abänderung vorgeschlagen. Die wurden dann als Resolution zur Abstimmung gestellt, allerdings oft mit einem Zusatz. In dem wurde die amerikanische Politik, vor allem die Vietnam-Politik angeprangert. Studenten, die nun für die Resolution zu Verbesserungen an der Universität stimmten, gaben damit zwangsläufig auch ihre Stimme für die entsprechende antiamerikanische Resolution ab. Die antiamerikanische Haltung mag aber auch durch die Ermordung von Luther King und Kennedy verstärkt worden sein, wenngleich sich später herausstelle, dass Kennedy ein wesentlicher Befürworter für den amerikanischen Vietnameinsatz war.
Die 68erBewegung hat dann mit der Zeit an Schub und Zuspruch verloren, was zugleich mit der Radikalisierung einer kleineren Anhängerschaft einherging. In der Folgezeit bröckelte angesichts der Morde durch die RAF (Rote Armee Fraktion) die Sympathie. Auf Seiten der Ordnungskräfte fand damals die fragwürdige Erschießung des unbewaffneten von Rauch vor einem Laden in der Eisenacher Straße statt. Ich wohnte zu dieser Zeit in der Nähe und lief kurz danach zufällig die Kleistraße entlang. Erstaunt über die Polizeiabsperrung an der einmündenden Eisenacher Straße in die Kleiststraße fragte ich höflich die Polizisten nach dem Absperrungsgrund. Die Polizisten antworteten aufgeregt, die Baader-Meinhof-Terroristen haben einen Kollegen, also einen Polizisten, erschossen. Das stellte sich alsbald als völlig falsch heraus. Von Rauch war unbewaffnet und stand vor einem Laden, wo ihn die Polizei bereits fixiert hatte, und wurde dann aus unerklärlichen Gründen, vermutlich versehentlich, in deren Aufregung erschossen. Rauch war völlig unbewaffnet, denn eine Waffe wurde trotz intensiver Suche im gesamten Tatortareal nirgends gefunden. Hier sehe ich unter dem damaligen Berliner Innensenator Neubauer wieder das gleiche Verhalten der falsch gestreuten Polizeigerüchte wie bei dem oben angeführten Todesschuss auf Benno Ohnesorg. Mein Zweifel an der deutschen Rechtsstaatlichkeit bekam Nahrung.
Die unter vielen Studenten zunächst durchaus vorhandenen Sympathie für die Aktionen der Baader-Meinhof-Gruppe schwächten sich mit deren zunehmender Radikalisierung und Taten der RAF (Rote Armee Fraktion), insbesondere durch deren Nachfolgeorganisation unter Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt, massiv ab. Nach der Schleyerentführung mit der Exekution der sieben begleitenden Polizisten gab es in der Studentenschaft für die RAF kaum noch Sympathie. Damit waren auch die linken Ideen zunehmend diskreditiert und diese Terrorgruppe verlor die Unterstützung als wesentliche Voraussetzungen für das Leben im Untergrund. Ihr Ende war absehbar.
Heute ziehe ich das Resümee, die 68er waren wichtig für den Aufbruch, insbesondere zur Emanzipation der Frauen, zur Reduzierung falscher Pflichtgefühle und Veränderung der Persönlichkeitshaltungen, für sexuelle Freiheit und Selbstbestimmtheit, Reflexion und öffentliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und zur Reduzierung von Bürokratie und Verwaltungswillkür. Sie haben zudem die breite Diskussion für viele Themen ermöglicht und geschaffen, die vorher eher ein Tabu waren. Umgekehrt wurden aber abweichende, gar konservative Meinungen und Gesellschaftsbilder, auch wenn diese nicht aus der rechten Ecke kamen, massiv abgelehnt, bis hin zu Beleidigungen der betreffenden Personen. Die Meinungserweiterung wurde ermöglicht, aber nicht, wenn sie anders war als die der 68er. Dann wurde die Meinungsfreiheit von dieser jungen Aufbruch-Generation nicht selten massiv missachtet.
Das Vorgehen der 68er war, wie bei den angeführten Resolutionen an der TU, außerdem nicht immer aufrichtig. Das einseitige Bejubeln von Massenmördern wie Mao, genauso wie das Ausbleiben jeglicher Kritik oder gar Proteste gegen die chinesische Annexion Tibets, ließen großen Zweifel aufkommen. Genauso kann die Quasi-Reduzierung der deutschen Geschichte auf 1890 bis 1945, oder noch gravierender auf die Zeit 1933–45 nicht überzeugen. Mit den Attentaten und Morden der Baader-Meinhof-Gruppe, RAF sowie insbesondere deren Nachfolgergruppierungen hat die 68er Generation jedoch nichts zu tun. Die anfänglichen Sympathien für diese Terroristen beschränkten sich zudem auf einen kleinen Teil dieser Generation. Sie hatte sich dann mit der Radikalisierung dieser Gruppen, wie dargelegt, sehr schnell aufgelöst. Ein großer Verdienst der 68er lag damals vor allem in den Erfolgen gegen übermächtiges, man kann fast sagen willkürliches Agieren des Staates und der Verwaltung. Davon ist leider nicht mehr viel verblieben, zumal die Digitalisierung heute der Verwaltung weit größere Möglichkeiten bietet. Die Gewaltenteilung des Staates in die drei Elemente Legislative, Exekutive und Judikative wird inzwischen z. T. von einer „Verwaltungslative“ überlagert, auf die die Judikative nur noch begrenzten Einfluss hat. Bürokratismus breitet sich immer mehr aus, wie auch der damals erkämpfte offene Sexualität zunehmend der Trend zur Rückkehr zum prüden Spießertum entgegen wirkt.
Für die 70er Jahre waren die Ablösung der bis dahin führenden CDU/CSU, durch die Kanzlerschaft von Willi Brandt und dessen Koalitionspartners FDP das prägende Ereignis. In dieser Zeit wurden umfassende soziale Verbesserungen durchgesetzt. Weite Teile der Bevölkerung hatten ein ausgeglichenes Auskommen. Es ging eindeutig weiter aufwärts. Der von der CDU/CSU in den 60er Jahren angeschobene Eigenheimbau boomte ebenfalls weiter. Das galt auch für mittlere Einkommen. Das wesentliche politische Geschehen bestimmte sich durch die Ost-Entspannungspolitik unter Brandt und die Berlin-Vereinbarungen, die den Reiseverkehr zwischen Westdeutschland und Berlin erheblich erleichterten. Konflikte bahnten sich im Umweltbereich an, insbesondere durch die kontroversen Positionen zur Energieversorgung auf Kernkraftbasis. Nach der weitgehenden Ausschaltung der Baader-Meinhof-Gruppe wurde die Öffentlichkeit jedoch durch die zunehmend radikaleren Aktionen und Morde der RAF-Nachfolgegruppierungen verunsichert, die in der Landshut-Entführung und der Ermordung von Hans Schleyer 1977 den leidigen Höhepunkt erfuhren. Dennoch, insgesamt war es ein Jahrzehnt der Aufwärtsentwicklung.
Zu dieser Zeit fand der Ausbau der Daseinsvorsorge im erheblichen Maße statt, der wegen den bereits Ende der 60er und später in den 70er Jahren zeitweilig auftretenden Schwächen im Wirtschaftswachstum zu nicht unwesentlichen Teil über Kreditaufnahmen finanziert wurde. Das entsprach damals durchaus der aktuellen, fortschrittlichen Finanztheorie. In Anbetracht steigender Preise und des zunehmenden Wirtschaftswachstums ging man davon aus, dass heute über Kredite finanzierte Ausgaben günstiger seien als ansparen. Denn der wahrscheinliche Preisanstieg in der Zeit des Ansparens ließ sich damit vermeiden und die Kreditzinsen über den so ersparten Preisanstieg finanzieren bzw. ausgleichen. Seit dieser Zeit hat sich dieses staatliche Ausgabenverhalten, quasi die Ausgaben über den staatlichen Einnahmen „auf Pump“, als Dauererscheinung und zu einer immer größeren Staatsverschuldung geführt. Diese Entwicklung galt nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland sondern genauso für die meisten westeuropäischen Länder, insbesondere für die Mittelmeerstaaten, und führte dort auch zur Abwertung nationaler Währungen. Diese Entwicklung wurde in der Bundesrepublik erst durch das 2009 erlassene Haushaltsgrundsätzegesetz sowie durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU bis zum Eintreffen der Coronapandemie beendet.
In den 80er Jahre setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Westdeutschland ging es immer besser. Die Integration und Verflechtungen der EU-Staaten verdichteten sich. Das Konfliktpotential zu Umweltfragen nahm mit der Atompolitik der Regierung zu, insbesondere zu den Fragen, wo ein Endlager für abgebrannte Atombrennstäbe einzurichten sei und was dort mit den Brennstäben erfolgen solle. Anfang der 80er Jahre fand deshalb unter dem damaligen hessischen SPD-Ministerpräsidenten Holger Börner durch die landeseigene Hessische Landesentwicklungs- und Treuhandgesellschaft (HLT), in enger Zusammenarbeit mit der DWK (Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH. Hannover), in Nordhessen eine intensive Standortsuche statt. Damit sollte eine Lösung der Entsorgungsfrage für abgrannte Kernbrennsoffe geschaffen werden, offensichtlich um die Energiepolitik des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt zu stützen. Diese streng vertraulichen und von der Öffentlichkeit bis heute gut abgeschirmten Aktivitäten fanden ein sehr schnelles Ende, als Kanzler Helmut Schmidt durch Helmut Kohl abgelöst wurde. Damit verlor sich sehr zügig die Unterstützungsbereitschaft der SPD-geführten hessischen Landesregierung. Die war nun bemüht, dieses konfliktreiche Thema schnell wieder loszuwerden. Dazu ist es dann sehr bald gekommen, und die Standortfrage fiel an die von CDU bzw. CSU regierten Bundesländer zurück.
Die damalige Entwicklung verunsichert, weil bei diesen wichtigen Fragen die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschaltet wurde und wohl bis heute kaum etwas über die damalige Entwicklung weiß. So berichteten damals DWK-Mitarbeiter intern, wie sie die notwendigen Vermessungsarbeiten auf den relevanten nordhessischen Flächen durchführten. Da mit dem Widerstand der Eigentümer der Fläche, also den Bauern, zu rechnen war, führte der Kreis dort unter einem anderen Vorwand Vermessungsarbeiten durch. Die Bauern konnten dem Kreis das kaum verwehren, denn der Landkreis war berechtigt bei Bedarf wie überall im Kreisgebiet Vermessungen vorzunehmen. Zeitgleich war dort jedoch eine andere Gruppe von Vermessern tätig, die im Auftrag der DWK die für die Standorteingrenzung erforderlichen Vermessungen durchführte. Letztlich war das eine illegale Tätigkeit auf den Flächen der Landwirte, die diese aber durch die legalen Parallelvermessungen nicht erkennen konnten. Die Aktivitäten zur kerntechnischen Standortsuche fanden z. T. bei internen Kontakten und Absprachen mit nordhessischen Bürgermeistern statt, die sich von einer derartigen Anlage Steuereinnahmen und Arbeitsplätze in ihrem strukturschwachen Nordhessen erhofften. Als diese Kontakte dann irgendwie durchsickerten und halböffentlichwurden, stritten die betreffenden Kommunalpolitiker diese Vorgänge rundweg ab. Wesentlicher ist jedoch der Vorgang der Vermessungsarbeiten. Denn dieses Geschehen zeigt, dass ggf. staatliche Instanzen, d. h. auch von den zuständigen Verwaltungsspitzen bis zu verantwortlichen Politikern, die gesetzliche Legitimation verlassen, wenn sie es für ihre Ziele als wichtig erachten.
Im Gegensatz zur positiven westdeutschen Aufwärtsentwicklung befand sich die DDR zunehmend im Niedergang. Die DDR näherte sich dem Staatsbankrott. Das wirtschaftliche Verhältnis zur UDSSR drohte sich umzukehren. Seit Kriegsende, hatte die UDSSR nach den extrem hohen Kriegsreparationszahlungen nahezu über den gesamten Zeitraum der Existenz der DDR konstant Ressourcen aus Ostdeutschland abgezogen. Im Verhältnis zur Größe Ostdeutschlands und dessen Wirtschaftsleistung ein weitaus größerer Aderlass als die Zahlungen Westdeutschlands zur Wiedergutmachung der Nazi-Vergehen, an Israel, andere westeuropäische Staaten und ehemalige Kriegsgegner. Nun drohte sich das Verhältnis Sowjetunion zu Ostdeutschland umzukehren. Aus der maroden DDR war kaum noch etwas rauszuholen. Stattdessen wären massive Hilfen durch die UDSSR erforderlich, um dieses Staatssystem zu halten. Diese Situation hatte Gorbatschow als Wirtschaftsfachmann eindeutig erkannt und sich daher wohl aus der DDR zurückgezogen. Bei dem Aufbegehren der Ostdeutschen fand deshalb kein Eingreifen des russischen Militärs statt wie am 17. Juni 1953 in Berlin, 1956 in Ungarn oder 1968 in der Tschechoslowakei. Gorbatschow war Wirtschaftler und wollte die UDSSR und den Kommunismus im positiven Sinne durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen weiterentwickeln. Die Ereignisse haben sich alsbald überschlagen. Im Oktober 1989 fiel die Mauer. Der freie Verkehr der Bevölkerung zwischen Ostund Westdeutschland war erreicht. Damals war nicht absehbar, dass damit alsbald die Wiedervereinigung erfolgt und das Großreich der UDSSR zerfällt und auseinanderbricht.
Das Jahr 1990 war gezeichnet von der deutschen Annäherung. Nach ersten Verlautbarungen zur Bildung einer deutschen Föderation und der Ablösung von Erich Honecker kamen in Ostdeutschland die Forderung nach freien Wahlen und sehr bald nach der Wiedervereinigung Deutschlands auf. Die westeuropäischen Verbündeten, insbesondere Großbritannien unter M. Thatcher, sprachen sich deutlich dagegen aus (frühestens in 20 Jahren), aber der amerikanische Präsident Bush war dafür. Bundeskanzler Helmut Kohl, der lange belächelt und durch Witze im Volksmund verballhornt wurde, erkannte die einmalige Chance. Er hat mit seinem Außenminister Genscher die richtige Politik geleistet, um diese vermutlich einmalige Chance zu nutzen. Sein damaliger Oppositionsgegenspieler, der SPD-Chef Lafontaine, konnte mit dieser Entwicklung anscheinend wenig anfangen. Seine Äußerungen beschränkten sich vor allem auf den Verweis auf die hohen Kosten einer Wiedervereinigung.