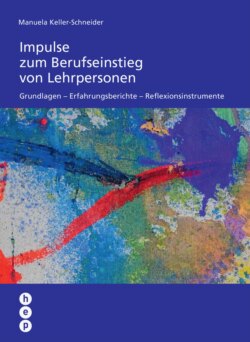Читать книгу Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen (E-Book) - Manuela Keller-Schneider - Страница 10
1.4.2 Ergebnisse zur Wahrnehmung von Berufsanforderungen durch Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase
ОглавлениеÜber eine faktoranalytische Modellbildung in mehreren Schritten13 wurde ein Modell entwickelt, das die latente Struktur der Wahrnehmung von beruflichen Anforderungen aus der Sicht von Berufseinsteigenden14 beschreibt (vgl. Abb. 5). Es zeigen sich vier Anforderungsbereiche, die in Teilbereiche gegliedert die Herausforderungen der Berufseinstiegsphase charakterisieren.
Berufseinsteigende sind gefordert, sich in die Rolle einer Berufsperson (1) einzufinden und eine berufliche Identität aufzubauen. Das Konzept der adressatenbezogenen Vermittlung (2) verlangt eine Fokussierung auf die Schülerinnen und Schüler, um vertieftes und individuell angepasstes Lernen zu ermöglichen und damit eine auf eine weitere Perspektive ausgelegte Unterrichtseffektivität zu erreichen. Die Anforderungen der anerkennenden Klassenführung (3) richten sich auf das Gestalten einer Lern- und Arbeitskultur. Eine auf die Anerkennung der Adressaten (Schüler/-innen und Klasse als Ganzes) bezogene Klassenführung ist erforderlich, um eine tragfähige Arbeitskultur aufzubauen und sicherzustellen. Im Hinblick auf die Positionierung in der Institution sind Berufseinsteigende gefordert, einen Mitgliedschaftsentwurf zu finden, der ihnen eine mitgestaltende Kooperation in und mit der Schule (4) ermöglicht.
Die auf den Unterricht und die Tätigkeit des Unterrichtens bezogenen Anforderungen mit den Bereichen der Planung und Durchführung von Unterricht stehen im Zentrum dieser vier Anforderungsbereiche, die es als Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten gilt. Diese lassen sich gemäss der Wahrnehmung von Berufseinsteigenden keiner der vier Entwicklungsaufgaben unterordnen. In den Zusammenhängen mittlerer Stärke wird deutlich, dass diese in Verbindung mit den grundlegenden beruflichen Entwicklungsaufgaben wahrgenommen werden (Keller-Schneider et al. 2017, 2018). Als Ort der Entwicklung widerspiegeln sich in den Anforderungen des Unterrichtens die vier Entwicklungsaufgaben und bewirken damit eine Auseinandersetzung mit allen vier (Keller-Schneider 2010a). In den unterrichtsbezogenen Handlungen erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung, der adressatenbezogenen Vermittlung, der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in der Institution.
Abbildung 5: Modell der vier beruflichen Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen mit Anforderungen zur Planung und Durchführung von Unterricht als Ort der Entwicklung (Keller-Schneider 2010a, S. 214)
Die folgenden Ausführungen beschreiben, wie Berufseinsteigende diese beruflichen Anforderungen wahrnehmen, inwiefern sie diese beanspruchen, wie es ihnen aus subjektiver Sicht gelingt, diese zu bewältigen und wie wichtig ihnen diese sind. Die Ergebnisse werden in Durchschnittswerten angegeben und in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt; individuelle Erlebensweisen können davon abweichen.
1) Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase lassen sich durch die Auseinandersetzung mit den beruflichen Anforderungen beanspruchen; spezifische Anforderungen heben sich als Herausforderungen der Berufseinstiegsphase von anderen ab.
Die Werte liegen mehrheitlich im zustimmenden Skalenbereich (vgl. Abb. 6, Keller-Schneider 2010a). Die durchschnittlich wahrgenommene Herausforderung liegt beim Wert 4. Die Werte streuen breit (in der Bandbreite von zwei Skalenwerten, die Standardabweichungen liegen um 1), was auf individuelle Unterschiede in der Intensität der Auseinandersetzung mit diesen beruflichen Anforderungen verweist. Es zeigen sich spezifische Herausforderungen, die in der Berufseinstiegsphase als besonders beanspruchend wahrgenommen werden und Kräfte binden.
Abbildung 6: Herausforderungen in der Berufseinstiegsphase – Wahrnehmung der Intensität der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen (Keller-Schneider 2010a, S. 203)
Die höchsten Werte liegen in der Anforderung der individuellen Passung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler, gefolgt vom Aufbau einer Klassenkultur, der Pflege von Elternkontakten, dem Umgang mit den eigenen Ansprüchen sowie der Beurteilung und Förderung von Lernen und Leistung. In diesen Bereichen stellen sich strukturbedingt Herausforderungen, die im begrenzten Verantwortungsraum der Praktika nur teilweise erfahren werden konnten. In der zeitlich auf kurze Phasen begrenzten Unterrichtstätigkeit in bereits bestehenden Klassen und unter Leitung von Ausbildner/-innen sind diese Anforderungen in der gesamten Komplexität nicht erfahrbar (Keller-Schneider 2010a, S. 203). Die tiefsten Werte liegen in den als wenig herausfordernd wahrgenommenen Anforderungen der Kooperation in der Institution Schule.
2) Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase gelingt es, die beruflichen Anforderungen zu bewältigen.
Gemäss den subjektiven Einschätzungen gelingt es Berufseinsteigenden, die breite Palette der beruflichen Anforderungen zu bewältigen (vgl. Abb. 7) (Keller-Schneider 2017a). Die Werte liegen im zustimmenden Bereich (in der oberen Skalenhälfte) und streuen eher gering (in der Bandbreite eines Wertepunktes, Standardabweichung um 0.5).
Die höchsten Werte zeigen sich in den Anforderungen, Rollenklarheit aufzubauen, die direkte Klassenführung auszuüben sowie sich in Kollegien zu positionieren. Die tiefsten Werte finden sich in den Anforderungen, berufspolitische Aspekte zu erschliessen, die individuelle Passung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler zu erreichen, deren Lernen und Leistung zu beurteilen und zu fördern sowie ihre Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Möglichkeiten zu erschliessen sowie die eigenen Ressourcen zu nutzen und sich zu schützen, folgen nach.
Berufseinsteigende treten insgesamt mit angemessenen Kompetenzen in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit ein und erleben sich im Durchschnitt als kompetent. In den Bereichen der adressatenbezogenen Vermittlung und im Umgang mit eigenen Ressourcen erleben sie sich weniger kompetent als in den Bereichen der Klassenführung und der Rollenklarheit. Im Verlaufe der Ausbildung15 zeigt sich ein zunehmender Anstieg des Kompetenzerlebens, insbesondere in der Planung von Unterricht und der Klassenführung (Keller-Schneider 2016a).
Aus diesen Befunden geht hervor, dass Berufseinsteigende nicht generell unterstützungsbedürftig sind (vgl. dazu auch Keller-Schneider 2015b, S. 6). Aufgrund der sprunghaft ansteigenden Komplexität der Berufsanforderungen und der Neuorganisation des Denkens, die aus der Auseinandersetzung mit den situativ bedingten Anforderungen resultiert, sind Berufseinsteigende gefordert, sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen und diese zu meistern, die sich in der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit in einer neuen Komplexität zeigen. Berufsphasenspezifische Angebote einer institutionellen Berufseinführung können dazu beitragen, Berufseinsteigende nach subjektivem Ermessen in der weiteren Professionalisierung zu begleiten.
3) Die Bewältigung der beruflichen Anforderungen ist den Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase sehr wichtig.
Die Einschätzung der Wichtigkeit der Berufsanforderungen (Keller-Schneider 2010a) trägt stress- und motivationstheoretisch betrachtet dazu bei, inwiefern eine Anforderung als Herausforderung wahrgenommen wird. Die Werte liegen in allen Bereichen sehr hoch (vgl. Abb. 7) und zeigen geringe Streuungen (um einen Skalenpunkt, Standardabweichung um 0.5). Die höchsten Werte zeigen sich in den Anforderungen der direkten Klassenführung, im Aufbau einer Klassenkultur, in der individuellen Passung des Unterrichts und darin, die eigenen Ressourcen zu nutzen und zu schützen sowie einen guten Umgang mit den eigenen Ansprüchen zu finden. Berufseinsteigenden ist es sehr wichtig, die beruflichen Anforderungen zu bewältigen, trotz geringer Erfahrung. Sie sind bereit, sich zu engagieren. Tiefe Werte zeigen sich in den Anforderungen der Kooperation in der Institution Schule mit den Teilbereichen der eigenen Positionierung im Kollegium und der Zusammenarbeit mit der Schulleitung sowie bei der Nutzung schulinterner und berufspolitischer Möglichkeiten.
Abbildung 7: Befunde aus der Studie EABest. Einschätzung der Relevanz, des Kompetenzerlebens und der Beanspruchung in der Bearbeitung von Berufsanforderungen
4) Spezifische Anforderungen stellen Entwicklungs- oder Ressourcenbereiche der Berufseinstiegsphase dar.
Werden die Einschätzungen der Relevanz einer Bewältigung, der Kompetenz in der Bewältigung und der Beanspruchung durch die Bewältigung zueinander in Beziehung gesetzt, so zeigen sich unterschiedliche Konstellationen (Abb. 7), die sich als Entwicklungs- bzw. Ressourcenbereiche interpretieren lassen (Keller-Schneider 2015b).
Entwicklungsbereiche: Als sehr relevant eingeschätzt bei eher geringem Kompetenzerleben zeigen sich hohe Werte in der Beanspruchung in den Bereichen, in denen sich ein Entwicklungsbedarf abzeichnet. Eine individuelle Passung des Unterrichts an die Lern- und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler zu erreichen, stellt den deutlichsten Entwicklungsbereich in der Berufseinstiegsphase dar. Weitere Entwicklungsbereiche zeigen sich im Umgang mit den eigenen Ansprüchen, in der indirekten Klassenführung (Klassenkultur lenken) und in der Aufgabe, Elternkontakte aufzubauen und zu pflegen, wobei in diesen Bereichen das Kompetenzerleben höher eingeschätzt wird als in den Anforderungen der individuellen Passung.
Ressourcenbereiche: In den Anforderungen der direkten Klassenführung zeigt sich eine Konstellation der Wahrnehmung, welche diesen Bereich als Ressourcenbereich zeigt: Es gelingt den Berufseinsteigenden gut, diese als wichtig wahrgenommene Aufgabe zu bewältigen bei relativ geringer Beanspruchung (Keller-Schneider 2015b, Keller-Schneider & Hericks 2017). In der Bewältigung der Anforderungen der Kooperation in der Institution Schule erleben sich Berufseinsteigende ebenfalls als angemessen kompetent bei eher geringer Beanspruchung; die Einschätzungen der Wichtigkeit liegen jedoch tiefer, was die Bedeutung dieses Ressourcenbereichs schmälert (Keller-Schneider 2010a).
5) Zwischen den Einschätzungen der Beanspruchung, dem Gelingen und der Wichtigkeit bestehen unterschiedlich starke Zusammenhänge.
Kompetenz und Beanspruchung bestehen weitgehend unabhängig voneinander; es zeigen sich nur schwache Zusammenhänge. Sich intensiv mit einer Herausforderung auseinanderzusetzen und sich als kompetent zu erleben schliessen sich nicht aus. Durchschnittlich nehmen sich Berufseinsteigende als kompetent und beansprucht wahr, wobei diese Wahrnehmungen sich gegenseitig nur gering beeinflussen. Auch in längsschnittlicher Entwicklung betrachtet bestehen die Wahrnehmungsperspektiven des Kompetenzerlebens und der Beanspruchung weitgehend unabhängig voneinander (Keller-Schneider 2012a).
Die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit von beruflichen Anforderungen (Relevanz) bestimmt die Intensität der Auseinandersetzung (Beanspruchung) und das Kompetenzerleben mit; es zeigen sich bedeutsame Zusammenhänge mittlerer Stärke. Je wichtiger eine Anforderung eingeschätzt wird, desto höher ist das Kompetenzerleben und desto höher ist die Intensität der Auseinandersetzung (Keller-Schneider 2010a). Die subjektive Wichtigkeit einer Anforderung bestimmt als Referenzrahmen die Ausrichtung der Bearbeitung und damit auch die Weiterentwicklung mit.
6) Fachlehrpersonen werden durch Anforderungen der Klassenführung stärker beansprucht als Klassenlehrpersonen.
Als Fachlehrperson in einer Klasse den Rahmen der Zusammenarbeit immer wieder neu zu definieren und zu sichern, stellt eine stärkere Herausforderung dar und führt zu höheren Beanspruchungen. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Klasse während einer längeren Zeitspanne kann auf Ritualisierungen und Gewissheiten aufbauen; damit stellen die Anforderungen der Klassenführung für Klassenlehrpersonen eine geringere Herausforderung dar als für Fachlehrpersonen (Keller-Schneider 2010a).
7) In der Bewältigung fachspezifischer Anforderungen zeigen sich unterschiedliche Konstellationen von Beanspruchung und Gelingen.
Werden fachspezifische Anforderungen für die einzelnen Fächer gesondert untersucht, so zeigen sich schulfachspezifische Konstellationen zwischen dem Kompetenzerleben und der Beanspruchung durch die Bewältigung fachspezifischer Anforderungen. Insbesondere im Fach Mensch und Umwelt wird die Beanspruchung durch fachspezifische Anforderungen als hoch eingeschätzt, die Werte des Kompetenzerlebens liegen dabei tiefer. In den Fächern Französisch und Sport sowie Mathematik und Bildnerisches Gestalten zeigt sich hingegen bei einem relativ hohen Kompetenzerleben eine geringere Beanspruchung. Die Bewältigung fachspezifischer Anforderungen werden in diesen Fächern als weniger herausfordernd wahrgenommen (Keller-Schneider 2011c).
8) Individuelle Merkmale bestimmen die Wahrnehmung und Bearbeitung von Anforderungen mit.
Die Intensität der Auseinandersetzung mit Berufsanforderungen zeigt interindividuelle Unterschiede und wird durch Persönlichkeitsmerkmale und Coping-Stile mitbestimmt. Werden Typen wahrgenommener Beanspruchung durch die Bearbeitung von beruflichen Anforderungen identifiziert, ergeben sich Profile, die sich nicht nur im Ausmass der Beanspruchung unterscheiden, sondern auch in unterschiedlichen Ausprägungen von Persönlichkeitsmerkmalen und Coping-Stilen. Individuelle Dispositionen bestimmen die Wahrnehmung von Anforderungen mit (Keller-Schneider 2010a).
9) Den Entwicklungsbedarf selber zu erkennen ist für die weitere Professionalisierung bedeutend.
Die Selbsteinschätzung übernimmt eine wichtige Steuerfunktion. Die subjektive Erkenntnis eines Entwicklungsbedarfs ist erforderlich, damit eine Weiterentwicklung erfolgen kann. Diese richtet sich nach dem selber gesetzten Referenzrahmen, der von Überzeugungen geprägt wird (Keller-Schneider 2012b). Individuelle Überzeugungen können dazu führen, dass eine spezifische Anforderung bei nicht befriedigendem Gelingen als nicht erfüllbar wahrgenommen wird, wodurch sich die Person vor einer herausfordernden und risikoreichen Bearbeitung schützt, wie die folgende Aussage illustriert:
«Ja, ich finde auch, dass es eher laut ist und dass die Schüler und Schülerinnen nicht so konzentriert arbeiten. Ich denke aber, dass wir von Zweitklässlern kein ruhigeres Arbeiten erwarten können, das geht einfach nicht.» (Elena Iten, in Keller-Schneider 2012b, S. 39)
10) Entwicklungen verlaufen vielfältig.
In der Entwicklung des Kompetenzerlebens in der Bewältigung der beruflichen Anforderungen zeigen sich anforderungsspezifische Entwicklungsverläufe (Keller-Schneider 2009b), d.h., die Entwicklungen spezifischer Kompetenzen verlaufen asynchron und nicht linear; es zeigen sich geringe Parallelitäten zwischen den Entwicklungen unterschiedlicher Anforderungen.
Untersuchungen zur Identifikation von Prädiktoren des Kompetenzerlebens und der Beanspruchung ergeben, dass ressourcenstärkende Merkmale (Selbstwirksamkeit, ausgeprägtes aufgabenorientiertes und geringes emotionsorientiertes Coping sowie soziale Unterstützung) das Kompetenzerleben unterstützen und ressourcenschwächende (Belastung, emotionsorientiertes Coping) das Beanspruchungserleben steigern. Kompetenz und Beanspruchung erweisen sich auch in längsschnittlichen Entwicklungen als weitgehend unabhängig voneinander (Keller-Schneider 2012a).