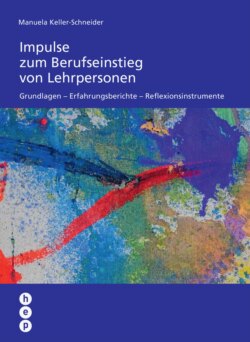Читать книгу Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen (E-Book) - Manuela Keller-Schneider - Страница 6
1.1 Anforderungen der Berufseinstiegsphase
ОглавлениеDer Berufseinstieg stellt Anforderungen, die in der Ausbildung nur begrenzt vorweggenommen werden können (Keller-Schneider 2010a, 2010b, 2011b, 2018a, Keller-Schneider & Hericks 2014). Als Entwicklungsaufgaben angenommen, müssen diese von allen neu in den Beruf einsteigenden Lehrpersonen eigenständig bearbeitet und bewältigt werden. Soziale Ressourcen wie der Rat von Kolleginnen und Kollegen mit längerer Berufserfahrung oder Gespräche im privaten Bereich können zur Bewältigung genutzt werden; es gibt jedoch keine allgemein gültigen Lösungen.
«Ich habe mich ja so gefreut, endlich selber entscheiden und auch mal etwas wagen zu dürfen. Doch manchmal wünsche ich mir, dass mir jemand sagen würde, wie ich es machen soll. Das wäre sehr hilfreich, dann bin ich auch entlastet, wenn es schiefgeht. Doch jetzt muss ich alles selber entscheiden und die Verantwortung dafür übernehmen, ohne dass mir jemand sagt, ich hätte das gut gemacht.» (Tanja Turnher)
Trotz erworbenem und erprobtem Wissen und reflektierten Erfahrungen zeigen sich in der selber zu verantwortenden Berufstätigkeit neue Herausforderungen, insbesondere auch in der Gleichzeitigkeit der vielfältigen Aufgaben.
«Dass ich tausend Dinge beachten muss und dabei noch ruhig das Ganze überblicken soll, strapaziert mich arg. Wie kann ich gleichzeitig den Unterricht führen und dabei den Lernprozess jedes Kindes im Auge behalten? Wie kann ich die Arbeitsatmosphäre sicherstellen, wenn noch keine Klassengemeinschaft besteht? Wie soll ich den Eltern klar und professionell gegenübertreten, wenn ich noch unsicher bin, wie ich als Lehrerin sein will? Wie kann ich im Team mitdenken und mitgestalten, wenn ich noch nicht weiss, was denn alles zur Arbeit innerhalb einer Schule gehört und welche ungeschriebenen Gesetze ich selbstverständlich beachten muss?» (Barbara Binder, nach sieben Wochen Berufstätigkeit, Ausschnitt aus einem Supervisionsgespräch, in Keller-Schneider 2010a)
«Weiter kommt dazu, dass ich nicht weiss, wann etwas gut genug ist – wie geht es wohl anderen?» (Barbara Binder)
Die Herausforderungen umfassen folgende Bereiche:
» Einen eigenen Massstab für Qualitätsansprüche entwickeln: Berufseinsteigende sind gefordert, ein eigenes Urteil zu bilden und eigene Qualitätsansprüche zu erfüllen; Rückmeldungen und Hinweise durch Ausbildner/-innen entfallen.
» Peer-Gruppe fehlt: Der alltägliche Austausch mit Peers, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, fehlt. Kontakte zu Peers müssen aktiv organisiert werden, doch oft fehlt die Zeit dazu.
» Wechsel in eine neue Lebensphase: Der Eintritt in die Erwerbtätigkeit ermöglicht finanzielle Eigenständigkeit; Primärverantwortung kann und muss übernommen werden. Viele ziehen von der Herkunftsfamilie weg und gründen einen eigenen Haushalt, was wiederum neue Aufgaben mit sich bringt und den Aufbau neuer sozialer Bezüge erfordert.
» Mit den eigenen Kräften umgehen: Den eigenen Vorstellungen und Idealen entsprechend zu handeln und dabei mit den eigenen Ressourcen so umzugehen, dass die Berufsaufgaben insgesamt zu meistern sind, und dabei nicht von Kräften zu kommen, stellt eine grosse Herausforderung dar. Während den Praktika war es eher möglich, sich für eine bestimmte Zeit zu verausgaben und über die eigenen Kräfte hinaus zu arbeiten, da das Ende dieser anstrengenden Zeit vorhersehbar war. Der Berufseinstieg aber stellt den Anfang eines nicht begrenzten Zeitraums dar. Auch unterrichtsfreie Zeit, d.h. Schulferien, gilt es einzuteilen und zwischen unterrichtsfreier Arbeitszeit und eigenen Ferien zu differenzieren, um sich auf die danach folgende Zeit vorzubereiten, sich Erholung zu verschaffen und gestärkt in die nächste Phase einzusteigen.
» Gestaltung von Unterricht in grösseren Zeithorizonten: Die zeitliche Reichweite von Unterricht wird deutlich erweitert. Lektionen und Lektionsreihen sollen nicht nur in sich stimmig und ausgewogen sein, in den Ablauf eines Schultages eingepasst werden und zusammen mit anderen Lektionen eine den Lernenden und der Sache angemessene und lernförderliche Rhythmisierung ergeben; sie müssen auch in den Ablauf eines Quartals bzw. eines Schuljahres eingepasst werden. Diesen zeitlichen Gesamtrahmen einzuschätzen ist für neu in den Beruf einsteigende Lehrpersonen eine erstmals zu bewältigende Aufgabe.
» Aufbau einer Klassengemeinschaft: Eine lernförderliche Arbeitskultur erleichtert das Lernen und stärkt die Lernfreude – doch eine solche Kultur muss zuerst geschaffen werden. Praktika finden in bereits bestehenden Klassen statt. Im Berufseinstieg ist die Lehrperson gefordert, einen neuen Rahmen zu entwickeln und diesen auf die eigenen Vorstellungen und Erwartungen auszurichten. Was wie und wozu funktionieren könnte und sollte, muss bei laufendem Betrieb fortwährend präzisiert und an neue Gegebenheiten angepasst werden.
» Verantwortung für die schulische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler übernehmen: Die Lehrperson ist gefordert, sich nicht nur auf das eigene Handeln zu konzentrieren, sondern den Blick auf die einzelnen Kinder zu erweitern und sich in die unterschiedlichen Perspektiven hineinzuversetzen.
» Ein professionelles Gegenüber für die Eltern sein: Die Lehrperson nimmt ab dem ersten Tag ihrer eigenverantwortlichen Berufstätigkeit eine neue Rolle ein und übernimmt dabei einen neuen Zuständigkeitsbereich. Den Eltern fehlt der Blick auf ihr Kind als Schülerin oder Schüler. Die Lehrperson ist gefordert, das Kind im schulischen Kontext professionell wahrzunehmen und dies in Gesprächen darzulegen. Gleichzeitig ist sie gefordert, Beiträge und Anliegen der Eltern ernst zu nehmen, auch wenn sie erst über wenig Berufserfahrung verfügt.
» Mitglied eines Lehrerkollegiums werden: Als Kollegin oder Kollege Teil eines Kollegiums zu sein, bedeutet, Mitglied dieses Teams zu werden, einen eigenen Part einzunehmen und das eigene Potenzial einzubringen. Neu in den Beruf und in den Arbeitsort einsteigende Lehrpersonen müssen sich in das Leben einer Schule und in die Abläufe und ungeschriebenen Gesetze einfinden.
» Innovationspotenzial einbringen: Oft wird vergessen, dass Berufseinsteigende neue Impulse mitbringen, auf die sie stolz sein können und die für die Schule von Bedeutung sind – denn niemand ist so aktuell ausgebildet wie sie. Damit stellen Berufseinsteigende ein Innovationspotenzial für eine Schule dar, das es anzuerkennen und zu nutzen gilt.
Damit wird deutlich, dass der Einstieg in diese eigenverantwortliche Berufsarbeit keinen reibungslosen Übergang darstellen kann. Sich auf diese Ungewissheiten einlassen und weiterlernen ist erforderlich.