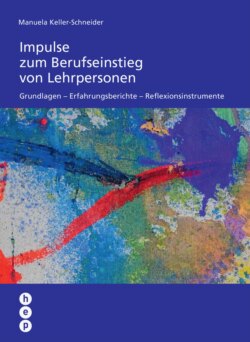Читать книгу Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen (E-Book) - Manuela Keller-Schneider - Страница 12
1.4.4 Institutionelle Angebote der Berufseinführung
ОглавлениеDem Einstieg in den Beruf kommt eine besondere Rolle zu. Der Berufseinstieg erfolgt als einmaliger Schritt und führt in die Berufseinstiegsphase, die von berufsphasenspezifischen Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet ist (Keller-Schneider & Hericks 2014). Als Gelenkstelle zwischen Aus- und Weiterbildung (Keller-Schneider & Hericks 2017) sind institutionelle Angebote erforderlich, um die Berufseinsteigenden in dieser sensiblen Phase zu begleiten (Schneuwly 1996). Den berufsphasenspezifischen Weiterbildungsbedürfnissen wird mit spezifischen Angeboten an den Pädagogischen Hochschulen der Schweiz entsprochen. Diese Angebote stellen den ersten Teil der Weiterbildung dar, die ein Berufsleben lang andauert und sich später interessengeleitet ausdifferenziert (vgl. Abb. 8).
Abbildung 8: Berufseinstieg als Gelenkstelle zwischen Ausund Weiterbildung (nach Lauper et al. 2017)
Den Berufseinsteigenden in der Schweiz werden in den ersten ein bis zwei Berufsjahren berufsphasenspezifisch ausgerichtete Begleitangebote unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese umfassen (je nach Schwerpunktesetzungen der Pädagogischen Hochschulen) Kurse zu berufsphasenspezifischen Themen, Supervision (einzeln oder in Gruppen), kollegiale Begleitung durch eine erfahrene Lehrperson, die am selben Schulort und in derselben Stufe unterrichtet, sowie Sommerkurse beim Einstieg in die Berufstätigkeit oder eine mehrwöchige Weiterbildung am Ende des zweiten Berufsjahres.
18) Die Angebote der Berufseinführung werden sehr geschätzt.
Berufseinsteigende schätzen die Angebote der Berufseinführung sehr, auch wenn sie sich in der Bewältigung der Berufsanforderungen als kompetent wahrnehmen. Sie erachten diese Angebote als wichtig und nutzen sie in unterschiedlichen Intensitäten (Keller-Schneider 2009b).
Zu Beginn der Berufseinstiegsphase wird die schulinterne kollegiale Begleitperson häufiger aufgesucht als gegen Ende des ersten Berufsjahres; die Bedeutung der externen Supervisionsgruppe dagegen steigt im Verlaufe der Berufseinstiegszeit an (Keller-Schneider 2009b). Ob und wie häufig sich Berufseinsteigende an interne oder externe Begleitpersonen wenden, wird von Merkmalen der Passung der Einstellungen und von der Sympathie beeinflusst. Wenn die grundlegende ‹Chemie› nicht stimmt, werden Begleitangebote wenig genutzt. Daraus wird ersichtlich, dass individuell wählbare und gestaltbare Begleitangebote mit je spezifischen Zielsetzungen sinnvolle Möglichkeiten bieten; flächendeckende und verpflichtende Programme entsprechen den individuell geprägten Bedürfnissen weniger.
19) Angebote der Berufseinführung werden spezifisch genutzt.
Nach Unterstützungswünschen je Anforderungsbereich befragt, zeigen sich in den einzelnen Anforderungsbereichen relativ geringe prozentuale Anteile von Berufseinsteigenden, die Unterstützung wünschen (Keller-Schneider 2015b). Die Unterstützungsbedürfnisse variieren. Auch wenn das Kompetenzerleben beim Berufseinstieg absinkt und als geringer wahrgenommen wird als am Ende der Ausbildung (Keller-Schneider 2009b, 2017a), trifft die Folgerung nicht zu, Berufseinsteigende seien grundsätzlich unterstützungsbedürftig. Auf spezifische Anforderungen ausgerichtete und frei wählbare Begleitangebote können jedoch Impulse geben, um die berufsphasenspezifischen Herausforderungen zu bewältigen.
Die Angebote der schulinternen kollegialen Begleitung und der externen Supervision werden zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen beruflichen Anforderungen genutzt. Auswertungen von Begleitjournalen zeigen, dass für handlungsnahe Anliegen die lokalen Begleitpersonen und für komplexe Anforderungen eine externe Supervisionsgruppe bevorzugt wird (Keller-Schneider 2009a). Steht beim einen die niederschwellige Erreichbarkeit und der kollegiale Austausch von alltäglichen Anforderungen im Fokus, so werden in den Supervisionen die Herausforderungen thematisiert, die eine vertiefte Auseinandersetzung erfordern. Dabei werden der geschützte Rahmen, der Austausch in einer Gruppe von Berufseinsteigenden und ein Aussenblick sehr geschätzt (Keller-Schneider 2009b).
Insgesamt belegen die Befunde, dass in der Bewältigung der berufsphasenspezifisch identifizierten Anforderungen mehrere Komponenten mitwirken, die sich individuell verschieden zeigen. Nicht die Anforderungen per se sind von Bedeutung, sondern deren Wahrnehmung und der Umgang mit diesen ist für das subjektive Erleben zentral.
20) Erfahrung kann nicht weitergegeben werden.
Aus der berufsphasenspezifischen latenten Struktur der Bündelung von Anforderungen geht hervor, dass sich berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen in der Struktur und Logik ihres Denkens unterscheiden. Erfahrung kann demzufolge nicht einfach weitergegeben bzw. unreflektiert übernommen werden. Lösungen müssen aufgrund eigener Sichtweisen und Ziele erarbeitet und erprobt werden (Keller-Schneider 2009a). Erfahrungen Dritter können hilfreiche Impulse geben, falls sie den eigenen Sichtweisen und Werten entsprechen; selber Erfahrungen machen kann damit aber nicht ersetzt werden. Tipps können kurzfristig Entlastung bieten und damit in Stresssituationen hilfreich sein, sie tragen jedoch nur begrenzt zur weiteren Professionalisierung bei. In der Begleitung von Berufseinsteigenden sind Expert/-innen gefordert, sich auf die Sichtweise der Berufseinsteigenden einzulassen, um aus deren Perspektive an Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten.