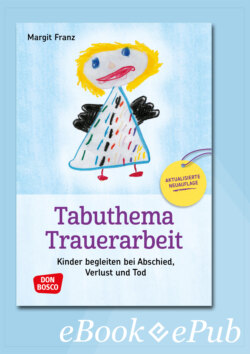Читать книгу Tabuthema Trauerarbeit - eBook - Margit Franz - Страница 10
Professionelle Erfahrungen: Wir als Team und Kollegium
ОглавлениеIst-Analyse: Was haben wir bereits erarbeitet?
Abschied, Verlust, Sterben, Tod, Trauer – welche Anlaufstelle, Ansprech- und Netzwerkpartner kennen wir? Welche Adressen, Flyer, Materialien, Informationsbroschüren, Fachbücher, Fachzeitschriften, Kinderliteratur, Medien, Spiele … haben wir zu diesen Themen? Wo sehen wir Lücken und Handlungsbedarf? – Machen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen einen Check-up und gestalten Sie einen Informationstisch.
Hierfür eignen sich die folgenden Impulsfragen:
Was ist in unserer Konzeption und Schulordnung über den Umgang mit Abschieden, Verlusten, Sterben und Tod zu lesen? Was erfahren Eltern über den Umgang mit einem Todesfall im Nahbereich der Einrichtung und Schule? Welche Aussagen zur Sicherung des Kindeswohls trifft dazu unser Kinderschutzkonzept? (Karte 22)
Welche Spielmaterialien und Bücher haben wir zum Thema Abschied, Verlust, Sterben und Tod? Wissen wir, welche Vorstellungen Kinder vom Tod haben und was trauernde Kinder brauchen? Was bieten wir Kindern an, damit sie sich spielend, lesend und im Rahmen des Unterrichts mit Themen wie Abschied, Verlust, Sterben und Tod beschäftigen und auseinandersetzen können? (Karte 32)
Einen Notfallkoffer packen
Der Vater eines Kindes ist tödlich verunglückt. Die Großeltern eines Kindes haben sich suizidiert. Ein Geschwisterkind oder ein Kind ist gestorben. Eine Kollegin oder ein Kollege wurde bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Notfallkoffer, den Sie in Krisenfällen zur Hand nehmen: Was finden Sie in diesem Koffer vor? Für diese Übung legen Sie bitte einen leeren Koffer auf den Tisch. Für den Austausch eignen sich folgende Impulsfragen:
Unser Krisen-Notfallkoffer – wie sieht er aus und was ist darin zu finden? Haben wir im Team und Kollegium einen Notfallplan erarbeitet, der uns nach Bekanntwerden eines Todesfalls in der Akutsituation hilfreich ist? Wie vertraut sind wir mit den Sofortmaßnahmen bei einem Todes- und Trauerfall in unserer Einrichtung und Schule? (Karte 23)
Wie und in welcher Weise informieren wir Kinder und Eltern über einen Todesfall, der sich ereignet hat? Wie wird der nächste Tag in der Einrichtung und Schule gestaltet? Wo findet das traurige Geschehnis angemessen Raum und Zeit? (Karte 24)
Wie gehen wir im Team und im Kollegium mit unserer Betroffenheit um? Wie gehen wir mit den Verlust- und Trauerreaktionen von Kindern und Eltern um? In welcher Weise begleiten wir Kinder? Was bieten wir Eltern an? (Karte 25)
In einem weiteren Schritt überlegen Sie, wie Sie zu den Inhalten Ihres Notfallkoffers gelangen:
Was brauchen wir?
Wen können wir fragen und in unser Team und Kollegium einladen?
Wer kümmert sich um was?
Wie ist unser Zeitmanagement zur Vervollständigung unseres Notfallkoffers?
Bild vom Kind
Kinder sind kompetent und haben die natürliche Kompetenz zur Trauer, die es zu stärken gilt. Je intensiver ein Kind trauern kann und darf, in seiner Trauer begleitet und unterstützt wird, umso besser kann es einen Verlust verarbeiten. Das wesentliche Entwicklungspotenzial steckt im Kind selbst, denn es ist Akteur seiner Entwicklung. Kinder gestalten ihre Entwicklung von Anfang an aktiv mit, somit auch ihren Trauerprozess. Kinder können ihre Bedürfnisse über Gestik, Mimik, Körpersprache und ihr Verhalten ausdrücken. Größere Kinder bringen ihre Bedürfnisse sprachlich zum Ausdruck. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo und ist eine einzigartige Persönlichkeit, folglich auch eine individuelle Trauerpersönlichkeit. Das Kind bestimmt Maß und Tempo und seinen Weg der Trauer.
Welche Grundaussagen zum Bild vom Kind finden sich in den länderspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Rahmenplänen? Nehmen Sie sich Zeit, um in dem Plan (Orientierungsrahmen) ihres Bundeslandes nachzulesen. Fragen, die zu Gesprächen einladen, können sein:
Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung und kompetent, auch in ihrer Trauer – was bedeutet dies für den Erwachsenen?
Kinder teilen sich auf vielfältige Weise mit ihren Trauergefühlen mit – was heißt das für den Erwachsenen?
Kinder sind Trauerpersönlichkeiten – was müssen Erwachsene beachten?
Welche Vorstellungen haben Kinder vom Tod? Wie trauern und was brauchen trauernde Kinder?
Weitere Impulsfragen können zudem sein:
Wie gehen wir mit den Ängsten und Fragen der Kinder um? Wie sprechen wir mit Kindern über den Tod und die Trauer? In welcher Weise beteiligen wir Kinder? Wie begleiten wir ein trauerndes Kind in unserer Einrichtung und Schule? Welche Vorbilder für Kinder sind wir im Team und Kollegium für den Umgang mit Krisen, Abschieden und Trauer? (Karte 33)
Die Rechte von trauernden Kindern
Trauernde Kinder haben das Recht …
… informiert und beteiligt zu werden.
… auf Vertrauen gebende Erwachsene.
… auf ermutigende Erwachsene.
… auf achtsame Fürsorge.
… auf aufrichtige Anteilnahme.
… ehrliche Antworten zu bekommen.
… auf einen gut gelebten Alltag.
… in ihrer Weise und in ihrem Tempo zu trauern.
Welche Rechte haben Kinder? Welche Rechte haben trauernde Kinder? Welche Rechte geben wir trauernden Kindern? Wie setzen wir uns dafür ein, dass trauernde Kinder in unserer Einrichtung und Schule zu ihrem Recht auf Trauer kommen? – Um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, eignen sich die Themenkarten „Trauerarbeit mit Kindern“. Auf jeder der 30 Fotokarten ist ein sprechendes Foto zu sehen und ein Satz formuliert, der ein bestimmtes Recht trauernder Kinder zum Ausdruck bringt. Auf der Rückseite führt ein kurzer Impulstext dies weiter aus. Ein zum Thema passendes Zitat sowie Reflexionsfragen laden zum Nachdenken und Austausch ein.
Praxistipp: Fotokarten Trauerarbeit mit Kindern
Hilfreich sowohl für die Auseinandersetzung im Team als auch für die Zusammenarbeit mit Eltern sind die Fotokarten Trauerarbeit mit Kindern. Themenkarten für Teamarbeit, Elternabende und Seminare ( München 2019, EAN 426017951 560 6). Die Themenkarten laden durch Fotos, Zitate, Texte und Reflexionsfragen zum Dialog ein, um mit Kolleg*innen und Eltern gemeinsam darüber nachzudenken, was trauernde Kinder brauchen und wie sie einfühlsam begleitet werden können.
So kann mit den Karten gearbeitet werden: Die Karten liegen mit den Fotos oben auf. Die teilnehmenden Personen werden gebeten, sich die Fotos in Ruhe anzusehen. Folgende Fragen können hierfür gestellt werden:
Welches Foto/Thema spricht mich an oder berührt mich besonders? Weshalb? Welche Gedanken und Gefühle löst dieses Foto/Thema in mir aus? Warum?
In einem weiteren Schritt können anhand der Fotokarten einige Themen ausgewählt werden, die in Kleingruppen besprochen werden, je nach Bedarf mit unterschiedlichen Fragestellungen, zum Beispiel:
Welche Erfahrungen habe ich zu diesem Thema?
Welche Impulse nehme ich aus unserem Austausch mit?
Worin fühle ich mich bestärkt und bestätigt?
Welche weiteren Fragen haben sich ergeben?
Wo sehen wir weiteren Gesprächs- und Handlungsbedarf?
Wo benötigen wir Unterstützung durch außenstehende Personen?
Der Tod in den Medien
Comics, Videos, Computerspiele – die geheimen virtuellen Miterzieher haben zunehmend mehr Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und ihre Vorstellungen über den Tod. Sehr interessant ist, eine kleine Auswahl an Filmszenen zusammenzustellen und sich diese mit dem Ziel anzusehen, die Verhaltensweisen von Kindern besser verstehen zu lernen. Impulsfragen:
Welche Bilder vom Sterben und dem Tod werden Kindern vermittelt?
Wie wirken sich diese Bilder auf die Todeskonzepte der Kinder aus?
Welche Einstellungen über den Tod und die Trauer gewinnen Kinder?
Wie leben Kinder durch Medien gewonnene Eindrücke aus?
Redewendungen kritisch betrachten
In Todesanzeigen und Trauerkarten sind oftmals Redewendungen wie „sanft entschlafen“, „von uns gegangen“, „aus dem Leben geschieden“, „heimgekehrt“, „das Zeitliche gesegnet“ zu lesen, geradezu so, als ob es die Wörter „tot“ und „sterben“ gar nicht geben würde. Umgangssprachliche Formulierungen wie „ins Gras beißen“, „den Löffel abgeben“, „die Radieschen von unten betrachten“, „einen Holzfrack anziehen“, „in die ewigen Jagdgründe gehen“ sind zu hören. Gemeinsam sammeln wir solche Redewendungen und Formulierungen. Wir werden schnell erkennen, wie missverständlich und verwirrend sie für Kinder sein können. (siehe Was wir Kindern nicht sagen sollten – ungeeignete Redewendungen, Seite 136)
Reflexions- und Impulsfragen:
Worauf achten wir besonders, wenn wir mit Kindern sprechen?
Welche Redewendungen nutzen wir und auf welche verzichten wir ganz bewusst?
Rituale, die wir mit Kindern pflegen
Trauernde Kinder brauchen Rituale, die ihnen helfen, mit einer Verlustsituation umzugehen und ihre Gefühle auszudrücken. Im Team und Kollegium sollte darüber nachgedacht werden, mit welchen Ritualen die Kinder in einer Krisensituation unterstützt und wie sie beteiligt werden können. Die Überlegungen für diese Einheit können mit einem kleinen Ritual eingeleitet werden. Hierfür wird eine Kerze (Windlicht) von Hand zu Hand und mit den Worten „Ich wünsche dir ein Licht der …“ (Freude, Geborgenheit, Achtsamkeit, Freundschaft, Gelassenheit …) weitergereicht. Eine dezente Hintergrundmusik rundet das Ritual ab. (siehe Mit Kindern Rituale entwickeln und leben, Seite 120)
Für die nachfolgende Reflexion und den Austausch eignet sich folgende Impulsfrage:
Erinnerungstisch, Kondolenzbuch, Traueranzeige, Gesprächskreis, Trauercafé … Welche Rituale, Gestaltungs- und Begegnungsformen des Abschieds pflegen wir in unserer Einrichtung und Schule mit Kindern, Team und Kollegium? Sterben, Tod und Trauerrituale in anderen Kulturen und Religionen – Wie fundiert schätzen wir unser Fachwissen hierzu ein? Wo sind wir uns sicher und wie können wir Lücken schließen? (Karte 27)
Zusammenarbeit mit Eltern
Die Zusammenarbeit mit Eltern bildet die Grundlage einer guten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. In Krisenzeiten wird deutlich, wie vertrauensvoll und tragfähig die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften einer Kita oder zwischen Eltern und Lehrkräften einer Schule ist. Situationen, in denen Kinder, Familien, Fach- und Lehrkräfte mit dem Tod konfrontiert werden, können vielfältig und zudem tragisch sein. Ein Kind, das eine Kita oder Schule besucht, ist von einem Todesfall in seiner Familie, seinem familiären Umfeld oder Freundeskreis betroffen, wenn beispielsweise Großeltern, Geschwister, Eltern oder ein guter Freund des Kindes sterben. Kinder, die eine Kita oder Schule besuchen, sind von einem Todesfall in ihrer Kindergruppe oder Klassengemeinschaft oder in ihrer Kita und Schule betroffen. Wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher, eine Lehrerin oder ein Lehrer, ein Kindergartenkind, eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerad, eine Schülerin oder ein Schüler gestorben ist, trauert die Einrichtung oder Schule.
Wissenswert: Todesfall im erweiterten Umfeld von Kita und Schule
Ein Todesfall im erweiterten Umfeld einer Einrichtung bzw. Schule ist gegeben, wenn ein Kind oder Schüler (auch Fach- und Lehrkräfte, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte, Hausmeister) in seinem persönlichen familiären Umfeld von einem Todesfall betroffen ist. Das Kind bringt sein Erlebnis und seine damit verbundenen Trauergefühle mit in die Kita oder Schule und verhält sich möglichweise anders als sonst.
Wissenswert: Todesfall im Nahbereich von Kita und Schule
Ein Todesfall im Nahbereich von Kita und Schule bedeutet, dass ein Kind, eine Fach- oder Lehrkraft, eine Hauswirtschafts- oder Reinigungskraft, ein Hausmeister … gestorben ist. Die Institutionen sind somit unmittelbar von einem Trauerfall betroffen.
Literaturtipp – Leitfaden für Kitas mit Notfallplänen, Checklisten und Hilfen zur Trauerbegleitung
Wenn ein Kind verunglückt, eine Erzieherin gestorben ist oder ein Elternteil Suizid begeht, befindet sich die ganze Kita im Ausnahmezustand. Das Buch … plötzlich mit dem Tod konfrontiert. Leitfaden für Kitas mit Notfallplänen, Checklisten und Hilfen zur Trauerbegleitung (München 22019, ISBN 978-3-7698-2055-3) von Margret Färber und Martina Lutz hilft Erzieher*innen, trotz der eigenen emotionalen Betroffenheit professionell und angemessen zu handeln.
Das Buch widmet sich mit übersichtlichen Checklisten, Verhaltensvorschlägen und Formulierungshilfen den Sofortmaßnahmen in einer Akutsituation. Es unterstützt Erzieher*innen mit Hintergrundinformationen und Praxisanregungen bei der Begleitung der Kinder und der Eltern in der Trauersituation. Zudem entfalten die Autorinnen eine präventive Pädagogik des abschiedlichen Lebens an konkreten Beispielen des Umgangs mit Übergängen und Verlusterfahrungen.
Todesfall im erweiterten Umfeld oder im Nahbereich
Ein Todesfall im erweiterten Umfeld oder im Nahbereich von Kita und Schule (siehe Wissenswert, Seite 30) erzeugt Betroffenheit. Die Situation verunsichert und belastet Kinder und Erwachsene in unterschiedlicher Weise. Sie erfordert ein professionelles Vorgehen und verantwortliches Handeln der Kita- und Schulleitung sowie der Fach- und Lehrkräfte in Kitas und Schulen. Im Rahmen mehrerer Sitzungen und Konferenzen sollte miteinander erarbeitet werden, wie mit unmittelbar betroffenen Eltern und Kindern gearbeitet werden kann. Eine weitere wichtige Überlegung ist, wie die Elternschaft über die mit einem Todesfall verbundenen Geschehnisse informiert wird. Hierfür eignen sich die folgenden Impulsfragen:
Erkundige ich mich in Erstgesprächen nach den Verlusterlebnissen eines neuen Kindes? Wie vertrauensvoll arbeite ich mit Eltern zusammen, so dass ich über bedeutsame Familienereignisse informiert werde? (Karte 18)
Wie kompetent fühle ich mich in dem Thema Sterben, Trauer, Tod, um Eltern zu beraten? Traue ich mir zu, einen Elternabend zu diesem Thema anzubieten? Was benötige ich hierfür? (Karte 19)
Wie gestalten wir den Besuch bei der Trauerfamilie? Wer nimmt Kontakt zu den betroffenen, trauernden Eltern und Kindern auf, um ein persönliches Beileid auszusprechen? Welche Unterstützung bieten wir als Einrichtung und Schule an? Welche Unterstützungs- und Beratungssysteme können wir Eltern und Familien empfehlen? (Karte 26)
„Ich möchte nicht, dass mein Kind von der Situation erfährt!“ „Soll sich mein Kind vom Verstorbenen verabschieden und an der Beerdigung teilnehmen?“ – Wie beraten wir (trauernde) Eltern in praktischen Fragen? Was können wir ihnen anbieten? Welche Literatur zur Trauer von Kindern haben wir in unserer hauseigenen Bibliothek, die wir Eltern empfehlen und ausleihen? (Karte 30)
Das erste Weihnachten ohne den Verstorbenen, der erste Geburtstag und Todestag einer verstorbenen Person – wie achtsam gehen wir im Team und Kollegium mit solchen bedeutsamen und sensiblen Tagen um? In welcher Weise denken wir an die trauernden Eltern und Kinder? Wie drücken wir unser Mitgefühl aus? (Karte 31) (siehe Die häufigsten Fragen von Eltern, Seite 132)
Gesprächspartner einladen
Ein Gedankenaustausch mit Menschen, die in anderen Kontexten professionell und ehrenamtlich arbeiten, ist bereichernd. Im Gespräch mit Hospizhelfer*innen, Trauerbegleiter*innen und Bestatter*innen erfahren wir etwas über die Begleitung von trauernden und sterbenden Menschen und die Bestattung. Ein Gespräch mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer gibt Aufschluss über Bestattungsrituale, Sterbekultur und Glaubensfragen. (Siehe Kooperation mit Unterstützungssystemen – Adressen und Anlaufstellen, Seite 145)
Hierfür eignen sich folgende Impulsfragen:
Auf welche Ressourcen und Kompetenzen können wir in unserem Team und Kollegium vertrauen, um mit Krisen- und Ausnahmesituationen kompetent und professionell umzugehen? An wen können wir uns mit unseren Fragen wenden, um Unterstützung und Begleitung bitten? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen und für unsere Psychohygiene sorgen? (Karte 28)
Welche Kooperationspartner sind für uns wichtig, wenn sich ein Todesfall im Nahbereich der Einrichtung und Schule ereignet? Mit wem arbeiten wir zusammen, wenn ein Kind aus unserer Gemeinschaft gestorben ist? In welcher Weise erfüllen wir unseren Auftrag zum Kinderschutz, wenn wir wahrnehmen, dass Kinder mit ihrer Trauer überfordert sind? (Karte 29)
Besuche von Institutionen
Ein Spaziergang über den Friedhof, die Besichtigung eines Hospizes, beispielsweise am Tag der offenen Türe, der Besuch eines Vortrags der Hospizgruppe, eines Bestattungsinstituts oder des Museums für Sepulkralkultur in Kassel … Dank der Hospizbewegung bieten sich zunehmend mehr Möglichkeiten, um über Sterben, Tod, Trauer mehr zu erfahren und sich kundig zu machen. Bei solchen Besuchen ergeben sich interessante Gespräche und Ideen, wie beispielsweise eine Kooperation mit dem örtlichen Hospizdienst aussehen könnte. So manche Hospizgruppe bietet Trauergruppen für Kinder an. In einem Bestattungsinstitut erzählt die Bestatterin, wie sie darauf bedacht ist, die Kinder bereits vor der Beerdigung gut einzubeziehen, indem sie anregt, dass die Kinder den Sarg bemalen dürfen. Solche Angebote und Informationen können Eltern empfohlen werden (siehe Kooperation mit Unterstützungssystemen – Adressen und Anlaufstellen, Seite 145).