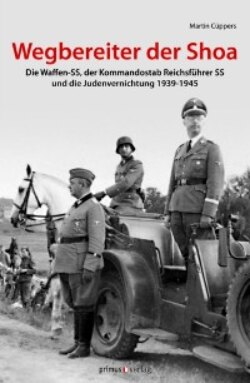Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 11
2. Gesellschaftlicher Ausschluß und antisemitischer Terror
ОглавлениеNach ihrem Eintreffen aus Berlin wurden die SS-Reiter im besetzten Polen als Sicherungstruppe eingesetzt. Dabei ergab sich mitunter auch eine Zusammenarbeit mit den im gleichen Raum operierenden Einsatzgruppen.19 Ab November 1939 erhielten die Kommandeure der Totenkopfstandarten ihre Befehle für größere Einsätze direkt vom Höheren SS- und Polizeiführer in Krakau. Zudem waren die SS- und Polizeiführer der jeweiligen Distrikte seit Juni 1940 berechtigt, die Einheiten der Waffen-SS in Ausnahmefällen direkt anzufordern. Oft zog aber auch einfach das eingespielte Miteinander der verschiedenen Besatzungsinstitutionen vor Ort eine Verwendung der Truppen nach sich.20 Maßnahmen gegen die polnischen Juden fanden faktisch mit Einsatzbeginn breiten Niederschlag in der Berichterstattung der Reiterschwadronen. Mitunter läßt sich den Berichten entnehmen, daß Einheiten der Waffen-SS noch zur Zeit der Militärverwaltung für kleinere jüdische Gemeinden den ersten Kontakt mit der deutschen Besatzungsmacht darstellten und eine ganz entscheidende Rolle dabei spielten, in den entsprechenden Regionen überhaupt erst ein antisemitisches Klima zu prägen. Eine Schwadron der SS-Reitstaffel 1 meldete bei der Besetzung eines Ortes, es bestände der Eindruck, „daß dort vornehmlich jüdische Hetzer noch am Werk sein dürften“.21 Zehn Tage später konnte der Kommandeur der SS-Kavallerie berichten, Juden und Polen hätten mittlerweile erkannt, „daß sie sich zu fügen haben“.22
Obersturmführer Dunsch, Kommandeur des 2. Zuges der 4. Reiterschwadron, berichtete zeitgleich über die Besetzung eines Ortes: „Die Juden grüßten bei unserem Einzug in Leczyca ganz schlecht. Das wurde ihnen schnell beigebracht. Wenn sich einer von uns sehen läßt, verschwinden sie allerschnellstens in ihre Schlupfwinkel, da wir immer welche zum Arbeiten wegfangen. Die Polen freuen sich, daß wir die Juden ordentlich hochnehmen.“ Der in solchen Formulierungen zu Tage tretende antisemitische Eifer des Zugführers wurde innerhalb der Einheit offenbar geteilt, denn im gleichen Tätigkeitsbericht meldete Dunsch außerdem, die Stimmung sei „sehr gut“.23 Drei Tage später lieferte die gleiche Schwadron einen Bericht ab, der illustriert wie Juden beleidigt und eingeschüchtert wurden. Demnach veranstalteten die SS-Reiter Mitte Oktober 1939 in Grabow eine öffentliche Demütigung der dortigen jüdischen Gemeinde: „Der Rabbiner dieses Ortes wurde auf dem Marktplatz verwarnt und ihm bedeutet, daß er für die Handlungsweise seiner Juden verantwortlich wäre, daß keinerlei Tiere mehr geschächtet werden dürften, daß nicht gewuchert werden dürfe und daß am Sonnabend die Geschäfte offen zu bleiben hätten. Es wurde ihm bedeutet, daß die Durchführung dieses Befehls mit der Peitsche und nötigenfalls mit der Waffe von uns gesichert würde.“24
Das Verhältnis zwischen Heer und SS während dieser ersten Wochen unter Militärverwaltung erschien auch keineswegs so negativ, wie es Generaloberst Blaskowitz im Dezember 1939 in seiner kritischen Denkschrift darstellen sollte. Darin schrieb der Oberbefehlshaber Ost, die Einstellung der Wehrmacht zur SS würde wegen deren brutalem Vorgehen „zwischen Abscheu und Haß“ schwanken.25 Wehrmachtseinheiten pflegten dagegen beste Beziehungen zu den SS-Verbänden vor Ort. Ausdrücklich hoben Einheiten der SS-Kavallerie „ein ausgezeichnetes Zusammenarbeiten mit allen Ortskommandanturen der Wehrmacht“ hervor. Da der Wehrmacht nur unzureichende Kräfte zur Verfügung stünden, würde „das Auftauchen der SS-Reiter […] überall begrüßt“.26 Noch im folgenden Jahr konnte Fegelein berichten, Wehrmachtsgeneräle in vielen Standorten hätten „aus sich selbst heraus die Leistung unserer SS-Soldaten als vorbildlich bezeichnet“. „Besonders anerkennend ausgedrückt“ hätten sich nach dessen Aussage die Generäle Luth und Höberth in Tarnow beziehungsweise Krakau sowie – aufschlußreich hinsichtlich seines brutalen Vorgehens im Krieg gegen die Sowjetunion – der General Max von Schenckendorff in Garwolin.27
Karte 1: Das Generalgouvernement 1939/40
Mit dem überstürzten Beginn der Zivilverwaltung am 26. Oktober 1939 wurde eine Vielzahl von antisemitischen Sonderverordnungen über das besetzte Land verhängt, die für das polnische Judentum einen radikalen Bruch bedeuteten und in ihrer Gesamtheit offenbarten, daß das jahrhundertealte jüdische Leben in Polen von nun an in seiner Existenz ernsthaft bedroht sein würde. Mittels einer Verordnung vom 23. November wurden Juden ab einem Alter von zehn Jahren im Generalgouvernement gezwungen, zu ihrer Kennzeichnung eine weiße Armbinde mit blauem Davidstern zu tragen. Davon abweichend mußten die Juden im Warthegau einen gelben Stern auf der Vorder- und Rückseite ihrer Kleidung anbringen. Alle jüdischen Geschäfte im Generalgouvernement mußten ab November 1939 ebenfalls gekennzeichnet sein; jüdische Konten wurden gesperrt und Barvermögen über einem Betrag von 2000 Zloty (etwa 1000 Reichsmark) mußte bei den Besatzungsbehörden angegeben und hinterlegt werden. Friedrich-Wilhelm Krüger, der im Generalgouvernement residierende Höhere SS- und Polizeiführer, verhängte gegen die Juden eine von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr geltende Ausgangssperre.28 Eine Verordnung Franks vom 28. November 1939 erzwang die Einrichtung von Judenräten in allen Gemeinden des Generalgouvernements.29
Daneben wurde der systematische Ausschluß der jüdischen Minderheit aus dem Wirtschaftsleben des Landes massiv vorangetrieben. Tausende jüdischer Geschäfte wurden geschlossen und enteignet. In Lodsch schloß die dort stationierte SS-Reiterschwadron einige jüdische Läden unter dem Vorwand, es habe der Verdacht bestanden, daß dort Waren zurückgehalten werden würden.30 Die Zahl jüdischer Gewerbetreibender sank allein im Generalgouvernement innerhalb der ersten beiden Jahre von etwa 112 000 auf 3000.31 Der Ausschluß der Juden von der Ökonomie ihres Landes kannte wiederum ein Heer von Nutznießern. Am 28. Mai 1941, drei Wochen vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion, wurde den im Generalgouvernement stationierten Brigaden der Waffen-SS durch den zuständigen Fürsorgeoffizier eine detaillierte Aufstellung übersandt, die rund 3000 ehemals jüdische Betriebe und Einzelhandelsgeschäfte umfaßte, die für Soldaten der Waffen-SS und Wehrmacht reserviert worden waren. Für Interessierte würden, so das Begleitschreiben zu der Angebotsliste, „besonders günstige Bedingungen“ gewährt werden. Außerdem wurde versprochen, die arisierten Betriebe für die SS-Veteranen von Treuhand-Gesellschaften bis nach Kriegsende verwalten zu lassen.32
Vor Ort beteiligte sich die Waffen-SS tatkräftig an der materiellen Ausbeutung. In Tarnow veranstaltete die dort stationierte 6. Reiterschwadron im Januar 1940 flächendeckende Kontrollen gegen angeblich dort ansässige „Schmuggler“. Im Zuge dieser Kontrollen sei es nach dem betreffenden Bericht der Schwadron dem SS-Sturmmann Breuner „durch geschicktes Auskundschaften bei der jüdischen Bevölkerung“ gelungen, „in einer Juden-Wohnung eine in die Wand eingemauerte Kassette mit einem Geldbetrag von 5.120 Zloty, 2 Perlenketten und einem Brillantring“ festzustellen. Als „Schmuggelware“ sei die Kassette den deutschen Besatzungsbehörden übergeben worden.33 Wiederholt profitierten die Einheiten selbst von den antisemitisch motivierten Raubzügen. So wurde die Angebotspalette der Küche der 1. Reiterschwadron mit Lebensmitteln bereichert, die vorher im Zuge von Verkehrskontrollen bei Juden unter dem Vorwand des „Hamsterverdachts“ beschlagnahmt worden waren.34 In Zamosc nutzte die 4. Schwadron die Gelegenheit, durch die Enteignung der vorherigen Eigentümer „drei Judenhäuser 1. Klasse“ zu übernehmen, „die evtl. für spätere Wohnungen für Führer und Unterführer mit ihren Familien in Gebrauch genommen werden können“.35 Auch die in Lublin stationierte Technische Schwadron meldete, für diverse Diensträume der Schwadron seien „4 von Juden geräumte Wohnungen ausfindig gemacht“ worden.36
Daneben zeugt die Berichterstattung der SS-Kavallerie von der Existenz einer Vielzahl antisemitischer Klischees. Einheitsführer meldeten etwa, das Verhalten der Juden sei „unterwürfig und kriecherisch wie immer“. Wiederholt wurden Juden als Träger und Verbreiter von Unruhe in der polnischen Bevölkerung bezeichnet. Außerdem hieß es, sie seien zentral am Schleichhandel, an Hamsterei und an Preistreiberei beteiligt.37 Überhaupt wurde der uralte antisemitische Vorwurf des jüdischen Wuchers in den ersten Monaten des deutschen Besatzungsregimes häufig erhoben, um daraufhin umgehend Gegenmaßnahmen einzuleiten.38 Die faktische Haltlosigkeit solcher antisemitischen Stereotype wurde durch die in Lucmierz bei Lodsch liegende Schwadron einige Monate später eigens hervorgehoben. In einem Tätigkeitsbericht von Januar 1940 beklagte die Einheit stetig steigende Preise, machte als Schuldige jedoch keineswegs die vor Ort lebenden Juden aus. Die Kritik richtete sich vielmehr gegen die eigenen Volksgenossen, so wurde dargelegt: „Die nunmehr deutschen Geschäfte in Lodsch verlangen fast durchweg Wucherpreise, für die in den September- und Oktobertagen die Polen und Juden erschossen wurden, wenn sie sie auch nur annähernd verlangt haben.“39
Im Zusammenhang mit antijüdischen Aktionen war wiederholt auch die Zustimmung der polnischen Bevölkerung erwähnt. Aus Lodsch meldete eine SS-Einheit: „Im allgemeinen herrscht Freude darüber, dass Wucherjuden scharf angefasst werden.“40 Gleichlautend berichtete eine weitere Schwadron: „Bei Kontrolle der Juden ist lebhafte Zustimmung der polnischen Bevölkerung stets festzustellen.“41 Die Waffen-SS konnte bei derartigen Aktionen zudem auf die aktive Unterstützung von Volksdeutschen zählen. Wiederum im Zusammenhang mit Fällen angeblicher Preistreiberei von Juden konnte die SS-Kavallerie aus dem Ort Konstantinow bei Lodsch vermelden: „Der volksdeutsche Ingenieur Willi Lemes hat sich erboten, eine ganze Reihe von Juden nachzuweisen, die in dieser Weise handeln.“42
Mögen die bisher zitierten Beispiele zumindest teilweise noch auf der Grundlage von Befehlen zur Durchsetzung der antijüdischen Verordnungen im besetzten Polen basiert haben, existierte darüber hinaus in dem ausgreifenden Klima von Antisemitismus und deutscher Herrenmenschenmentalität eine weite Bandbreite von Taten, die gar keines Befehls bedurften, sondern schlicht auf persönlicher Willkür einzelner SS-Männer oder auf dem eigenmächtigen Handeln ganzer Einheiten beruhte. Von dem sich verselbständigenden Klima antisemitischer Gewalt zeugen schon allein diverse Befehle verschiedener SS-Institutionen, die ausdrücklich Übergriffe gegen Juden, das eigenhändige „Organisieren“ oder den Raubzug durchs Ghetto verboten.43 Ein in solchen Befehlen angedeuteter Zeitvertreib von Angehörigen der SS, Polizei oder Wehrmacht bestand im Schikanieren von Juden, die deutsche Soldaten auf der Straße entweder gegrüßt oder gerade eben nicht gegrüßt hatten. Aus solchen nichtigen Anlässen quälten und erniedrigten die Deutschen Juden häufig in aller Öffentlichkeit. Weil solche „widerlichen Scenen“ geeignet seien, „das Ansehen der Uniformträger stark herabzusetzen“, verbot Friedrich Katzmann, der SS- und Polizeiführer des Distrikts Radom, in einem Sonderbefehl offiziell das Abverlangen der Grußpflicht von Juden. Einerseits sei es, so der SS-Oberführer, „unter der Würde eines jeden SS- und Polizeiangehörigen von diesen dreckigen Ostjuden einen Gruß zu verlangen“. Andererseits führe gerade das Grüßen der Juden zu neuen antisemitischen Ausschreitungen, weil sich nun wiederum „andere Uniformierte“ „beleidigt“ fühlten, „wenn sie von so einem Subjekt gegrüßt“ werden würden.44
Die Alltäglichkeit der Übergriffe sprach Detlef S., ein ehemaliger Einheitsangehöriger der SS-Kavallerie, bei seiner polizeilichen Vernehmung 1963 an, als er schilderte, wie häufig Juden während der ersten Jahre deutscher Besatzung im Generalgouvernement sogar von SS-Führern im Vorbeigehen auf der Straße geschlagen wurden.45 „Als ich auf der Petrikauerstrasse einen Juden traf, der mir nicht aus dem Weg ging, habe ich demselben eine Ohrfeige gegeben“, meldete in aller Selbstverständlichkeit ein SS-Reiter im Juli 1940 einen derartigen Vorfall. Die Szene ereignete sich in Kielce und hatte ungewöhnlicherweise die Intervention von zwei Unteroffizieren der Wehrmacht zur Folge, worüber sich der Judenhasser in seiner Meldung prompt beschwerte.46 Angesichts der antisemitischen Willkür waren die polnischen Juden mit einer ständigen Bedrohung konfrontiert, die aus nichtigen oder objektiv gar nicht ersichtlichen Anlässen plötzlich in akute Lebensgefahr umschlagen konnte. So waren am 11. Januar 1940 einige Juden im Ghetto von Chelm mit dem Entladen eines Wagens beschäftigt. Ein zufällig des Weges kommender Rottenführer der in der Stadt stationierten 5. Schwadron der SS-Kavallerie vermutete beim Anblick der Szene sofort, „dass die Juden irgendwelche Gegenstände zu verschleppen beabsichtigten“. Mit offensichtlichem Eifer verfolgte er dann einen Juden, der nach dessen Annäherung wohl aus begreiflicher Angst vor dem SS-Uniformträger die Flucht ergriffen hatte. Nachdem er sein Opfer in einem Haus in die Enge getrieben hatte, erschoß der Rottenführer den Juden, ohne ihn überhaupt zur Rede gestellt zu haben.47
Neben Antisemitismus als wesentlichem, handlungsleitendem Motiv sind bei solchen antijüdischen Aktionen aber durchaus noch zusätzliche Beweggründe auszumachen. So war das Interesse an persönlicher Bereicherung bei manchen Taten ganz offensichtlich ein Motiv, welches sich mit dem Judenhaß der Täter aufs Beste ergänzte.48 Statt die Schwadronskasse zu belasten oder langwierige Eingaben bei übergeordneten Dienststellen abzuwarten, raubte die schwere Schwadron der 1. Reiterstandarte kurzerhand den benötigten Posten Leder bei einem jüdischen Handwerker des Stationierungsortes im Distrikt Radom.49 Analog verfuhr der Maschinengewehr-Zug der Standarte am 8. Juli 1940. An diesem Tag plante die Einheit eine Aktion gegen die Juden des Ortes Latowicz, weil, so der Einheitsführer, „der Zug zu etwas Geld kommen wolle“.50 In einem ähnlichen Fall erfuhr ein Schwadronskommandeur vom Raubzug eines Mannes seiner Einheit bei der jüdischen Gemeinde des Nachbarortes. Er schloß von vornherein jeglichen Gedanken an eine Rückgabe der Beute von 400 Zloty aus, da die dortigen Juden andernfalls „sofort Oberwasser bekommen“ würden. Statt dessen zog der Einheitsführer 300 Zloty für die Schwadronskasse ein und ließ für den Restbetrag ein Faß Bier kaufen, das für die Männer „eine wunderbare Auffrischung“ bedeutet habe.51
Ein Regime von Terror und Erpressung hatte auch die 3. Schwadron der 2. SS-Reiterstandarte in Zamosc errichtet. Der Kommandeur, Sturmbannführer Josef Fritz, war unter den Juden der Stadt gefürchtet; den Hof der Schwadronsunterkunft soll er mit den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs gepflastert haben.52 Von der jüdischen Gemeinde forderte die Einheit laufend Geld und Sachmittel. Für den Bau der aufwendigen Unterkünfte, der späteren Reit- und Fahrschule der SS-Kavallerie in Zamosc, wurden zudem täglich mehrere hundert Juden zur Zwangsarbeit gepreßt. Daneben hatte die Gemeinde sämtliche Baumaterialien im Gesamtwert von 1,5 Millionen Zloty zu finanzieren.53
Mitte März 1941 faßten die beiden SS-Reiter Alfred Bernshausen und Heribert Unrath während eines abendlichen Spaziergangs in ihrem Stationierungsort Krakau den Entschluß, doch noch „einige Juden zu kitzeln“. Beide gingen daraufhin zu der am Krakauer Ghetto gelegenen Weichselbrücke, hielten jüdische Passanten an und kontrollierten deren Papiere. Den schockierten Juden teilten die SS-Männer mit, daß sie noch heute „ausgesiedelt“ werden würden und sich zu diesem Zweck binnen kurzem an einem bestimmten Ort in der Stadt einzufinden hätten. Als fingierte „Garantie“ für deren Erscheinen nahmen beide Männer den angesprochenen Juden jeweils Bargeld oder die Armbanduhr ab, um sich anschließend den nächsten Opfern zuzuwenden.54 Das geschilderte Vorgehen verdeutlicht, daß es den beiden Akteuren nicht nur darum ging, in den Besitz von Bargeld oder der Armbanduhr ihrer Opfer zu gelangen. Beide SS-Reiter zeigten über den erzielten materiellen Gewinn hinaus ganz wesentliches Interesse an der psychischen Qual ihrer jüdischen Opfer. In beiderlei Beziehung kamen die Männer voll auf ihre Kosten, wobei der Drang nach persönlicher Bereicherung ohne die vorhergehende antisemitische Kategorisierung der Opfer gar nicht zu befriedigen gewesen wäre.
Selbst sexuelle Übergriffe erwiesen sich als hochgradig kompatibel zum Judenhaß der Täter. In Warschau hatte sich 1940 unter der Leitung des SS-Untersturmführers Dr. Karl Reinsch eine Gruppe von fünf Angehörigen des Reiterregiments 1 zusammengefunden, die etliche Male jüdische Frauen sexuell mißhandelten. Dazu nahmen die Männer junge und attraktive Jüdinnen auf offener Straße fest und brachten sie zur eigenen Dienststelle, einer Warschauer Ärzteunterkunft des Kavallerieverbandes. Dort wurden die Frauen zu diversen Haus- oder Reinigungsarbeiten eingeteilt. Mit der Begründung, die Arbeiten nicht gründlich verrichtet zu haben, wurden sie dann nach einiger Zeit von den Beteiligten entkleidet und vor der versammelten Gruppe mit Reitpeitschen auf den nackten Körper geschlagen. Mitunter wurden sie von den Soldaten auch auf andere Weise sexuell mißhandelt; Reinsch tauchte zuweilen sogar in deren Wohnungen auf, um die Jüdinnen dort zu quälen. Während die Beteiligten die unzweifelhaft vorhandenen sexualisierten Tatmotive bei ihren Vernehmungen durch den Gerichtsoffizier vehement zu leugnen versuchten, gaben einzelne SS-Männer ihren „besonderen Haß auf die Juden“ als Tatmotiv offen zu.“55