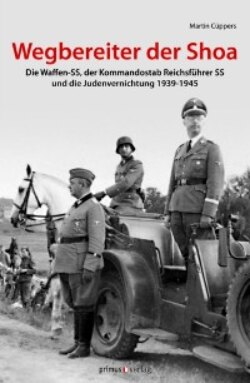Читать книгу Wegbereiter der Shoah - Martin Cüppers - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеIm Spätsommer 1941 gab der Kommandostab Reichsführer-SS Richtlinien heraus, die als Handlungsanleitung für die zukünftige Bekämpfung des sich andeutenden Widerstands im Hinterland der deutsch besetzten Sowjetunion gedacht waren. In dem zweiseitigen Text wird hinsichtlich der Kontakte zwischen Zivilbevölkerung und Partisanen festgestellt: „Die besten Nachrichtenübermittler sind die Juden. Taucht hierüber der geringste Verdacht auf, so sind die Juden der betr.[effenden] Ortschaften rücksichtslos auszurotten.“ Im Hinblick auf die Beruhigung der sowjetischen Zivilbevölkerung und das für erforderlich erachtete Einschreiten gegen Gerüchte über eine angebliche Rückkehr der Sowjetmacht legte der Kommandostab in dem Text zusätzlich nahe: „Eine Unschädlichmachung der Juden wirkt aber auch in dieser Beziehung Wunder.“1
Während die Pauschalität der Begründung, mit denen Juden grundsätzlich der Vernichtung anheim gestellt werden, anderen Mordbefehlen der Deutschen durchaus entspricht, erstaunen im zitierten Fall die Adressaten der Richtlinien. Die Mordanweisung des Kommandostabes Reichsführer-SS richtete sich weder an die Einsatzgruppen aus Reinhard Heydrichs Reichssicherheitshauptamt, noch an die als „Fußvolk der Endlösung“ bezeichneten Bataillone der Ordnungspolizei.2 Die Empfänger der Richtlinien waren vielmehr drei Brigaden der Waffen-SS, militärische Verbände also, die seit mehreren Wochen in den deutsch besetzten Gebieten der Sowjetunion eingesetzt wurden. Der Kommandostab war im Frühjahr 1941 unter der persönlichen Ägide Heinrich Himmlers im Zuge der Kriegsplanungen der SS aufgestellt worden. Nachdem die Brigaden kurz vor Feldzugsbeginn dem Stab unterstellt worden waren, kamen sie nach den ersten Kriegswochen im besetzten Hinterland zum Einsatz und verübten systematische Massenverbrechen an den sowjetischen Juden. In den folgenden Jahren war der Kommandostab weiterhin tätig und auch die SS-Verbände blieben im Osten eingesetzt.
Bis heute hält sich der hauptsächlich von SS-Veteranen selbst geschaffene Mythos, die Waffen-SS sei nicht in den Vernichtungsprozeß gegen die europäischen Juden involviert gewesen. Kritische Forschungsansätze sind in diesem noch immer von NS-Apologeten besetzten Terrain äußerst rar. Der Widerlegung der irrigen Behauptung von der Nichtbeteiligung der Waffen-SS an der Shoah und der ausführlichen Analyse der Tätigkeit des Kommandostabes Reichsführer-SS und seiner unterstellen Truppen widmet sich die vorliegende Studie. Sie ist damit die erste Monographie überhaupt, die diese Thematik umfassend bearbeitet. Bisher existieren nur wenige Aufsätze, die sich mit Einzelaspekten oder mit bestimmten Phasen der Geschichte des Kommandostabes auseinandersetzen. Welche Fehlurteile dabei über dessen Funktion möglich sind, markiert eine Charakterisierung Bernd Bolls, der reichlich verunglückt vom Kommandostab als einer „Spezialformation der Waffen-SS für den Kampf gegen Partisanen“ spricht.3
Erstmals skizzierte Yehoshua Büchler 1986 den Anteil der Brigaden an der Ermordung der sowjetischen Juden. Der Aufsatz beschränkte sich auf die zweite Hälfte des Jahres 1941; der zentrale, aber damals kaum zugängliche Bestand des Kommandostabes in Prag wurde vom Verfasser nicht eingesehen. Trotzdem markierte der verdienstvolle Beitrag lange Zeit den Forschungsstand zu diesem Thema. Fünf Jahre nach Büchler deutete Ruth Bettina Birn in einem kurzen Beitrag von 1991 anhand von Einsätzen einer Teileinheit der SS-Kavalleriebrigade im August 1941 den Zusammenhang zwischen der von den Deutschen behaupteten „Partisanenbekämpfung“ und der dabei in Wirklichkeit realisierten Judenvernichtung an. Der Zusammenhang zum übergeordneten Kommandostab Reichsführer-SS und der in diesen Wochen immer systematischer organisierten Judenvernichtung blieb darin jedoch unerwähnt. Bernd Boll veröffentlichte 2000 einen Aufsatz über Einsätze der parallel zur SS-Kavallerie operierenden 1. SS-Brigade während des Sommers 1941. Darin wird auf schmaler Quellengrundlage hauptsächlich das Unterstellungsverhältnis unter die Wehrmacht thematisiert, während die vorrangige Verbindung zum Kommandostab eine nachgeordnete Bedeutung spielt und die tatsächliche Dimension der Verbrechen auch nur teilweise erfaßt wird. Vom Verfasser der vorliegenden Studie erschien schließlich 2004 eine biographische Skizze über Gustav Lombard, einen Offizier der SS-Reiterbrigade. Darin werden dessen Vorreiterrolle bei der Judenvernichtung und die von Lombard radikal interpretierten Entscheidungsspielräume analysiert.4 Vom selben Autor stammt ein wenig später veröffentlichter Aufsatz über das Vorgehen von Truppen der Waffen-SS während der beiden ersten Jahre deutscher Besatzung in Polen.5 Nur der Vollständigkeit halber sei noch das Buch „Riding East“ von Mark C. Yerger erwähnt, das eine groteske Lobeshymne auf die Kavalleriebrigade darstellt. Judenmord wird darin schlicht nicht thematisiert; die seitens der SS-Reiter vorgenommenen Massentötungen deutet der Autor ohne Benennung der Opfer vage an, um sie dann mit Verweis auf die sowjetische Partisanentätigkeit zu rechtfertigen.6
Abgesehen davon existieren bislang drei Monographien, in denen der Kommandostab Reichsführer-SS eine gewisse Erwähnung findet. Vor kurzem verfaßte Jürgen Matthäus im Rahmen seines Kapitels in Christopher Brownings Studie über die Entfesselung der „Endlösung“ eine gelungene Einordnung der ersten Einsätze der Brigaden. Auf aktuellem Forschungsstand gelang ihm damit die bisher beste Charakterisierung der Bedeutung dieser SS-Truppen und des übergeordneten Stabes beim Judenmord.7 In seiner Gesamtdarstellung der Shoah betonte Peter Longerich den Zusammenhang zwischen der Aufstellung des Kommandostabes und den deutschen Vorbereitungen auf den Vernichtungskrieg. Zwar ging er im weiteren auch auf die Relevanz der ersten Einsätze der Brigaden ein, die tatsächlichen Abläufe werden letztlich allerdings nur unzureichend erfaßt und wenig zutreffend charakterisiert.8 Christian Gerlach stellte im Rahmen seiner umfangreichen Studie über Weißrußland Vernichtungsaktionen der Kavalleriebrigade während des Sommers 1941 dar. Doch seine Bewertung der Funktion des Kommandostabes kann dessen tatsächlicher Bedeutung nicht gerecht werden. Unter dem Fokus der nationalsozialistischen Wirtschafts- und Ernährungspolitik gelingt es ihm nicht, die vorrangig ideologisch determinierten Motive und Handlungsabläufe der SS-Truppen adäquat einzuordnen.9
Auch in den Standardwerken zur Shoah findet die Thematik keine weitere Berücksichtigung. Sowohl in der erstmals 1961 auf englisch erschienenen bahnbrechenden Gesamtdarstellung Raul Hilbergs zur Vernichtung der europäischen Juden als auch in der beeindruckenden Arbeit H. G. Adlers oder den Studien von Lucy S. Dawidowicz und Leni Yahil bleiben die Verbrechen der Truppen des Kommandostabes unerwähnt.10 Hinsichtlich der Fachliteratur zur Waffen-SS sieht das Bild kaum anders aus. Die Veröffentlichung Kurt-Gerhard Klietmanns versprach schon 1965 eine Gesamtdarstellung der Waffen-SS. Zwar finden die in der vorliegenden Studie untersuchten Truppenteile darin eine, an organisatorischen Gesichtspunkten orientierte, oberflächliche Beachtung; Klietmanns Werk läßt jedoch jegliche Kritik an der Institution generell und am Vorgehen der einzelnen Verbände vermissen. Verdienstvoller sind die Untersuchung von George H. Stein sowie das mittlerweile zurecht als Standardwerk geltende Buch von Bernd Wegner, der damit eine detaillierte Organisationsgeschichte und strukturelle Analyse der bewaffneten SS vorlegte. Beide Werke schreiben jedoch keine eigentliche Einsatzgeschichte; damit spielen auch die Massenverbrechen in beiden Studien nur eine marginale Rolle.11 In der grundlegenden Literatur zum SS-Apparat und den nationalsozialistischen Lagern spielt der Kommandostab Reichsführer-SS ebenfalls keine Rolle; trotzdem konnten einzelne Werke für erweiterte Fragestellungen mit Gewinn herangezogen werden. Zu nennen sind hier in erster Linie die Bücher von Robert Lewis Koehl und Heinz Höhne zur SS, die Studie von Karin Orth zur Konzentrationslager-SS und die Beiträge in dem zweibändigen Sammelwerk über die nationalsozialistischen Konzentrationslager.12
Andere Bereiche von Himmlers Imperium wie das Reichssicherheitshauptamt, dessen Geschichte für diese Studie in Detailfragen von Interesse war, sind historisch deutlich besser erforscht. Nach den frühen Forschungen Raul Hilbergs erbrachten in erster Linie die beiden von Gerhard Paul und Klaus-Michael Mallmann herausgegebenen Sammelbände zur Gestapo, die richtungsweisende Biographie Ulrich Herberts über Werner Best sowie die umfangreiche Studie von Michael Wildt neue Erkenntnisse.13 Speziell zu den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD liegt bisher mit dem Buch von Helmut Krausnick jedoch nur eine zusammenfassende Studie vor, deren zeitlicher Untersuchungsrahmen zudem Anfang 1942 endet.14 Zu einzelnen in der Sowjetunion operierenden Einsatzgruppen existiert die Pionierarbeit von Hans-Heinrich Wilhelm zur Einsatzgruppe A sowie die beeindruckende Studie von Andrej Angrick zur Einsatzgruppe D. Dagegen fehlen Detailstudien zu den Einsatzgruppen in Polen, zu den Einsatzgruppe B und C in der Sowjetunion, aber auch zu den übrigen im deutschen Machtbereich eingesetzten Einheiten.15 Schmaler stellt sich wiederum die derzeitige Forschungslage zur Ordnungspolizei dar, einer weiteren, für die vorliegende Untersuchung mitunter relevanten Sparte im SS-Apparat. Friedrich Wilhelm legte vor einigen Jahren eine organisationsgeschichtliche Darstellung vor. Pionierarbeit leistete zudem Klaus-Michael Mallmann mit der Betonung des Anteils der Ordnungspolizisten an der deutschen Vernichtungspolitik.16 Erste Detailstudien zu Teileinheiten im Osteinsatz legten Christopher Browning und Daniel Goldhagen mit ihren Arbeiten zum Reservepolizeibataillon 101 sowie Andrej Angrick und andere zum Polizeibataillon 322 vor.17
Neben der eigentlichen Forschungsliteratur existieren Zeugnisse von jüdischen Überlebenden, auf die sich die vorliegende Untersuchung immer wieder stützt. Eine bedeutende Sammlung von Aussagen aus der Sowjetunion bietet das von Wassili Grossmann und Ilja Ehrenburg herausgegebene Schwarzbuch. Als besonders wertvoll erwiesen sich verschiedene Yizker Bikher, Erinnerungsbücher jüdischer Gemeinden, die in mehreren Fällen eine genauere Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie präzisere Angaben über die Zahl der Opfer ermöglichten.18 Darüber hinaus erwies sich die Literatur zum jüdischen Widerstand gegen die Deutschen als unverzichtbar, da sich bewaffnete Gegenwehr von Juden wiederholt direkt gegen Vernichtungsaktionen der untersuchten SS-Verbände richtete.19
Im Schwerpunkt leistet die Studie jedoch einen Beitrag zur Täterforschung. Unter dieser Bezeichnung hat sich in den letzten Jahren eine recht junge Teildisziplin innerhalb der NS-Forschung verstärkt den Handelnden in der nationalsozialistischen Juden- und Vernichtungspolitik zugewandt. Seitdem legten Historiker Grundlagenforschungen vor, die das Wissen über die Akteure in den verschiedensten Bereichen des nationalsozialistischen Systems erheblich erweiterten. Mit der seit Frühjahr 2001 bestehenden Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart wurde nicht zuletzt eine wissenschaftliche Einrichtung geschaffen, die es sich zur zentralen Aufgabe gemacht hat, die Erkenntnisse auf diesem Gebiet in den kommenden Jahren durch weitere Forschungen beständig zu vergrößern. Bislang wurden von dort aus eine umfangreiche und aufwendig kommentierte Quellensammlung zu Mentalitäten, Tatorten und Tateinheiten im deutsch besetzten Ostmittel- und Osteuropa sowie ein Band mit 23 Täterbiographien aus den unterschiedlichsten Bereichen des nationalsozialistischen Machtapparats vorgelegt. Kürzlich erschien außerdem ein Sammelband mit diversen Beiträgen zu den richtungsweisenden, jedoch bislang wenig beachteten ersten beiden Jahren deutscher Besatzungspolitik in Polen.20
Anders als es die insgesamt überaus überschaubare Literatur zum Thema vermuten lassen würde, kann sich eine Studie zum Kommandostab Reichsführer-SS auf einen in weiten Teilen geradezu lückenlosen Quellenbestand stützen. Bereits 1965 erschien eine aussagekräftige Quellenedition, die das Kriegstagebuch des Kommandostabes von 1941 sowie einige Tätigkeitsberichte der unterstellten Einheiten der Waffen-SS enthält. Seitdem waren der historischen Forschung die Massenmorde dieser SS-Verbände an den sowjetischen Juden prinzipiell bekannt.21 Im Vojenský ústřední archiv (Zentrales Militärarchiv) in Prag sind in insgesamt 24 Kartons die gesamten Akten des Kommandostabes für die Jahre 1941 und 1942 erhalten geblieben. Erst ab 1943 wird die Quellenüberlieferung deutlich schmaler. Der Aktenbestand enthält drei Kriegstagebücher, alle wesentlichen Einsatzbefehle sowie Tagesmeldungen und Tätigkeitsberichte der unterstellten Einheiten und sämtlicher Stabsabteilungen.22 Ergänzt wird der Bestand durch gesonderte Überlieferungen zur 1. SS-Brigade und zur SS-Kavallerie.23 Noch während des Krieges waren diese Unterlagen an die 1940 durch das SS-Führungshauptamt gegründete Kriegsgeschichtliche Forschungsabteilung der Waffen-SS abgegeben worden. Das gesamte Archiv der Waffen-SS wurde zum Schutz vor den zunehmenden Bombardierungen der Alliierten im Frühjahr 1944 von Oranienburg bei Berlin in das als relativ sicher geltende „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren“ transportiert und im Schloß Zásmuky bei Prag eingelagert. Dort überdauerten die Akten die Wirren der Kriegsendphase. Von einer Einheit der tschechoslowakischen militärischen Abwehr wurden sie 1946 dem Militärzentralarchiv übergeben. Seitdem lagern die Dokumente in dem in der Vergangenheit mehrmals umbenannten Zentralen Militärarchiv der tschechischen Armee in Prag.24
Neben diesen Quellen sind außerdem die im Bundesarchiv Berlin lagernden Akten des SS-Führungshauptamtes, von Himmlers Persönlichem Stab und die Personalunterlagen des ehemaligen Berlin Document Center von zentraler Bedeutung.25 Ferner lagern im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg in den dortigen umfangreichen Beständen zur Waffen-SS zahlreiche Akten der Kavalleriebrigade sowie ein kleinerer Bestand zum Sonderkommando Dirlewanger, das dem Kommandostab Anfang 1942 kurzzeitig unterstand.26 Im Zwischenarchiv des Bundesarchivs in Dahlwitz-Hoppegarten wurden schließlich noch relevante Akten zur deutschen Besatzungspolitik und zur Bekämpfung der Partisanenbewegung eingesehen. Dort lagern unter anderem mehrere Ordner aus den Beständen der Ordnungspolizei mit zahlreichen Funk- und Fernschreibprotokollen, die Einsätze der Brigaden dokumentieren.27 Im Vergleich zur Quellenlage bei den Einsatzgruppen des Reichssicherheitshauptamtes oder den Bataillonen der Ordnungspolizei liegt damit zum Kommandostab und den unterstellten Einheiten der Waffen-SS eine Überlieferung vor, die in ihrer Dichte absolut einzigartig ist.
Ergänzend zu den genannten Beständen wurden im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg Akten der Wehrmacht ausgewertet, die teilweise wichtige Zusatzinformationen erbrachten. Vorrangig handelt es sich dabei um die Unterlagen der Befehlshaber der rückwärtigen Heeresgebiete in der eroberten Sowjetunion sowie um Akten einzelner Armeeoberkommandos und Divisionen.28 Als weitere relevante Quellen wurden zudem die „Ereignismeldungen UdSSR“ des Reichssicherheitshauptamtes aus dem Jahr 1941, umfangreiche Akten der Ordnungspolizei zur Besatzungspolitik in Polen und der Sowjetunion sowie das Tagebuch des Höheren SS- und Polizeiführers Rußland Mitte, Erich von dem Bach-Zelewski, herangezogen.29 Darüber hinaus konnte auf einige wertvolle Editionen zurückgegriffen werden. Bedeutsame Informationen enthielt das aufwendig kommentierte und hervorragend nutzbare Diensttagebuch Heinrich Himmlers.30 Als hilfreich bei der Bearbeitung des Themas erwies sich auch das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, das Tagebuch Franz Halders, des Generalstabschefs des Heeres und der sogenannte Stroop-Bericht über die Niederschlagung des jüdischen Aufstands im Warschauer Ghetto.31 Unverzichtbar waren außerdem die 42 sogenannten Blauen Bände der Verhandlungsprotokolle und Beweisdokumente des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg gegen die Hauptkriegsverbrecher.32
Eine wichtige Quellengattung neben den originalen Dokumenten der Täter stellen zudem die Justizunterlagen dar, die im Rahmen von Ermittlungsverfahren nach 1945 gegen NS-Verbrecher angelegt wurden. Gegen frühere SS-Offiziere der Brigaden des Kommandostabes führten bundesdeutsche Staatsanwaltschaften in den sechziger Jahren mehrere Verfahren. Trotz teilweise erdrückender Beweislast gegen einzelne Beschuldigte wurde die überwiegende Mehrzahl jedoch eingestellt. In der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, deren Archiv in die Verantwortung des Bundesarchivs übergegangen ist, lagern fünf Aktenbände eines 1965 geführten Vorermittlungsverfahrens gegen ehemalige Angehörige der 2. SS-Brigade.33 Außerdem sind dort wichtige Teile der bedeutend umfangreicheren Ermittlungsakten gegen Angehörige der 1. SS-Brigade und der Kavalleriebrigade zu finden.34 Seitens der Staatsanwaltschaften Coburg und später München wurden Ermittlungen gegen ehemalige Angehörige der 1. SS-Brigade geführt. Das Verfahren in einem Umfang von zuletzt 163 Aktenbänden wurde 1972 eingestellt; heute ist es im Staatsarchiv München einzusehen.35 Dort lagert mit einem Umfang von 50 Aktenbänden außerdem ein von der Staatsanwaltschaft München geführtes und 1971 eingestelltes Verfahren gegen Offiziere des 1. SS-Kavallerieregiments und des Stabes der SS-Kavalleriebrigade.36 Nur gegen ehemalige Angehörige des 2. SS-Kavallerieregiments wurde 1963 nach mehrjährigen Ermittlungen vor dem Landgericht Braunschweig Anklage erhoben. Die Verhandlung führte 1964 zur Verurteilung des Hauptangeklagten Franz Magill, des zeitweiligen Kommandeurs der berittenen Schwadronen, zu mehrjähriger Haft. Drei Mitangeklagte wurden ebenfalls zu Freiheitsstrafen verurteilt.37 Die Ermittlungsakten mit Aussagen von Hunderten von ehemaligen Einheitsangehörigen sowie von jüdischen Überlebenden sind ergänzend zu den Originaldokumenten unverzichtbare und sehr aussagekräftige Quellen. Darüber hinaus konnten aus weiteren Ermittlungsunterlagen, die sich teils gar nicht direkt gegen Angehörige der SS-Brigaden richteten, ebenfalls wichtige Informationen gewonnen werden.38
Die angeführten Quellengattungen bergen hinsichtlich ihrer Benutzung im Rahmen einer historischen Studie spezifische Problemfelder. Die originären Dokumente der Täter – Akten des Kommandostabes, der unterstellten Brigaden oder anderer Stellen des SS-Apparats – weisen einerseits einen hohen Grad an Authentizität auf, da sie im unmittelbaren zeitlichen Kontext der Ereignisse entstanden sind. Auf der anderen Seite muß bei Benutzung solcher Quellen Berücksichtigung finden, daß Befehle und Anordnungen zwar die Intention des Verfassers wiedergeben, deren Umsetzung aber auf eine ganz andere Weise erfolgt sein kann. Einsatzberichte wiederum können häufig nur sehr ungenauen Aufschluß über historisch relevante Geschehnisse enthalten. Gerade nach den ersten Monaten des Krieges gegen die Sowjetunion läßt sich in den Quellen verfolgen, daß die ursprünglich ganz offen gemeldeten Mordaktionen gegen Juden mehr und mehr hinter Tarnbegriffen und Euphemismen verschwinden – ein Umstand, der eben kein Beleg für einen Rückgang der Mordaktionen darstellt, sondern lediglich deren Nachweis wesentlich erschwert.
Schwierigkeiten ganz anderer Art zeigen sich bei den nach 1945 von den Ermittlungsbehörden angelegten Justizakten. Allein das – im Nachkriegsdeutschland vielfach nur bescheiden ausgeprägte – justitielle Verfolgungsinteresse unterscheidet sich grundlegend von der historischen Perspektive, die einer möglichst weitgehenden Untersuchung von Ereignissen und Entwicklungen verpflichtet ist. Demgegenüber beschränkten sich Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der Truppen des Kommandostabes auf bestimmte, zeitlich eng begrenzte Tatvorwürfe, die in sich die Chance einer juristischen Ahndung bargen. Dabei blieben oft andere, nicht minder schwere Verbrechen unberücksichtigt, weil sie bestimmten Personen nicht zuzuordnen waren oder in einem ganz anderen zeitlichen Kontext begangen wurden. Zudem war das Aussageverhalten einer Mehrheit der als Zeugen oder Beschuldigten vernommenen Täter vorrangig vom Interesse geleitet, den Vernehmungsbeamten möglichst keine juristisch verwertbaren Beweise für die begangenen Massenverbrechen zu liefern. Offene, inhaltlich ausführliche Schilderungen des Geschehens sind deshalb aus diesem Personenkreis selten. Vielmehr zeigten sich die ehemaligen SS-Männer äußerst bestrebt, die Verbrechen zu leugnen, die eigene Verantwortung daran zu negieren und die historischen Geschehnisse möglichst zu verfälschen.39
Nicht unproblematisch sind mitunter auch die Aussagen polnischer oder sowjetischer Zeugen und der überlebenden Opfer. Ihnen war es in vielen Fällen schlicht nicht möglich, Täter genauer zu identifizieren, da sie keine Kenntnis von den verschiedenen Uniformen deutscher Einheiten hatten und meist deren Sprache auch nicht verstanden. Diesbezügliche Angaben sind deshalb häufig unpräzise. Zahlreiche Aussagen von Zeugen und Opfern entstanden zudem noch während des Krieges und in den Jahren danach vor sowjetischen und polnischen Untersuchungskommissionen, wo persönliche psychische Zwangssituationen, die das Aussageverhalten beeinflußt haben können, nicht auszuschließen waren. Solche Erwägungen sind grundsätzlich ausschlaggebend für das Bemessen des Werts einer Quelle und machen es in vielen Fällen erforderlich, weitere Belege heranzuziehen, die den jeweiligen Sachverhalt stützen oder widerlegen.
Für die Strukturierung der gesamten Studie erschien ein weitgehend chronologischer Aufbau am sinnvollsten. Nach der einleitenden Darstellung der Entwicklung der bewaffneten SS werden im ersten Teil auf der Grundlage zahlreicher Originaldokumente und Nachkriegsaussagen die Einsätze der SS-Totenkopfstandarten im besetzten Polen in den Jahren 1939 bis 1941 dargestellt. Die detaillierte Untersuchung von deren Tätigkeit als Besatzungstruppen in Polen ergänzt die in jüngster Zeit verstärkt betriebene Erforschung der beiden ersten Jahre deutscher Besatzungspolitik. Nicht zuletzt wird dadurch die sich in der Forschung immer deutlicher abzeichnende Tendenz, schon den Angriff auf Polen und nicht erst den Sommer 1941 als Beginn des deutschen Vernichtungskrieges zu betrachten, hinsichtlich des Vorgehens der bewaffneten SS einer weiteren Überprüfung unterzogen.40
Vor dem Hintergrund der Einsätze der SS-Truppen in Polen wird in einem zweiten Teil anhand von Personalakten der Waffen-SS sowie mittels der Auswertung zahlreicher biographischer Angaben aus Vernehmungsprotokollen westdeutscher Ermittlungsbehörden das Personal der SS-Einheiten des Kommandostabes in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt. Getrennt nach Mannschaftsdienstgraden und Offizieren wird anhand von Kategorien wie Alter, soziale Herkunft, Berufswahl und politische Sozialisation ein Sozialprofil der SS-Angehörigen erstellt. Damit wird erstmals überhaupt eine Studie zu den Mannschaftsdienstgraden der Waffen-SS vorgelegt. Auf der Grundlage dieser Befunde wird anschließend nach dem ideologischen Hintergrund und den persönlichen Motiven der Einheitsangehörigen gefragt. Eine Untersuchung des weltanschaulichen Unterrichts der Waffen-SS und speziell der Schulung der Brigaden geht der Frage nach, ob sich im Vorfeld der Einsätze Belege für eine antisemitische Indoktrinierung der SS-Männer finden lassen. Des weiteren werden im Anschluß die zahlreichen Aussagen ehemaliger Einheitsangehöriger im Zuge der Ermittlungsverfahren der 60er und 70er Jahre hinsichtlich der Motivlage der Männer analysiert.
Im daran anschließenden dritten Teil werden auf der Grundlage der Einsatzbefehle und Berichte der SS-Truppen des Kommandostabes, der Angaben beteiligter Täter und der Aussagen jüdischer Überlebender sowie der Schilderungen in einigen Erinnerungsbüchern von betroffenen Gemeinden die ersten Einsätze der Brigaden von Ende Juli bis Mitte August 1941 untersucht. Danach wird die Bilanz dieser beiden Wochen mit dem gleichzeitigen Vorgehen anderer deutscher Einheiten in Beziehung gesetzt und deren Bedeutung im Zusammenhang mit den Entscheidungen der nationalsozialistischen Führung eingeordnet. Für die Darstellung der weiteren Operationen der Brigaden und der Tätigkeit des Kommandostabes bis Ende 1941 wurde eine systematische Untersuchung nach relevant erscheinenden Fragestellungen ausgearbeitet. Entsprechend wird der weitere Anteil des Kommandostabes an der Vernichtung der sowjetischen Juden analysiert. Anschließend werden die Methoden der „Partisanenbekämpfung“ der SS-Truppen dargestellt. Weitere Kapitel widmen sich dem Terror gegen die nichtjüdische Zivilbevölkerung und der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen.
Ein vierter Teil hat die Tätigkeit des Kommandostabes sowie die Einsätze der SS-Verbände in den Jahren 1942 bis 1945 zum Gegenstand. In diesem Rahmen wird auf die weitere Bedeutung und die Zusammensetzung des Stabes eingegangen. Des weiteren werden dessen Rolle bei der „Partisanenbekämpfung“ in Osteuropa dargestellt und einzelne für die Führung des Vernichtungskrieges relevante Einsätze exemplarisch untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird außerdem auf die Verwendung jener SS-Truppen gelegt, die bei der Realisierung der Shoah in der Sowjetunion und in Polen mitwirkten und mit dem Kommandostab in Verbindung standen. Abgeschlossen wird dieser Teil der Studie mit der Darstellung der weiteren Entwicklung und Verwendung der SS-Verbände und des Kommandostabes bis zum militärischen Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus.
Im fünften Teil wird mit Hilfe der Ermittlungsunterlagen der Justizbehörden der Weg der SS-Männer im Nachkriegsdeutschland nachgezeichnet; Lebenswege und Karrieren der Täter werden exemplarisch dargestellt. Außerdem werden die Versuche zur justitiellen Ahndung der begangenen Massenverbrechen analysiert sowie das Verhalten der Täter während der Ermittlungsverfahren untersucht. Deren Engagement in Verbänden wie der HIAG, dem organisatorischen Auffangbecken für ehemalige Angehörige der Waffen-SS in der Bundesrepublik Deutschland, ist ein weiteres Unterkapitel gewidmet. Abschließend wird über den eigentlichen Kontext des Kommandostabes Reichsführer-SS hinaus eine bislang nicht existierende Gesamtperspektive angedeutet, die aufzeigt, wie stark die Waffen-SS insgesamt in die nationalsozialistische Vernichtungspolitik eingebunden war.
Schließlich sei noch bemerkt, daß im folgenden sämtliche Zitate aus Gründen der Authentizität in der unkorrigierten Schreibweise der Originalquelle übernommen werden. Ortsnamen werden grundsätzlich in der damaligen deutschen Version verwendet, um dem Faktum der Besatzung der jeweiligen Länder durch das nationalsozialistische Deutschland Rechnung zu tragen. Aus dem Interesse, den Anmerkungsapparat möglichst zu begrenzen, werden Literaturangaben mit dem jeweiligen Kurztitel angegeben; für sonstige Quellen sowie Archivstandorte werden verschiedentlich Abkürzungen verwendet. Sämtliche Kurztitel und Abkürzungen sowie die Nachweise der verwendeten Photos werden im Anhang aufgeführt.