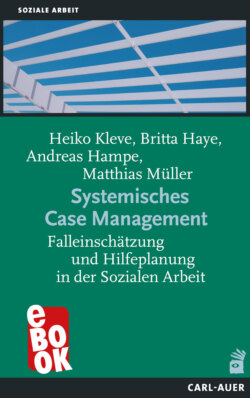Читать книгу Systemisches Case Management - Matthias Müller - Страница 14
Entwicklung der klassischen Methoden Sozialer Arbeit
ОглавлениеDie klassischen Methoden Sozialer Arbeit sind genau genommen keine spezifischen Methoden, sondern Arbeitsformen. Innerhalb dieser Arbeitsformen wird dann methodisch etwa mit einzelnen KlientInnen oder Familien (Soziale Einzelfallhilfe), mit Gruppen (Soziale Gruppenarbeit) oder Gemeinwesen (Gemeinwesenarbeit) sozialarbeiterisch gehandelt (kommuniziert). Die Entwicklung der sozialarbeiterischen Arbeitsformen/Methoden kann in vier Phasen unterteilt werden (vgl. Schilling 1997, S. 272 ff.; Galuske 1998, S. 63 ff.):
Erste Phase: Anfänge (Anfang des 20. Jahrhunderts): In Deutschland hat vor allem Alice Salomon die Anfänge der professionellen sozialarbeiterischen Methoden maßgeblich beeinflusst. Mit der Veröffentlichung ihres Buches Soziale Diagnose (1926) versuchte sie, die aus den USA kommende (von Mary Richmond entwickelte) Methode des Case Work auch in Deutschland bekannt zu machen. Der Begriff »Diagnose« deutet es schon an, dass die Sozialarbeit in ihrer ersten Phase bestrebt war, sich konzeptionell/methodisch an die Medizin anzulehnen.
Das Ziel der sozialen Diagnose von FürsorgerInnen ist es, »Material zu sammeln (eigene Beobachtungen und Aussagen anderer), das beschaffene Material zu prüfen und zu vergleichen, es zu bewerten, Schlüsse daraus zu ziehen – schließlich ein Gesamtbild herzustellen, das erlaubt, einen Plan für die Abhilfe (Behandlung) zu fassen. […] Zum Material der Ermittlung gehören […] alle Tatsachen aus dem Leben des Bedürftigen und seiner Familie, die dazu helfen können, die besondere soziale Not und das soziale Bedürfnis des Betroffenen zu erklären und die Mittel zur Lösung der Schwierigkeit aufzuzeigen« (Alice Salomon, zit. nach Müller 1988, S. 145).
Zweite Phase: Übernahme amerikanischer Methoden (Arbeitsformen) (1950er Jahre): In dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Bundesrepublik Deutschland die in den USA entwickelten o. g. klassischen Methoden/Arbeitsformen der Sozialen Arbeit in die Praxis und Lehre eingeführt.
Soziale Einzelfallhilfe: Sie bezieht sich auf einzelne Individuen und Familien, betrachtet deren Bedürfnisse und Probleme – auch in Wechselwirkung mit der relevanten Umwelt – und versucht, die KlientInnen und Familien zur Problemlösung anzuregen. Dabei wird von folgenden Prinzipien ausgegangen: Annehmen und Akzeptieren; Individualisieren; individuelle Selbstbestimmung; dort anfangen, wo die KlientInnen stehen; mit den Stärken des Individuums arbeiten. Methodisch wird in drei Schritten gearbeitet (»Methodischer Dreischritt«): 1. Fallstudie/Anamnese; 2. Soziale Diagnose; 3. Behandlung.
Im Mittelpunkt dieser Arbeitsform stehen die helfende Beziehung und das Gespräch.
Einen großen Einfluss auf die Einzelfallhilfe übte seit den 1930er Jahren in den USA eine Zeitlang die Psychoanalyse aus. Besonders nach der Emigration vieler deutscher und österreichischer Psychoanalytiker in die USA nach den faschistischen Machtergreifungen in Deutschland und Österreich wurden psychoanalytische Ideen in der US-amerikanischen Sozialen Arbeit bedeutend. Die Psychoanalyse wurde als die wichtigste psychologische Bezugstheorie für das US-amerikanische Social Case Work aber schnell abgelöst durch die seit den 1950er Jahren wachsende Bewegung der humanistischen Psychologie. Des Weiteren gewann zu dieser Zeit bereits die Systemtheorie, und zwar jene des Soziologen Talcott Pasons, an Bedeutung.
Soziale Gruppenarbeit: Sie bezieht sich auf (sozial)pädagogische Gruppen (von Kindern und Jugendlichen) oder auf themenbezogene Gruppen in allen Bereichen Sozialer Arbeit. In der Gruppenarbeit werden einzelne Gruppenphasen (z. B. Anfangs-, Machtkampf-, Harmonie-, Differenzierungs- und Lösungsphase) unterschieden. Die Grundprinzipien der Gruppenarbeit sind: Die Gruppe dort abholen, wo sie steht, und sich mit ihr in Bewegung setzen; mit den Stärken des Einzelnen arbeiten; Zusammenarbeit ist besser als Einzelwettbewerb; Raum für Entscheidungen geben; erzieherisch notwendige Grenzen setzen; sich als Gruppenleiter überflüssig machen.
Die Gruppenarbeit hat (nach dem bedeutenden Developmental Model) vier Ziele: 1. durch die Gruppenerfahrung den einzelnen Mitgliedern Sicherheit, Anerkennung, Unterstützung und Hilfe zu geben; 2. Werte und Normen zu vermitteln; 3. Möglichkeiten der Konfliktlösung zu bieten; 4. einen Transfer der Gruppenerfahrungen auf das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
Soziale Gemeinwesenarbeit: Sie bezieht sich auf eine größere Anzahl von Menschen, die etwa durch räumliche Nähe miteinander verbunden sind, die durch gemeinsame Problemlagen aufgrund äußerer Bedingungen benachteiligt sind, die durch gemeinsames Planen und Handeln ihre Benachteiligungen aufzuheben versuchen oder die in Kommunikationsprozessen ihre Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Situation einsetzen wollen. Während der Gemeinwesenarbeit versuchen professionelle HelferInnen, die Selbsthilfepotenziale der Menschen anzuregen, damit diese nicht nur sich selbst, sondern vor allem die sozialen Strukturen, in denen sie leben, verändern, umgestalten können. Gemeinwesenarbeit bezieht sich also nicht unmittelbar auf einzelne KlientInnen, sie ist vielmehr die Arbeitsform/ Methode der Sozialen Arbeit, die sich auf spezifische (mehr oder weniger begrenzte) gesellschaftliche (strukturelle) Veränderungen bezieht. Diesbezüglich wirken SozialarbeiterInnen als BeraterInnen oder Vermittlerinnen, z. B. innerhalb von BürgerInnenbewegungen oder Stadtteilinitiativen.
Dritte Phase: Methodenkritik (etwa 1968–1975): In Zusammenhang mit der 68er Studentenbewegung beginnt auch in der Sozialen Arbeit eine allgemeine Kritik an den Methoden und Arbeitsformen. Kritisiert wird beispielsweise der Optimismus der 1950er Jahre bei der Übernahme der klassischen Arbeitsformen/Methoden aus den USA.
Außerdem wird von einigen Hochschullehrern an den Fachbereichen Sozialwesen der neu gegründeten Fachhochschulen die Wissenschaftlichkeit der klassischen Methoden angezweifelt. Diese Hochschullehrer kamen in der Mehrzahl nicht aus der Praxis der Sozialen Arbeit, was für die bisherigen MethodenlehrerInnen an den Höheren Fachschulen eine unabdingbare Voraussetzung war (vgl. Kersting 1997, S. 336 f.; Schiller 1997, S. 313 ff.).
Vierte Phase Ausdifferenzierung (1980er und 1990er Jahre): Zunehmend werden nun moderne psychotherapeutische Methoden (z. B. Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie und Familientherapie) für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit aufbereitet. Angesichts der professionellen Etablierung Sozialer Arbeit differenzieren sich vielfältige neue Methoden aus, die vor allem die methodischen Diskurse der heutigen Sozialarbeit prägen: z. B. lebensweltorientierte Sozialarbeit, systemische Beratung, Case Management, Empowerment, Mediation, Sozialmanagement, Selbstevaluation, Supervision. Darüber hinaus ist die Soziale Arbeit angesichts immer knapper werdender öffentlicher Kassen aufgefordert, ihre Hilfen stärker als zuvor an ökonomischen Effektivitäts- und Effizienzkriterien auszurichten, zu evaluieren und zu dokumentieren, ob und wie die Ergebnisse der Arbeit mit den Zielen übereinstimmen (Effektivitätsmessung und -dokumentation) und welcher Aufwand welchem Nutzen gegenübersteht (Effizienzmessung und -dokumentation).
Bei der Entwicklung der sozialarbeiterischen Methoden allgemein, aber vor allem bei der konzeptionellen Ausgestaltung der Sozialen Arbeit mit Einzelnen und Familien standen psychologische/psychotherapeutische Verfahren oft Pate. Daher möchte ich im Folgenden die drei Verfahren knapp erläutern, die auch noch heute Grundlage vieler sozialarbeiterischer Erklärungen und Handlungen in der Arbeit mit Einzelnen und Familien sind: die Psychoanalyse/Tiefenpsychologie, die nicht-direktive Beratung bzw. klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie sowie die systemische Familientherapie.