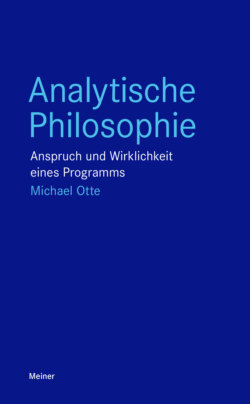Читать книгу Analytische Philosophie - Michael Otte - Страница 11
I.5
ОглавлениеDie wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts war einerseits vor allem eine philosophische Revolution, die darin bestand, dass die Mechanik »ins Zentrum der philosophischen Disziplinen gelangte« (S. Moscovici, Versuch über die menschliche Geschichte der Natur, Frankfurt 1982, S. 256; 272). Andererseits verwandelte sich die Mathematik aus einer Philosophie in ein universelles Organon der Wissenschaften und Künste, so dass also die wissenschaftliche Revolution als ein réarrangement des Verhältnisses von episteme und techne angesehen werden kann.
Dies zeigt sich beispielsweise sehr deutlich an dem zentralen Begriff dieser Entwicklung, dem Begriff der (stetigen) Funktion und an der Selbstreferentialität seiner Definition. Der spezielle Begriff einer stetigen, mathematischen Funktion ist nicht definierbar, ohne dass ganz allgemeine Ideen funktionaler oder gesetzmäßiger Beziehungen vorausgesetzt und herangezogen würden, so wie sie bereits bei Aristoteles anzutreffen sind. Diese allgemeinen Ideen sind andererseits nicht entwickelbar ohne die Konkretisierung durch die spezielle mathematische Explizierung (vgl. ausführlich M. Otte 1992, »Das Prinzip der Kontinuität«, Math. Semesterberichte, 39: 105–125, S. 110 ff.).
Galileo, Descartes und andere haben den allgemeinen Bewegungsbegriff des Aristoteles spezifiziert und in den Formen der symbolischen Algebra dargestellt. Der Kampf der alten mit der neuen Wissenschaft war insbesondere deshalb so intensiv, weil das ganze Begriffsverständnis sich nach der mathematisch-operativen Seite hin verschob. Aristoteles betrachtet die Natur als Prinzip der Bewegung (Aristoteles’ Physik, Buch I–IV, Hamburg 1987, S. 5). Er fasst den Bewegungsbegriff jedoch so weit, dass jede Art des Wechsels und der Veränderung darunter fällt, während die »Modernen« an der Mechanik und der exakten Vorausbestimmung mechanischer Bewegungen interessiert waren und deshalb den Begriff der Bewegung einengten und in den Formeln der symbolischen Algebra zu explizieren suchten. Dadurch wurde er zum Gegenstand formaler Berechnungen und zur Grundlage mechanischer Konstruktionen.
Der Funktionsbegriff und der Gesetzesbegriff, der durch ihn zum Ausdruck gelangt, sind andererseits untrennbar mit dem Prinzip der Kontinuität verbunden, denn die Bedeutung einer mathematischen Funktion liegt ebenso in den Beziehungen, die sie darstellt. Und hier ergibt sich nun eine Aporie, die sich im Gegensatz der zwei grundlegenden Prinzipien von Leibniz’ Philosophie ausdrückt: dem »Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren« einerseits und des Kontinuitätsprinzips andererseits (vgl. im Detail Kapitel V. 7.). Erst seit dem 19. Jahrhundert sind Mathematik und exakte Wissenschaft auf die Problematik dieser Komplementarität von symbolischem Ausdruck und objektiver Relation gestoßen, wenn auch die Wege und Meinungen durchaus gespalten blieben. Tatsächlich haben sich Logik und Mathematik in zwei Formen entwickelt. Heijenoort hat, im Anschluss an Freges Auseinandersetzungen mit Schröder, als erster sehr deutlich darauf hingewiesen: »Answering Schröder’s criticisms of Begriffsschrift, Frege states that, unlike Boole’s, his logic is not a calculus ratiocinator, or not merely a calculus ratiocinator, but a lingua characteristica« (J. v. Heijenoort 1967, »Logic as calculus and logic as language«, Synthese 17, pp. 324–330; vgl. Kapitel II.).
Bolzano, Frege und die sogenannte »Bewegung der arithmetischen Strenge« versuchten eine Art arithmetisch-logischen Transzendentalismus zu errichten, der die Arithmetik als universelle Sprache der Mathematik und die Logik als universal und als unhintergehbaren Kontext für jedes Denken und alle sozialen Interaktionen verstand. Darüber hinaus gingen diese »Universalisten« davon aus, dass der Logik ein universeller Gegenstandsbereich zugrunde liegt, so dass jedes logische Zeichen einen eindeutigen Referenten besitzt, was dann zu Paradoxien führte. Die Arithmetisierung verfolgt nicht zuletzt das Ziel, das Kontinuum, die nur unvollständig festgelegte und intuitiv erfassbare Realität, zu eliminieren und eine Beschreibungstheorie der Referenz zu etablieren. Eine Konsequenz dieser Haltung besteht darin, dass Frege den Satz und nicht die Theorie oder die Wissenschaft als ganze als den die Bedeutung stiftenden Kontext definiert.
Daneben gibt es die axiomatische Richtung der Mathematik, die eine Top-down-Strategie der Begründung verfolgt, indem sie die Regeln und Strukturen des Operierens verallgemeinert – Grassmanns Vektorkalkül ist hier ein frühes und markantes Beispiel – und weiter ausdehnt. Für diese algebraische Richtung ist und war auch die Logik nur ein weiterer Zweig der Mathematik, und die Mathematik selbst sollte in der axiomatischen Form ihre Bestimmung finden. Das Bedeutungsproblem wird dabei stets bezogen auf ein bestimmtes Modell oder Diskursuniversum hin interpretiert, welches dann je nach Bedarf oder Argumentationszusammenhang und Anwendungskontext zu variieren ist. Die Mathematik kennt Bedeutungen, aber eben nicht in dem fixierten, universalistischen Sinne. Eine axiomatische Theorie wird so zu einem Paar, bestehend aus formaler Struktur und intendierten Anwendungen oder Modellen. Die Intensionen (der Sinn) und Extensionen (die Referenz) mathematischer Ausdrücke sind in viel stärkerem Maße unabhängig voneinander, als beispielsweise Frege und Russell das wahrhaben wollen.
(a + b)2 = a2 + b2 + 2ab (1) = c2 + 2ab (2)
Dabei kann man den Modellbezug, sozusagen die Referenz oder Bedeutung der benutzten Symbole permanent und auch innerhalb einer einzigen Argumentation wechseln. Im Diagramm sehen wir einen Beweis des wohl berühmtesten Theorems der Geometrie bzw. der Mathematik überhaupt, des Satzes des Pythagoras. In der obigen Gleichung (1) wird der Ausdruck auf der linken Seite einfach entsprechend den normalen Rechenregeln der Arithmetik ausgerechnet und man erhält die rechte Seite der Gleichung. In der Gleichung (2) interpretiert man denselben Ausdruck dagegen als Fläche bzw. als Flächeninhalt des großen Quadrates und gewinnt die Gleichung dann aus dem Vergleich mit den vielen Flächen, die es gemäß dem diagrammatischen Schema aufteilen, und man erhält durch Vergleich von (1) und (2):
a2 + b2 = c2
Wenn nun dieses Resultat bezogen auf das rechtwinklige Dreieck mit den Seiten a, b, c interpretiert wird, ergibt das genau den gewünschten Satz. Sinn (Intension) und Referenz (Extension) mathematischer Ausdrücke besitzen in der Entwicklung der Mathematik eine viel größere Unabhängigkeit voneinander, als es die statische Betrachtungsweise der Logik und analytischen Philosophie vermuten lässt (vgl. dazu auch Kapitel II.9). Wir sehen so, dass für die mathematische und wissenschaftliche Entwicklung oder Erkenntnis die Komplementarität von Bedeutung und Operation, von Idee und Definition oder Spezifikation essentiell ist – einmal wurden die Symbole als Zahlen, zum anderen als geometrische Segmente interpretiert. Wenn man dagegen absolute »Was-ist«-Fragen stellt, kommt man selten zu einem erhellenden Ergebnis!
Es sollte vielleicht noch angefügt werden, dass bei unserer Argumentation eine ganze Reihe von Voraussetzungen implizit geblieben sind. Die wichtigste betrifft die durch Descartes begründete Strukturgleichheit von Zahlen und (geometrischen) Größen.
Somit wird jede Erkenntnis zu einem Prozess, und es geht darum, das Entstehen und den Wandel theoretischer Kontexte in den Blick zu bekommen. Eine auf der Grundlage dieser Komplementarität des Begriffs entwickelte Analyse des mathematischen und wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses macht es möglich, einige historische Entwicklungslinien der analytischen Philosophie neu zu zeichnen und die Orientierung derselben an Mathematik und Wissenschaft produktiv und weniger dogmatisch zu nutzen.
Insgesamt hat die Entwicklung von Philosophie und Logik tatsächlich an der Tradition festgehalten, der zufolge die philosophischen Probleme der Mathematik und exakten Naturwissenschaften den roten Faden abgeben, an dem sich die philosophische Reflexion abarbeitet, und wir folgen hier im Wesentlichen dieser Tradition. Die Protagonisten der neuen Logik und analytischen Philosophie, wie die Philosophen des Wiener Kreises oder Bolzano, Frege und Russell, und sogar die Vertreter des Neukantianismus, wie Natorp und Cassirer, entwickelten ihre wissenschaftsphilosophischen Vorstellungen ausgehend von der Tatsache, dass der Empirismus die Entwicklung der Mathematik nicht erklären kann. Dabei hat die analytische Philosophie diese Dualität überwiegend als »Dogma« (Quine) und nicht als sich entwickelnde Komplementarität verstanden.
Während der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts entstand das, was man seitdem »moderne« Mathematik nennt, und ein zentrales Merkmal derselben ist ihre Reflexivität oder ihre Funktion als Meta-Mathematik. »Charakteristisch für die Moderne, ganz allgemein, ist nicht, dass sie das Neue um seiner selbst willen erfasst, sondern charakteristisch ist die Voraussetzung einer in Bausch und Bogen angewandten Reflexivität, die natürlich auch die Reflexion über das Wesen der Reflexion selbst einschließt« (A. Giddens, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt 1999, S. 55).
In dem historischen Moment, in dem die Anwendung von Mathematik und Wissenschaft sich intensivierte, entstand – aufgrund der Bedeutsamkeit der Reflexion eben – zugleich das, was man »reine« Mathematik nennt, und in deren Folge auch eine Logik und eine Philosophie, die sich nur noch als sich selbst zugewandt verstand. In diesem Sinne wollte die analytische Philosophie seit Bolzano wissenschaftlich werden, indem sie zur Meta-Philosophie, zu einer Logik, zur Philosophie der Philosophie wurde. Und sie wollte das nicht zuletzt als Gegenreaktion gegen den deutschen Idealismus und seine Nachfolger. Denn dies Streben nach »Wissenschaftlichkeit« impliziert, dass sich die Philosophie nur noch mit ihren eigenen Methoden und Argumenten befasst. Wie G. Ryle sich ausdrückte, sollten die Philosophen von nun an »Philosophen der Philosophen« sein (G. Ryle, The Revolution in Philosophy, N.Y. 1956, p. 4). In einem ähnlichen Sinne meint Carnap: »Im Laufe der Diskussionen im Wiener Kreis hatte sich gezeigt, dass jeder Versuch einer präziseren Formulierung der uns interessierenden philosophischen Probleme bei solchen der logischen Analyse der Sprache endete. Da unserer Ansicht nach das Ergebnis philosophischer Fragestellungen die Sprache und nicht die Welt betraf, sollten diese Fragen nicht in der Objektsprache, sondern in der Meta-Sprache formuliert werden« (P. A. Schilpp, The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle 1963). Wir betrachten dann weder uns selbst noch Herrn X im jeweiligen unmittelbaren Weltverhältnis, sondern wir betrachten jedermann als Sender und Empfänger von sprachlichen Äußerungen. Ganz nach dem Motto, wenn ich den Zug verpasse, dann habe ich entweder eine falsche Auskunft erhalten oder dieselbe falsch verstanden. Uns erscheint das als eine Verkürzung, die eben das Problem der Beziehungen der Theorien zur Welt außer Acht lässt.
Die analytische Philosophie hatte sich für Logik und Sprache entschieden, und zwar im Sinne einer universalen Grundlage, nicht zuletzt deshalb, um die Philosophie »wissenschaftlich« zu machen, d. h. um Meinungsverschiedenheiten auszuschalten, indem man sich eben auf das Gesagte konzentriert. Es ist wie in der Mathematik: Das Verhältnis von Denken und Sein scheint immer unsicher, während andrerseits die Kopie des bereits Explizierten sicher vonstattengehen kann. So wird ein Kontext, der Kontext der logisch reglementierten Sprache, dann universalisiert.
So schreibt etwa Michael Dummett: »Was die analytische Philosophie in ihren mannigfachen Erscheinungsformen von anderen Richtungen unterscheidet, ist erstens die Überzeugung, dass eine philosophische Erklärung des Denkens durch eine philosophische Analyse der Sprache erreicht werden kann, und zweitens die Überzeugung, dass eine umfassende Erklärung nur in dieser und keiner anderen Weise zu erreichen ist. Vertreten werden diese Zwillingsgrundsätze von den logischen Positivisten wie von Wittgenstein in allen Phasen seiner Entwicklung, von der Oxforder Philosophie der normalen Sprache ebenso wie von der nach-Carnapschen Philosophie in den Vereinigten Staaten, wie sie von Quine und Davidson repräsentiert wird, obwohl große Unterschiede zwischen allen diesen Autoren bestehen« (M. Dummett, Ursprünge der analytischen Philosophie, Frankfurt 1992, S. 11).
Die analytische Philosophie hat eine Reduktion allen Denkens auf das Sprachliche und auf die Logik vorgenommen und so einen Kontext geschaffen, innerhalb dessen es dann möglich wurde, absolute Grenzen und Verbote oder Regeln aufzustellen und einen gesteigerten Scharfsinn zur Geltung zu bringen. Absolute Gesetze und Eindeutigkeiten gibt es nur in gut markierten Kontexten, man denke beispielsweise an Spiele. Die Mathematik ist sehr häufig mit dem Schachspiel verglichen worden. Im Schach gelten die Regeln absolut, und man kann nicht etwa die Bauern rückwärts oder den Turm diagonal über das Feld laufen lassen, selbst auf die Gefahr des »Untergangs« nicht. Und was den Fußball angeht, so haben wir sogar zur Kenntnis nehmen müssen, dass Regeln zu Toren führen können, wo real keine waren.
Ebenso häufig ist auch der Unterschied zwischen Schach und Mathematik erwähnt worden, der darin besteht, dass in der Mathematik stets verallgemeinert wird, d. h. fixe Regeln oder Strukturen durch allgemeinere oder je andere ersetzt werden. Beispielsweise weiß jedermann aus der Schule, dass 3 x 5 = 5 x 3 gilt, oder allgemeiner: a · b = b · a. Wenn wir aber den Kontext wechseln und von der gewöhnlichen Algebra zur Vektoralgebra oder zur Matrixalgebra übergehen, dann gilt diese Regel der Kommutativität der Multiplikation nicht mehr. Die Anwendung nicht-kommutativer algebraischer Systeme in der Physik kam mit der Elektrodynamik (Grassmann) und, vor allem, mit der Quantenmechanik (Heisenberg), und sie war eine große Neuerung. Es scheint plausibel, dass derartige Verallgemeinerungen der formalen Grundlagen der Theorie weder aufs Geratewohl vorgenommen werden noch absolut begründet werden können.