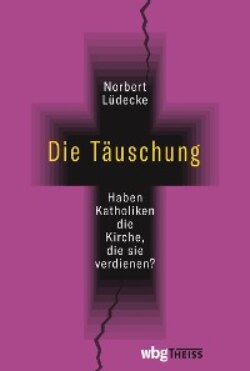Читать книгу Die Täuschung - Norbert Lüdecke - Страница 12
Prälatenkonzept zur Laieneinhegung
ОглавлениеDer ebenso weitsichtige wie politisch versierte und einflussreiche Kölner Prälat Wilhelm Böhler47 begann unmittelbar nach Kriegsende mit der Durchsetzung seiner Idee eines nationalen Spitzengremiums für das deutsche Laienapostolat mit zugleich zentraler gesellschaftspolitischer Funktion.48 Nach innen sollten die Laienaktivitäten koordiniert werden. Nach außen sollte eine hierarchisch legitimierte Laien-Repräsentation49 geschaffen werden, die als eng amtskirchlich gebundene „pressure-group des deutschen Katholizismus im vorparlamentarischen Raum“50 fungieren und so ein „aktionsfähiges und schnell reaktionsfähiges Instrument“51 der Hierarchie zur allfälligen Durchchristlichung der Gesellschaft sein sollte. Beide Stoßrichtungen nach innen wie nach außen sollten unter bischöflicher Kontrolle und so verkirchlicht sein.
Böhler verfolgte sein Anliegen auf zwei Gleisen: Einerseits forcierte er mithilfe ausgewählter Laienhelfer52 die Gründung bzw. Errichtung von Katholikenausschüssen und ihre Zusammenfassung in Diözesankomitees53, die unter amtlicher Führung katholische Interessen in der Öffentlichkeit vertreten sollten. Der Vorsitz wurde zwar Laien überlassen. Der Informationsfluss hin zur Hierarchie und eine angemessene Kontrolle wurden gleichwohl dadurch sichergestellt, dass jedem Ausschuss ein „Geistlicher Beirat“ angehören musste und verbindliche Beschlüsse nur mit Zustimmung des Dechanten, grundsätzliche sogar nur mit der des Bischofs möglich waren.54
Auf der anderen Seite warb Böhler beim ehemaligen Zentralkomitee der Katholikentage (Z.K.) unter geschickter Erinnerung an die guten alten Vorkriegszeiten um eine Beteiligung bei einem neuen erweiterten nationalen Laiengremium. Dieses Gremium konturierte er – allerdings nur intern Kardinal Frings gegenüber – schon sehr früh klar als in Struktur und Funktion das Z. K. völlig ersetzend:
„Das Zentralkomitee der Zukunft denke ich mir so, dass es besteht aus Vertretern der Diözesankomitees, Vertretern der katholischen Vereine, führenden Persönlichkeiten aus dem Laienstande, dem Weltklerus und dem Ordensklerus und Fachmännern für die einzelnen großen Aufgabengebiete“55.
Der zunächst bleibenden Skepsis in Teilen des Episkopats begegnete Böhler mit dem Hinweis, die Katholische Aktion sei von Papst Pius XII. keineswegs monopolistisch, sondern als durchaus mit eigenen teilkirchlichen Traditionen kombinierbar gedacht. Der Grundsatz der Katholischen Aktion: „nie gegen die Hierarchie, nie ohne die Hierarchie, sondern stets mit der Hierarchie“56 bleibe auch in dem neuen Gremium gewahrt. Es galt ihm als „selbstverständlich, daß keine Persönlichkeiten zum Zentralkomitee gehören können, gegenüber denen bischöfliche Bedenken bestehen, und keine Beschlüsse gefaßt werden können, die nicht auch die Zustimmung des Episkopates haben“57. Vor allem der Einbau der Katholikenausschüsse würde den Einfluss des Episkopats auf das Zentralkomitee erleichtern.58 Zudem wies er darauf hin, die engagierten Laien würden „sich den Weisungen des Episkopates gern und freudig fügen“. Bei ihnen herrsche „ein so großes Vertrauen in die Führung der Bischöfe, ein so großes Verantwortungsbewußtsein gegenüber Kirche und Öffentlichkeit und ein so freudiger Wille zur Einordnung“59.