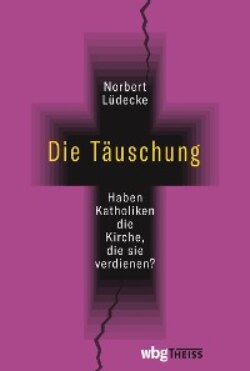Читать книгу Die Täuschung - Norbert Lüdecke - Страница 7
Und täglich grüßt der „Dialog“1
ОглавлениеEr ist ein Komödienklassiker, der Film Und täglich grüßt das Murmeltier von 1993: Der arrogante, egozentrische und zynische Protagonist sitzt in einer Zeitschleife fest. Er muss ein und denselben Tag immer wieder erleben, allmorgendlich beginnend mit demselben Radiosong. Was derzeit in der katholischen Kirche in Deutschland unter dem Label „Synodaler Weg“ firmiert, erscheint bei näherem Hinsehen und im zeitgeschichtlichen Kontext durchaus als eine ähnliche Zeitschleifenfixierung: Nur vermeintlich neu grüßt katholische Laien der „Dialog“, wenn die Kirche wieder einmal in einer Krise steckt.
Das ständehierarchisch organisierte römisch-katholische Religionssystem2 erweist sich auch hierzulande in aller Regel als beeindruckend stabil. Anders als in Kasten- oder Klassensystemen drängen untere Positionen nicht konsequent nach oben.3 Ein Grund dafür sind sicher Legitimationsmetaphern wie die vom „Leib Christi“, von „Hirt und Herde“ oder von der „Familie Gottes“, die den grundsätzlichen Positionsunterschied zwischen Klerikern und Laien immer noch erfolgreich als gottgewollt und katholisch identitätsbildend vermitteln. Es mag aber auch daran liegen, dass die katholischen Hierarchen in Deutschland jedes Mal, wenn es sporadisch doch zu brenzligen, von ihnen als systembedrohlich empfundenen Situationen kommt, zusammen mit willigen Laienhelfern ein geschicktes Handlungsskript zur Beruhigung der Lage abrufen. Solche Situationen gab es im Vorfeld der Gründung des heutigen Zentralkomitees der deutschen Katholiken 1952, im Nachgang zum berühmt-berüchtigten Katholikentag von 1968 in Gestalt der „Würzburger Synode“ (1972–1975), im Skandaljahr 2010 nach der Aufdeckung der Missbrauchsfälle im Berliner Canisius-Kolleg und auch wieder 2018 nach der Vorstellung der sogenannten MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Kleriker in den deutschen Diözesen. Wer diese Stationen mit ihren zeitgeschichtlichen O-Tönen abruft, erkennt schnell ein vertrautes, vielleicht zeitgemäß neu arrangiertes, aber doch immer gleiches Lied.
Als die deutschen Bischöfe im Nachkriegsdeutschland die Chance zu einer Rechristianisierung oder besser -katholisierung von Gesellschaft und Staat sahen, wussten sie: Sie brauchten dazu die Laien als politischen Arm. Eine entsprechende Rolle hatten diese schon seit dem 19. Jahrhundert in Gestalt eines breit entfalteten katholischen Verbandswesens in treuer Anhänglichkeit an die kirchliche Obrigkeit ausgefüllt. Dass sie im Laufe der Zeit an organisatorischer Stärke und mit Erfolgen in ihrem Kampf für die Rechte der Kirche auch an Selbstbewusstsein gewannen, rief allerdings den Argwohn der Bischöfe hervor. Und als nach dem Krieg bestimmte, auch politische Kreise an diese Tradition des Katholizismus anknüpfen wollten, setzten die Bischöfe entschlossen auf eine enge kirchliche Anbindung aller Laienaktivitäten. Streben nach Kontrolle, Angst vor Konkurrenz und das ständige Schreckgespenst einer Parlamentarisierung der Kirche und damit einer Bedrohung der Kirchenstruktur und vor allem der Position der Bischöfe ließen sie ein Konzept durchsetzen, das der politisch hochbegabte und umtriebige Kölner Prälat Wilhelm Böhler entworfen hatte: 1952 mündete das bischöfliche Bemühen um eine Domestizierung des Laien-Engagements in die Gründung des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken“ (ZdK). Dieses Organ, das aus engagierten Laien aus kirchlichen Gremien, Verbänden und dem öffentlichen Leben sowie aus Klerikern bestand, sollte nach innen die Laienaktivitäten koordinieren und nach außen als „pressure group“ in den vorparlamentarischen politischen Raum fungieren. Um die engagierten Laien nicht zu verprellen, sollte die Anbindung an die Bischöfe diskret erfolgen: Die Laien sollten das Gefühl haben, mit und in diesem Gremium zu führen und selbstständig zu handeln, ohne es tatsächlich zu sein. Statuarische Vorkehrungen wie die Verankerung von Klerikerpositionen, die den Einfluss und die Information der Bischöfe sicherten, sowie personelle und finanzielle Abhängigkeiten garantierten, dass auch bei langer Leine die bischöfliche Führung effektiv gewahrt blieb. Mit einem katholisch formatierten Dialogverständnis und einem ständehierarchisch durchwirkten Verständnis von Gemeinsamkeit sollten Engagement und Kooperationsbereitschaft der Laien erhalten werden. Mit dieser Einhegung des Laienapostolats gehört die Simulation von Partizipation zur DNA des ZdK.
1972–1975 reagierten die deutschen Bischöfe mit der Einberufung der Würzburger Synode auf die nächste heikle Situation: Auf dem II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) durfte über die Frage der erlaubten Methoden zur Empfängnisverhütung nicht diskutiert werden, weil diese einer Entscheidung des Papstes vorbehalten blieb. Die ließ nachkonziliar allerdings auf sich warten, wodurch sich im deutschen Katholizismus ein immer stärkerer Druck aus Hoffnungen und Befürchtungen aufbaute. Ohnehin angeregt durch die allgemeine Reformerwartung nach dem Konzil, hofften viele Katholiken, das bisherige Verhütungsverbot könnte aufgehoben werden, zumal die Ergebnisse einer Kommission zur Beratung des Papstes in dieser Frage mehrheitlich in diese Richtung zeigten. Je länger die päpstliche Entscheidung auf sich warten ließ, desto mehr wuchs allerdings auch die Befürchtung, der Papst könne auf der traditionellen Lehre beharren. Überdruck und Explosionsgefahr im Kirchenkessel drohten, als 1968 die „Pillen-Enzyklika“ Papst Pauls VI. mit ihrer Einschärfung des Verbots jeder künstlichen Empfängnisverhütung den schlimmsten Befürchtungen entsprechend alle diesbezüglichen Hoffnungen zerstörte. Ein so noch nie dagewesener Protest und Aufstand gegen die als autoritär und übergriffig empfundene Hierarchie war die Folge und fand seinen exemplarischen Ausdruck 1968 auf dem Essener Katholikentag. Die Bischöfe nahmen damals realistisch wahr, mit bloßer Papsttreue und nur formal begründeter Einforderung von Gefolgschaft riskierten sie völligen Kontrollverlust und Dauerschaden an ihrer Autorität. Was sie brauchten, war eine kontrollierte und dauerhafte Druckabsenkung. Dazu öffneten sie mehrere Ventile: Akut ließen sie auf dem Katholikentag 1968 der spontanen Erregung und dem Diskussionsbedarf freien Lauf. Bereits zuvor hatten sie schon Druck durch ihre schnell präsentierte „Königsteiner Erklärung“ entweichen lassen: In dieser ließen sich die Bischöfe so verstehen, als sei die eigene Gewissensentscheidung der Gläubigen bei der Wahl der Verhütungsmethode mit der Vorgabe des Papstes vereinbar; deutsche Katholiken wähnten deshalb die Bischöfe auf ihrer Seite. Erst später mussten sie realisieren, dass dies ein Missverständnis war.
Das entscheidende Ventil zu einer längerfristigen Befriedung war ein anderes: Schon im Umfeld des Essener Katholikentages hatte der Vorsitzende der Bischofskonferenz zusammen mit ZdK-Führungspersonen die Idee einer deutschlandweiten Synode, also eines Beratungsvorgangs, geboren und in schneller und konzertierter Vorbereitung verwirklicht. Sinn und Zweck der sogenannten Würzburger Synode (1972–1975) war, im Kontext von Demokratisierungsforderungen, die aus der Gesellschaft in die Kirche hinüberzuschwappen drohten, ein Format zu präsentieren, das Katholiken ein Aussprache- und Mitwirkungsforum bot, ohne jedoch die Autorität der Bischöfe anzutasten. Diese wollten sie ungeschmälert behalten, aber „dialogisch“ ausüben. Verwirklicht wurde das durch ein Statut, das die Synode zu einem Entscheidungsorgan machte und demokratieähnliche Mitbestimmung suggerierte, aber zugleich sehr geschickt dafür sorgte, dass die Kontrolle über Ablauf, Themen und Entscheidungen bei den Bischöfen blieb. Die Rechnung der Bischöfe und des willig kooperierenden ZdK ging auf und sorgte trotz des nicht behobenen Reformbedarfs für eine ambivalente Ruhe, die einerseits auf der Zufriedenheit derer beruhte, denen eine Aussprache vor und mit Bischöfen genügte, und andererseits auf der Erschöpfung und Enttäuschung derjenigen, die zu spät erkannten, dass sie sich über Jahre in einer Partizipationsattrappe engagiert hatten, die mit Demokratie nichts zu tun hatte und dies nach amtskirchlicher Überzeugung auch niemals haben durfte.
In dieser trügerischen Ruhe baute sich anschließend in einem längeren Prozess von zwei Seiten erneuter Druck auf. Zunächst hielt das ZdK über längere Zeit nicht zuletzt durch Ausgrenzung des Linkskatholizismus und der bleibenden heißen Eisen wie Priesterzölibat, Frauenrechte, Laienmitbestimmung und wiederverheiratete Geschiedene noch eine Konsensfassade aufrecht. Je mehr Katholiken sich allerdings politisch nicht mehr nur durch die Union vertreten sahen, in der das ZdK maßgeblich verankert blieb, und je deutlicher sich die klassischen, weil unbewältigten innerkirchlichen heißen Themen zurückmeldeten, desto weniger konnte sich das ZdK auf Dauer dem Veränderungsdruck entziehen. Es öffnete sich seit Ende der 1980er-Jahre nicht nur für die SPD wie später auch für die Grünen, sondern integrierte auch früher ausgegrenzte Reformanliegen.
Auf der anderen Seite setzte ein Restaurierungsprozess von oben ein. Die Würzburger Befriedung hatte Zeit und Raum für eine Neuetablierung der kirchlichen Autorität geschaffen, die sich nie aufgegeben, sondern nur zeitweilig machtopportunistisch zurückgenommen hatte. Das änderte sich entschieden, als im Konklave von 1978 ein Mann an die höchste (Voll-)Macht in der Kirche kam, der von Anfang an keinen Zweifel daran ließ, wer der Herr im katholischen Haus zu sein hatte. Zusammen mit seinem kongenialen Glaubenswächter Kardinal Ratzinger baute Papst Johannes Paul II. die autoritative Infrastruktur der katholischen Kirche durch das neue weltweite Kirchengesetzbuch, den Codex Iuris Canonici von 1983, maßgeblich wieder aus. Auf der doktrinellen Ebene schärfte er sensible Lehren wie die der Enzyklika „Humanae Vitae“ neu ein und verschärfte die Lehre von der Unmöglichkeit der Priesterweihe für Frauen durch ihr formales Upgrade zu einer unfehlbaren Lehre. Widerspruch aus der Theologie stieß auf entschiedene römische Sanktionen.
Ein Teil der Bischöfe versuchte zeitweilig, den erneuten Druckanstieg durch unterschiedliche diözesane Gesprächsereignisse zu mindern. Sie produzierten gleichwohl nur neue Enttäuschung und Unzufriedenheit und konnten weder das Kirchenvolksbegehren noch die Eskalation des Konflikts zwischen Papst und deutschen Bischöfen mit dem ZdK in der Frage der Schwangerenkonfliktberatung verhindern. Letzterer wurde durch ein Machtwort des Papstes entschieden, nicht gelöst. Während Teile der Laien an ihrer Gewissensentscheidung festhielten und Beratungsstellen in eigene Regie übernahmen, gehorchten mit einer Ausnahme alle deutschen Bischöfe dem Ausstiegsbefehl aus Rom. Die Probleme aber blieben unbewältigt, weil autoritär abgeblockt, und schwelten weiter.
Als die Aufdeckung der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg der Jesuiten das Skandaljahr 2010 einleitete, bestand erneut akute Explosionsgefahr. Und wieder griffen die Bischöfe zu der inzwischen auch in Österreich erprobten Kombination aus demonstrativer Gesprächsbereitschaft und mobilisierender Gemeinsamkeitsrhetorik, die zwar nie etwas mit Gleichberechtigung zu tun hatte, aber doch vielfach so verstanden wurde. Sie riefen einen über die Jahre 2011–2015 gestreckten „Gesprächsprozess“ aus, den sie nach Inhalt und Verlauf steuerten. Die Laien ließen sich erneut hoffnungsfroh darauf ein und realisierten erst spät im Verlauf oder erst am Ende, dass sie viel reden, aber nichts hatten entscheiden können, weil auch umgängliche Hirten an runden Tischen nicht zu Schafen mutierten, sondern ihre ständische Positionsmacht ungeschmälert behielten. Die Bischöfe bestimmten nach ihrem freien Ermessen ebenso darüber, ob es überhaupt einen Dialog gab, wie über den Ablauf und die Inhalte und über die Umsetzung etwaiger Ergebnisse.
Die Forderungen der Laien nach Partizipation blieben nicht nur unbefriedigt. Sie erhielten sogar eine permanente Energiezufuhr durch die anhaltende Missbrauchsproblematik und die Unfähigkeit und Unwilligkeit der Hierarchen, gegebenenfalls politische Verantwortung für Versagen zu übernehmen, geschweige denn persönliche Konsequenzen zu ziehen. Als im September 2018 durch die MHG-Studie Umfang und Qualität des Missbrauchsgeschehens einschließlich der Mahnung, sich etwaigen systemischen Risikofaktoren zu stellen, eine so deutliche empirische Bestätigung erhielten, stieg der ohnehin nicht stark abgesunkene Druckpegel schnell wieder bedrohlich an und die alten und wegen Nichtlösung immer noch aktuellen heißen Eisen meldeten sich jetzt unter dem systemischen Label mit enormer Massivität zurück. Überraschend ist nach allem nun nicht, dass die Bischöfe wieder reflexartig ein „Dialog“-Format namens „Synodaler Weg“ auflegten. Erstaunen kann vielmehr, dass das ZdK und seine Laien sich ein weiteres Mal darauf einließen, obwohl das Format keine der Bedingungen erfüllte, unter die sie ihre Teilnahme eigentlich gestellt hatten. Nun arbeiten sie wieder in einem langen Prozess mit, der eine nur relative Verbindlichkeit des Verfahrens und keinerlei Ergebnisverbindlichkeit produziert, sondern maximal Bitten an die Bischöfe und zum größten Teil an den Papst. Es kann verwundern, dass die Laien erneut eine „Partizipation“ akzeptieren, die strukturell vollständig im Rahmen der katholischen Klerikalmonarchie verbleibt, in der die Laien nur beratend am „decisionmaking“ beteiligt werden, das „decision-taking“ aber den Hierarchen vorbehalten bleibt.
Diese immer wieder neue Unterwerfung der Katholiken unter hierarchische Vorgaben provoziert die abschließende Frage, woran es liegt, dass katholische Gläubige immer weiter Reformen erhoffen, die seit so langer Zeit von der Hierarchie verweigert oder als gar nicht möglich, weil gegen die Identität der katholischen Kirche verstoßend, qualifiziert werden. Gibt es Faktoren, die Katholiken den Blick auf die kirchliche Realität verstellen, oder vielleicht eine spezifisch katholische Disponierung, diese Realität gar nicht sehen zu wollen? Warum haben katholische Laien keinen wirklichen Plan B für den Fall, dass ihre Erwartungen und Forderungen nicht erfüllt werden? Ist ihre Angst, sich von einer reformunfähigen Kirche distanzieren zu müssen, größer als ihr Leiden an der real existierenden Kirche? An dem genannten Faktorenbündel kann der Kanonist aufklärerisch arbeiten, bei der Frage nach dem Warum wäre es vergebene Liebesmüh. Hier bleibt es beim Dauerbejammern einer Kirche, auf die man heilsängstlich nicht verzichten kann.