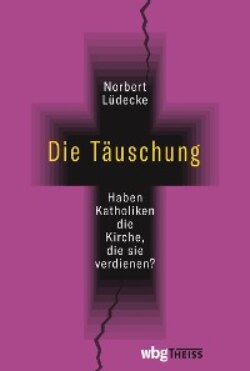Читать книгу Die Täuschung - Norbert Lüdecke - Страница 20
Can’t beat them? Join them!
ОглавлениеFür den Episkopat stellte sich die Frage, wie die offensichtliche Desintegration des deutschen Katholizismus und der kritische Druck akut verringert und auf längere Sicht verlässlich abgebaut werden könnten. Die Vorbereitungsgremien des Katholikentages hatten auf langen Sitzungen darüber beraten, wie die sich zuspitzende Lage im Griff bleiben konnte. Dies gelang weitgehend mit der Strategie, den heranstürmenden Kritikern offene Türen zu bieten, Foren und Diskussionen weit auf zu machen.92 Klar war aber, so der damalige Präsident des Katholikentages, Bernhard Vogel, im Rückblick und in kollaborativer Wir-Form: Geredet werden durfte, jeder Anspruch auf Geltung aber, „stieß auf unseren entschiedenen Widerstand. Wir wollten verhindern, dass aus kirchlicher Meinungsbildung kirchliche Willensbildung wurde. Die … Tradition … als Forum öffentlicher Meinung sollte erhalten bleiben und auch künftig fortbestehen“. Aber: „Aus Katholikentagen sollten nicht Kirchentage werden“93.
Auch die deutschen Bischöfe hatten sich im Vorfeld eilig in Königstein versammelt und mit einer Erklärung den Eindruck erweckt, als könnten Gläubige ausnahmsweise doch gewissensgedeckt empfängnisverhütende Mittel benutzen. Den Bischöfen war klar, dass eine vorbehaltlose Identifizierung mit „Humanae Vitae“ den Totalausverkauf ihrer eigenen Autorität bedeutet hätte. Die „Königsteiner Erklärung“ mit ihrer Komposition aus betonter Loyalität nach oben und der wenigstens impliziten Legitimierung eines Einzeldissenses nach unten dürfte – der Applaus auf dem Katholikentag spricht dafür – als stabilisierendes Ventil funktioniert und unmittelbaren revolutionären Druck abgebaut haben. Das verhinderte Eskalation und brachte wertvolle Zeit, um nach weiteren Möglichkeiten der Befriedung und der Re-Etablierung der kirchlichen Autorität insgesamt zu suchen.94
Die unterschiedlichen Nachbereitungen des Katholikentages machten deutlich: Essen durfte sich nicht wiederholen. Um eine solche Aufstauung und unkontrollierte Entladung von Diskussionsdrang zu verhindern, sollten künftig Gespräch und Diskussion auch zwischen den Katholikentagen auf unterer Ebene möglich sein. Geordnet und überschaubar sollten diskussionsfreudige Katholiken Dampf ablassen können und viele kleine Ventile gefährlichen Druck frühzeitig aus dem Kessel nehmen.95
Auch der Lagebericht Kardinal Döpfners auf der Herbst-Vollversammlung der DBK griff der Sache nach zur Ventiltaktik. Als zentrales Problem machte er die Krise der Autorität aus. Sie sei nicht nur punktuell, sondern grundsätzlich infrage gestellt. Um sie im unveränderlichen Gefüge der Kirche zu bewahren, empfahl er eine Doppelstrategie: Die Autorität solle einerseits kommunikativ ausgeübt werden, sich im Gespräch aktiv, vermittelnd, inhaltlich argumentierend öffnen. Anderseits solle sie als formale, direktive Autorität bewahrt werden, die Form und Gegenstand des Gesprächs bestimmt und begrenzt. Auch den Priestern gegenüber sei sie brüderlich auszuüben, ohne aber im Bedarfsfall auf die ernste Zurechtweisung (correctio fraterna) und gegebenenfalls auf disziplinäre Maßnahmen zu verzichten. Der Kontakt mit der Theologie sei zu intensivieren, um im Austausch etwaigen Gefährdungen vorzubeugen.96 Dass man nötigenfalls zum Eingreifen bereit war, zeigte der damals akute Fall des Religionspädagogen Hubertus Halbfas, dem Kardinal Frings das Nihil obstat für die Berufung an die Pädagogische Hochschule Rheinland in Bonn verweigert hatte und dessen „Fundamentalkatechetik“ von der Bischofskonferenz wegen glaubenswidersprechender und -gefährdender Inhalte öffentlich abgelehnt wurde.97
Für das Zusammenwirken von Klerus und Laien seien Formen zu finden, die eine stärkere Mitverantwortung ermöglichen, aber an den unverzichtbaren Grundstrukturen der Kirche festhalten sollten. Gesetzgeberische Befugnisse seien ausgeschlossen. Beratung sei ernster zu nehmen, aber man müsse die Mitte halten zwischen bloß scheinbarer Beteiligung und einer revolutionären Aufhebung der hierarchischen Ordnung. Demokratisierungstendenzen wie beim holländischen Pastoralkonzil98 lehnte Döpfner ab. Im Katholizismus könnten Meinungs- und Willensbildung repräsentativ und demokratisch erfolgen. „Für die Kirche als Kirche“ aber könnten auch ein Nationalkonzil, eine deutsche Pastoralsynode oder ein nationales Pastoralkonzil – Döpfners Begrifflichkeit wechselte – nur „eine qualifizierte gemeinsame Beratung mit dem Episkopat“ sein, „deren Ergebnisse vom Episkopat zu verantworten wären“99. Zur näheren Auswertung und Prüfung der Synodenidee regte er Gespräche mit verantwortlichen Laien an.