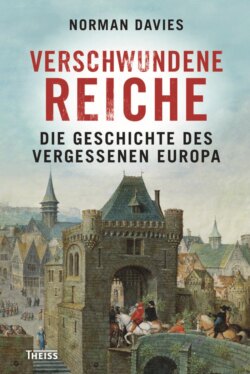Читать книгу Verschwundene Reiche - Norman Davies - Страница 20
II
ОглавлениеKaum ein Thema hat in der europäischen Geschichte für mehr Verwirrung gesorgt als die Frage, wie viele »burgundische Reiche« es gegeben hat. Nahezu alle historischen Untersuchungen oder Nachschlagewerke, die man dazu heranzieht, liefern widersprüchliche Informationen. Bereits 1862 fühlte sich James Bryce, Professor für Zivilrecht in Oxford, veranlasst, in seine wegweisende Studie über das Heilige Römische Reich eine spezielle Anmerkung »Über die burgundischen Reiche« aufzunehmen. »Es ist kaum möglich, eine geografische Bezeichnung zu nennen«, schrieb er, »die in der Vergangenheit mehr Verwirrung gestiftet hat und es heute noch tut …«15
Bryce war ein Mann von unermüdlicher Ausdauer und Gewissenhaftigkeit. Er stammte aus Glasgow, war Bergsteiger, ein Liberaler und Anhänger von Gladstone, Botschafter in den Vereinigten Staaten von Amerika und ein gewissenhafter Faktenprüfer. (Er bestieg einmal den Berg Ararat, um nachzuprüfen, wo Noahs Arche geblieben war.) In seiner berühmten »Anmerkung A« führt er jene zehn staatlichen Gebilde auf, die seinen Untersuchungen zufolge »zu bestimmten Zeiten und in unterschiedlichen Gebieten« den Namen »Burgund« trugen:
| I. | Das Regnum Burgundionum (Königreich der Burgunder), 406–534. |
| II. | Das Regnum Burgundiae (Königreich Burgund) unter den Merowingern. |
| III. | Das Regnum Provinciae seu Burgundiae (Königreich Provence oder Burgund), gegründet 877, »etwas ungenau Cisjuranisches Burgund genannt«). |
| IV. | Das Regnum Iurense oder Burgundia Transiurensis (Königreich Jura oder »Transjuranisches Burgund«), gegründet 888. |
| V. | Das Regnum Burgundiae oder Regnum Arelatense (Königreich Burgund oder Königreich Arelat), gebildet 937 durch den Zusammenschluss der Reiche III und IV. |
| VI. | Burgundia Minor (Herzogtum Klein-Burgund). |
| VII. | Die Freigrafschaft oder Pfalzgrafschaft Burgund (Franche-Comté). |
| VIII. | Die Landgrafschaft Burgund, Teil des Reiches Nr. VI. |
| IX. | Der Burgundische Reichskreis, errichtet 1548. |
| X. | Das Herzogtum Burgund (Bourgogne), das »immer ein Lehen der französischen Krone war«.16 |
Wie komplex dieses Thema ist, liegt auf der Hand, und schon eine kurze Beschäftigung mit der Anmerkung von Bryce weckt Zweifel. Doch dies war der erste Versuch, das Burgund-Problem in seiner Gesamtheit zu erfassen. Selbstverständlich sind weitere Nachforschungen erforderlich.
Das Königreich der Burgunder (Nr. I auf der Liste von Bryce) war eine relativ kurzlebige Angelegenheit. Es wurde von einem Stammesführer namens Gundahar in der ersten Dekade des 5. Jahrhunderts am westlichen Ufer des Mittelrheins gegründet. Er und sein Vater Gibica hatten ihren Stamm über den Fluss in das Gebiet des Römischen Reiches geführt, wahrscheinlich während des großen Barbareneinfalls im Winter 406/07, und schlugen sich anschließend auf die Seite eines lokalen Usurpators namens Jovinus, der sich 411 in Moguntiacum (Mainz) zum »Gegenkaiser« ausrufen ließ; Jovinus erklärte im Gegenzug die Burgunder zu »Verbündeten« seines Reiches. Nach Ansicht Roms allerdings waren alle diese Vereinbarungen unrechtmäßig.
Woher die Burgunder genau stammten, ist Gegenstand vieler wissenschaftlicher Spekulationen.17 Dass sie Ende des 4. Jahrhunderts am Main (unmittelbar östlich des Limes) lebten, ist in römischen Quellen dokumentiert, ebenso ihre Kriege mit den Alamannen. In einer Gedenkinschrift in Augusta Treverorum (Trier) wird ein gewisser Hanulfus erwähnt, der in römischen Diensten stand und Mitglied einer burgundischen Königsfamilie war. Die früheren Stationen der Wanderungen der Burgunder sind dagegen unklar. Eine Hypothese geht von einer Wanderung aus, die sich über vier Abschnitte erstreckte;18 der erste führte sie demzufolge im 1. Jahrhundert n. Chr. von Skandinavien an die untere Weichsel. In der zweiten Phase zogen sie zur Oder, in der dritten zur mittleren Elbe und in der vierten zum Main.
Die Burgunder sprachen eine germanische Sprache, die der Sprache der Goten ähnelte, die ebenfalls aus Skandinavien kamen. Wie die Goten hatten sie die arianische Form des Christentums angenommen und waren wohl auch mit der Wulfila-Bibel vertraut, einer Übersetzung des Neuen Testaments ins Gotische, die der aus Nordbulgarien stammende Bischof Wulfila angefertigt hatte.19 Zudem hatten sie durch den Austausch mit verschiedenen nichtgermanischen Stämmen den hunnischen Brauch des Kopfbandagierens übernommen, bei dem der Kopf von Mädchen von klein auf durch fest geschnürte Bandagen in eine längliche Form gebracht wurde. Dies hatte die unbeabsichtigte Folge, dass ihre Gräber von den Archäologen sofort erkannt wurden.
Den Mittelpunkt von Gundahars Königreich bildete die alte keltische Hauptstadt Borbetomagus (Worms); es erstreckte sich im Süden bis nach Noviomagus (Speyer) und nach Argentoratum (Straßburg). Die Neuankömmlinge, die ungefähr 80.000 Personen umfassten, gingen in der gallisch-romanischen Bevölkerung auf. Sie werden in dem angelsächsischen Gedicht Widsith erwähnt, in dem Herrscher aus dem 5. Jahrhundert aufgeführt werden. Widsith, der »Fernreisende«, behauptete, er habe das Reich Gundahars persönlich besucht:
| Mid Pyringum ic waes … ond mid Burgendum. Paer ic geag geþah. aer ic beag geþah. Me þaer Guðohere forgeaf Glaedlicne maþþum. Songes to leane. Naes þaet saene cyning! | Ich war bei den Thüringern … und bei den Burgundern. Dort schenkten sie mir einen Ring. Dort gab Gunthere mir Einen glänzenden Schatz Um mich für meine Lieder zu bezahlen. Er war kein schlechter König.20 |
Doch Gundahars Stellung war von Anfang an schwach. Sobald die römischen Behörden wieder Tritt gefasst hatten, entschieden sie, ihn zu vernichten. Im Jahr 436 holte der römische General Flavius Aetius, ein Diener von Kaiser Valentinian III., Attilas Hunnen ins Land und ließ sie die blutige Arbeit verrichten. Angeblich wurden 20.000 Burgunder getötet.
Das Massaker an den Burgundern ging in den Fundus der nordeuropäischen Mythen ein. Es hallt wider in zahlreichen nordischen Sagen; es liegt auch der Sage der Nibelungen zugrunde, oder wie die Nordmänner sie nannten, der Niflungar, der Nachfahren der Nefi und Verwalter eines legendären Burgunderschatzes. Gundahar kehrt hier wieder als Gunnar, und Gunnars Schwester Gudrun wird nach ihrer Heirat mit Atli (Attila) die Stammmutter eines berühmten Geschlechts.
In dem zur Lieder-Edda zählenden Atlilied (Atlaqviða) werden zahlreiche Ereignisse und Namen erwähnt, die charakteristisch sind für das 5. und 6. Jahrhundert, unter anderem auch Gunnar und Gudrun.21 In der germanischen Tradition dagegen ist das Niflheim (»Dunkle Welt«) von kriegerischen Riesen und Kleinwüchsigen bevölkert. Nybling ist der ursprüngliche Hüter des Schatzes; Gundahar wird zu Günter, Gudrun zu Kriemhild, und Kriemhild heiratet Siegfried (»Sieg des Friedens«), den Sohn von Sigmund und Sieglind. In diesen später entstandenen Mythen und Sagen werden die Burgunder oft noch als Franken bezeichnet. Das Nibelungenlied aus dem späten Mittelalter ist durch eine Mischung aus Fakten und Fantasie geprägt, doch der grundlegende historische Zusammenhang wird in der modernen Geschichtswissenschaft kaum noch bestritten:
Viel Wunderdinge melden die Mären alter Zeit
Von preiswerthen Helden, von großer Kühnheit,
Von Freund und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen,
Von kühner Recken Streiten mögt ihr nun Wunder hören sagen.22
Nach dem Massaker bei Borbetomagos verliert sich die Spur der Burgunder vorübergehend, doch bald taucht sie wieder auf in Berichten über die Schlachten zwischen Aetius und den Hunnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Gruppe von burgundischen Kriegern von den Hunnen gefangen genommen und zum Kriegsdienst gezwungen wurde, während andere unter dem neuen König Gundioch (reg. 437–474) in römische Dienste traten. Burgunder kämpften somit auf beiden Seiten in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Juni 451 (siehe dazu S. 31) zwischen dem römischen General Aetius und den Hunnen, wo Gibbon zufolge »das Schicksal der gesamten westlichen Zivilisation auf dem Spiel stand«. Nach seinem Sieg versprach Aetius Gundioch ein Reich in der Provinz Sabaudia (eine alte Form des heutigen Savoyen, siehe dazu Kapitel 8). Dieses Mal ließen sich die Burgunder mit offizieller Erlaubnis im Römischen Reich nieder, wenn vielleicht auch eine größere Zahl der Überlebenden von Borbetomagus ungeordnet nach Süden floh und die kaiserliche Zusage nur den vollendeten Tatsachen Rechnung trug. Sabaudia erscheint nicht auf der Liste von Bryce, und es stellt sich die Frage, warum er die Gebiete von Gundahar und Gundioch nicht als eigenständige Reiche erwähnte. Sie genügen seiner Definition eines geografischen oder politischen Namens, der »zu bestimmten Zeiten und in unterschiedlichen Gebieten« verwendet wird. Die Kenngrößen im Falle von Gundahar lauteten »Anfang des 5. Jahrhunderts, Niederrhein«, bei Gundioch »Mitte des 5. Jahrhunderts, Oberrhein und Saône«. Es gab keine Überschneidungen. Gundiochs Herrschaftsgebiet wird heute entweder als das »zweite föderierte Königreich« oder als das »letzte unabhängige burgundische Königreich« bezeichnet.23
Die Grenzen des zweiten burgundischen Reiches dehnten sich rasch aus. Das ursprüngliche Zentrum war Genava (Genf) am Lacus Lemanus (Genfer See), wo die Burgunder in ein Gebiet einwanderten, das kurz vorher durch die Vertreibung eines helvetischen Stammes frei geworden war. Kurze Zeit später wandten sie sich der Region am Zusammenfluss der Flüsse Arus (Saône) und Rhodanus (Rhône) im Herzen Galliens zu. Im Verlauf eines Jahrzehnts hatten sie sich in Lugdunum (Lyon), Divio (Dijon), Vesontio (Besançon), Augustodunum (Autun), Andemantunum (Langres) und Colonia Julia Vienna (Vienne) angesiedelt. Grenzfestungen in Avenio (Avignon) und in der Nähe des Rhône-Deltas sowie bei Eburodunum (Embrun) in den Bergen sicherten eine geschlossene territoriale Einheit mit herausragenden Verkehrsverbindungen.
Das wenige, was über die Burgunder zur Zeit ihrer Ankunft bekannt ist, stammt von einem gallisch-römischen Schriftsteller, der verfolgte, wie sie sich in seinem Heimatort Lugdunum niederließen. Sidonius Apollinaris dürfte 452, als er sie kennenlernte, ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein. In seinen Briefen erwähnt er die »haarigen Riesen«, die »sieben Fuß groß« waren und die »in einer unverständlichen Sprache reden«.24 über diese burgundische Sprache wissen wir noch weniger. Einige Worte wurden in Gesetzestexten festgehalten (siehe unten), und die Bedeutung der überlieferten Namen der burgundischen Herrscher ist entschlüsselbar. Gundoband bedeutet »Tapfer in der Schlacht«, Godomar heißt »Berühmt in der Schlacht«. Einige heutige Ortsnamen lassen sich auf einen Personennamen zurückführen, an den die skandinavische Nachsilbe -ingos angehängt ist. Das Dorf Vufflens im Waadt beispielsweise wurde als »Vaffels Ort« übersetzt.25 Das ist nicht viel, an das man anknüpfen kann.
In dem Jahrhundert, das zwischen dem Ende des ersten und dem Ende des zweiten Reiches lag, sind fünf Könige überliefert, die alle der alten Linie von Gibica entstammen:
Gundioch/Gundowech (reg. 437–474)
Chilperich I. (reg. 474–480)
Gundobad (reg. 480–516)
Sigismund (reg. 516–523)
Gundimar/Godomar II. (reg. 523–534)
In einer Römersiedlung in der Nähe von Genf wurden die Fundamente eines burgundischen Königspalasts entdeckt, der wahrscheinlich um das Jahr 500 entstanden ist und eine Halle und eine christliche Kapelle umfasst.26 Die Historizität von König Godomar wird durch einen Grabstein im alten Klosterfriedhof von Offranges in der Nähe von Evian bezeugt:
In hoc tumulo requiescat bonae memoriae errovaccus qui vixit anns XIII et mensis III et transit X KL septembris mavurtio viro clr conss sub unc conss brandobrigi redimitionem a dnmo gudonaro rege acceperunt.27
Der erste Teil der Inschrift ist klar. Ein Junge namens Ebrovaccus, 13 Jahre und vier Monate alt, der »in diesem Hügel liegt«, starb, als Mavortius Konsul war. Der zweite Teil hat zu vielerlei Spekulationen angeregt. »Godomar war König«, ein Stamm mit keltisch klingendem Namen, die Brandobrigen, wurde entweder freigelassen oder freigekauft. Die frühesten burgundischen Münzen wurden Anfang des 6. Jahrhunderts mit kaiserlicher Lizenz in Ravenna geprägt; sie zeigen Gundobads Monogramm und den Kopf des römischen (byzantinischen) Kaisers. Somit bringen sie sehr anschaulich den Status eines rex als eines anerkannten kaiserlichen Stellvertreters zum Ausdruck.28
Die Burgunderkönige betrieben eine geschickte Heiratspolitik. Gundioch verheiratete seine Schwester mit Ricimer (405–472), der zeitweilig Gehilfe von Flavius Aetius und de facto Gebieter des sterbenden Reiches war. In der folgenden Generation wurde Chilperichs Tochter Clothilda (474–545) mit Chlodwig verheiratet, dem König der Franken, zwölf Jahre bevor dieser bei Vouillé die Westgoten besiegte (siehe dazu S. 25ff.) Clothilda wurde später heilig gesprochen, weil sie ihren Gemahl dazu gebracht hatte, das Christentum anzunehmen. Sie ist in der Kirche St. Geneviève in Paris bestattet.29
Chlothildas Onkel Gundobad, der sich mit dem Titel eines römischen Patriziers schmückte, erlangte die volle Kontrolle über sein Erbe erst nach einem dreißigjährigen Familienstreit, im Zuge dessen das burgundische Königreich aufgeteilt wurde und drei Zentren – Lugdunum, Julia Vienna und Genava – die Regierungsgewalt beanspruchten. Dieser Bürgerkrieg schwächte den jungen Staat, mit dem die Franken und die Westgoten daher leichtes Spiel hatten.30 Gundoband verdankte seine römische Laufbahn seinem Verwandten Ricimer. Ihm wurde die kurzlebige Ehre zuteil, einen Kaiser, Glycerius, auf den Thron in Ravenna zu setzen. Doch später war er die meiste Zeit damit beschäftigt, sich mit seinen Verwandten zu streiten. Immerhin konnte er sich durch Tributzahlungen die Franken vom Hals halten. Sein Bruder Godegisel konnte sich, mit Chlothildas Mutter Caretana an seiner Seite, bis zum Ende des Jahrhunderts in Genava behaupten. Danach stellte er die Tributzahlungen an die Franken ein und konzentrierte sich auf den Aufbau der Kirche und die Gesetzgebung. Zwei Gesetzesbücher werden ihm zugeschrieben, das Lex Romana Burgundiorum und das Lex Gundobada.
Der Burgundische Codex (oder die Codices), der in 13 Manuskripten erhalten geblieben ist, ist bezeichnend für diese Zeit, in der die germanischen Stämme das Christentum annahmen, schriftkundig wurden und Gesetze kodifizierten.31 Anders als der Codex Euricianus (siehe oben S. 34) muss er als eine Ergänzung zum bestehenden römischen Recht betrachtet werden; er besteht aus einer Sammlung von Gewohnheitsrechten (mores) für die Burgunder und einer Reihe von Statuten (leges), die für die ehemaligen römischen Bürger galten, die unter den Burgundern lebten. Die moderne Variante des Burgundischen Codex besteht aus 105 »Konstitutionen« und vier zusätzlichen Verordnungen. Der Großteil der Gesetze wurde in Lugdunum von Gundobad verkündet und später unter Sigismund überarbeitet; sie behandeln eine Vielzahl von Themen, angefangen mit Geschenken, Mord und Befreiung der Sklaven bis zu Weinbergen, Eseln und Ochsen, die in Pfand gegeben werden. Für nahezu alle Vergehen wird ein Wiedergutmachungspreis genannt und eine weitere Summe, die als Bußgeld oder Strafe zu zahlen ist:
XII Mädchenraub
Wenn jemand ein Mädchen raubt, soll er gezwungen werden, den neunfachen Preis für ein solches Mädchen zu zahlen und er soll eine Strafe zahlen, die sich auf zwölf Solidi beläuft.
Wenn ein Mädchen, das geraubt wurde, unversehrt zu seinen Eltern zurückkehrt, soll der Entführer das sechsfache Wergeld für das Mädchen aufbringen; zudem soll die Strafe auf zwölf Solidi festgesetzt werden.
Wenn jedoch das Mädchen den Mann aus freiem Willen erwählt und in sein Haus kommt und er mit ihr verkehrt, soll er den dreifachen Brautpreis entrichten; wenn sie darüber hinaus unversehrt in ihr Elternhaus zurückkehrt, soll ihm alle Schuld erlassen werden.32
In einer dieser Konstitutionen werden ausführlich Regeln zum Aufstellen von Wolfsfallen mit gespannten Bogensehnen (tensuras) beschrieben (XLVI). In anderen wird festgelegt, welche Maßnahmen gegen Juden zu ergreifen seien, »die ihre Hand gegen einen Christen erheben« (CII), oder es wird eine Verdoppelung der Geldstrafe für Diebstähle oder andere Vergehen in Weingärten bei Nacht verfügt.33 Man beschäftigte sich ausführlich mit der Festlegung der Strafmaße:
– Für die Tötung eines Hundes: 1 Solidus
– Für den Diebstahl eines Schweins, Schafes, einer Ziege oder eines Bienenvolks: 3 Solidi
– Für die Vergewaltigung einer Frau: 12 Solidi
– Für das Abschneiden der Haare einer Frau ohne Grund: 12 Solidi
– Für die Ermordung eines Sklaven: 30 Solidi
– Für die Ermordung eines Zimmermanns: 40 Solidi
– Für die Ermordung eines Hufschmieds: 50 Solidi
– Für die Ermordung eines Silberschmieds: 100 Solidi
– Für die Ermordung eines Goldschmieds: 200 Solidi34
(Frauen wurden die Haare abgeschnitten, damit sie als Kriegerinnen kämpfen konnten.) Bis auf einige burgundische Begriffe wie Wergeld oder Wittimon war der Codex auf Lateinisch abgefasst. Mehrere Grafen bezeugten ihn mit ihren Siegeln, wodurch eine seltene Liste burgundischer Eigennamen entstand:
| Abcar Unnan Sunia Wadahamar Aveliemer | Viliemer Hildegern Gundemund Avenahar Sigisvuld | Widemer Walest Annemund Hildeulf Gundeful | Silvan Vulfia Coniarc Usgild Effo…35 |
Sigismund, einem Sohn von Gundobad, der das Christentum annahm und später von der Kirche heilig gesprochen wurde, wird häufig die Bekehrung seines gesamten Volkes zum Christentum zugeschrieben. Zusammen mit seinen Brüdern führte er einen erfolglosen Feldzug gegen die Franken, besser jedoch gelang ihm die Unterdrückung der arianischen Enklaven, die sich nach der Teilung des Reiches hatten halten können. Es wird angenommen, dass er seinen kleinen Sohn erdrosseln ließ, um ihn von der Thronfolge auszuschließen, und dass er, nachdem er von den Franken entführt worden war, in einem Brunnen in Coulmiers in der Nähe von Orléans sein Ende fand. Er wurde zum Märtyrer erklärt, und der Kult um seine Person verbreitete sich in weiten Teilen Europas.36 Zu seinen bedeutendsten Hinterlassenschaften gehört eine ausführliche Korrespondenz (um 494–523) mit seinem Chefberater, dem Erzbischof (und späteren Heiligen) Avitus von Vienne37 sowie die Gründung der Abtei Aganaum (heute St. Maurice-en-Valais), einem Ort des laus perennis, des »unaufhörlichen Gotteslobs«.38
Die Vorherrschaft des Katholizismus in Burgund wurde 517 durch das Konzil von Epaon (vermutlich Albon in der heutigen Dauphiné) bekräftigt, auf dem Avitus, dessen Briefe eine der sehr seltenen zeitgeschichtlichen Quellen bilden, Richtlinien für das gesellschaftliche und kirchliche Leben festlegte. Die Regeln, nach denen Arianer wieder in die Kirche aufgenommen werden konnten, wurden gelockert. Die Vorschriften für die Klöster und die Konvente wurden dagegen verschärft, ebenso jene, die sich auf Ehe und Blutsverwandtschaft bezogen. Letztere Maßnahme erzürnte Sigismund derart, dass er künftig der heiligen Kommunion in der Kirche fernblieb und seinen Übertritt zum Arianismus androhte. Erst nachdem der Bischof von Valence ihm geholfen hatte, von einer Krankheit zu genesen, lenkte er ein.39
Das (zweite) Königreich der Burgunder fand sein Ende nach dem Sieg der Franken in den scheinbar endlosen Fränkisch-Burgundischen Kriegen in den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts. Dass Clothilda, die burgundische Ehefrau von Chlodwig (Chlodwig starb 511), in diesen Kriegen eine wichtige Rolle spielte, wurde ihrer langjährigen Unterstützung für das Christentum zugeschrieben, aber auch ihrem politischen Engagement für ihre Söhne in deren Fehde mit ihren burgundischen Verwandten. Das Königreich wurde von den Franken angegriffen, zunächst aus dem Norden und dann, nach ihrem Sieg über die Westgoten bei Vouillé, auch aus dem Westen. Im Jahr 532 oder 534 wurde Gundimar von ihnen gefangen genommen, geächtet, verurteilt und hingerichtet, und sein Erbanspruch fiel an die Franken.
Mehr als drei Jahrhunderte unterstand das ehemalige burgundische Reich nun der fränkischen Oberherrschaft; in dieser Zeit verschwand der ursprüngliche Unterschied zwischen Franken und Burgundern und die fränkisch-burgundischen Oberherren vermischten sich mit der Kultur und der Gesellschaft der früheren gallo-romanischen Bevölkerung. Zwei Dynastien brachten die Nachkommen von Chlodwig und Chlothilda hervor. Die Merowinger, die bis 751 herrschten, führten ihre Herkunft auf Merewig oder Merovée zurück, den Großvater von Chlodwig, und trugen ihre Haare lang als Zeichen ihres königlichen Status. Die Karolinger, die von 751 bis 987 regierten, wurden als »Hausmeier« (Vorsteher der Palastverwaltung) am Merowingerhof in Jovis Villa an der Maas bekannt und stammten von dem berühmten Krieger Karl Martell ab. Ihr berühmtester Sohn war Karl der Große (reg. 768–814), dessen Reich sich von der Spanischen Mark bis nach Sachsen erstreckte und der sich vom Papst zum Kaiser krönen ließ.
In diesen Jahrhunderten vollzogen sich auch grundlegende sprachliche Veränderungen. Zu Zeiten von Chlodwig und Gundobad waren die alte fränkische und die skandisch-burgundische Sprache neben dem Latein der Gallo-Römer gesprochen worden. In der Zeit von Karl dem Großen wurden diese Sprachen durch mehrere neue Idiome ersetzt, die zur allgemeinen Kategorie des Francien oder »Altfranzösisch« gehören. Fränkisch überlebte nur in den Niederlanden als Vorläufer des Niederländischen und des Flämischen. Latein hielt sich in stilisierter Form als Kirchensprache und als Schriftmedium. Das Burgundische ging vollkommen unter. Die zahlreichen Varianten des Altfranzösischen werden gewöhnlich in zwei Gruppen unterteilt – die langues d’oïl und die langues d’oc, deren Namen sich aus der in diesen Sprachen üblichen Bezeichnung für »ja« ableiten. In ersteren ist aus dem lateinischen hoc illud im Laufe der Zeit oïl und daraus das moderne »oui« entstanden; in den langues d’oc, die auch als Okzitanische Sprache bezeichnet werden, entwickelte sich aus hoc das Wort oc für »ja«. Die Trennlinie zwischen oïl und oc verlief mitten durch das frühere burgundische Gebiet und ist auch heute noch auf der Sprachenkarte sichtbar.40
Innerhalb des fränkischen Herrschaftsbereichs gab es immer eine territoriale Einheit, die als »Burgund« bezeichnet wurde. Viele Merowinger stilisierten sich als Könige von »Francia et Burgundia« oder von »Neustrien et Burgundia«. (Neustrien war der frühmittelalterliche Name für die Region um Paris.) Ende des 6. Jahrhunderts errichtete einer der Enkel von Chlodwig und Clothilda, Guntram (reg. 561–592), ein eigenständiges Regnum Burgundiae, das eineinhalb Jahrhunderte Bestand hatte, bis es von Karl Martell unterworfen und seinem Reich einverleibt wurde. Dieses geheimnisvolle Fürstentum erscheint als Nr. II auf der Liste von Bryce, wenngleich man es besser als das »dritte Burgunderreich« bezeichnen müsste. Wahrscheinlich weil es nicht vollständig souverän war, wurde seine Existenz häufig ignoriert. Doch die beiden vorhergegangenen burgundischen Reiche waren auf ähnliche Weise Oberherren unterworfen gewesen.
Guntram (Guntramnus) ist eine interessante Figur, nicht weil er später heilig gesprochen wurde, sondern auch weil seine Armeen bis nach Britannien und Septimanien im Südwesten des Frankenreiches zogen. Als »König von Orléans« übte er eine Zeit lang sogar die Herrschaft über Paris aus. Er war ein Zeitgenosse des Bischofs und Chronisten Gregor von Tours, der sorgfältig die Entwicklungen während seiner Regentschaft aufzeichnete, die durch eine nicht enden wollende Abfolge von Kriegen, von dynastischen Streitereien, Morden, Intrigen und Verrat geprägt war. Guntrams Frauenbeziehungen waren ähnlich vielfältig wie seine militärischen Feldzüge:
Der ehrenwerte König Guntram nahm sicli zuerst eine Konkubine namens Venerande, eine Sklavin, die zu seinem Volk gehörte, mit welcher er einen Sohn namens Gundobad hatte. Später heiratete er Marcatrude, die Tochter von Magnar, und schickte seinen Sohn Gundobad nach Orléans. Doch als auch sie einen Sohn gebar, wurde Marcatrude eifersüchtig, so hieß es … und vergiftete [Gundobads] Trunk. Dadurch zog sie, nach dem Willen Gottes, den Zorn des Königs auf sich und wurde von diesem verstoßen. Daraufhin nahm er Austregild, die auch Bobilla genannt wurde, zur Frau. Sie schenkte ihm zwei Söhne, von denen der ältere Clothar und der jüngere Chlodomer genannt wurden.41
An einer Stelle unterbricht Gregor von Tours seine Schilderung und schiebt eine Beschreibung von Divio (Dijon) ein, das eine besondere Rolle in der burgundischen Geschichte spielt. Davor hatte er von Gregorius gesprochen, dem Bischof von Langres:
[Divio], wo Bischof [Gregorius] tätig war … ist eine Festung mit sehr robusten Mauern, mitten in einer Ebene errichtet, ein sehr schöner Ort, mit reichem und fruchtbarem Land, sodass … zur entsprechenden Jahreszeit eine Fülle von Erzeugnissen dort angeliefert wird. Im Süden fließt ein Fluss … der sehr fischreich ist, und aus dem Norden kommt ein weiterer kleiner Strom, der … unter einer Brücke hindurch … um den gesamten befestigten Ort herumfließt … und die Mühlen vor dem Tore mit bewundernswerter Geschwindigkeit antreibt … Die vier Tore weisen nach den vier Himmelsrichtungen, und 33 Türme schmücken die Mauer, die 30 Fuß hoch ist und 15 Fuß dick … Im Westen liegen Hügel, sehr fruchtbar und voller Weingärten, in denen ein solch edler Falerner erzeugt wird, dass [die Bewohner] den Wein von Ascalon verschmähen. Die Alten sagen, dass dieser Ort von Kaiser Aurelian gegründet wurde.42
Trotz dieser opulenten Umgebung verbrachte Guntram, wenn man Gregor Glauben schenken darf, seine letzten Lebensjahre mit Fasten, Beten und Weinen. Seine Hauptstadt war Cabillo (Chalons-sur-Saône), wo er in der Kirche St. Marcellus beigesetzt wurde. Durch spontane Akklamation seiner Untertanen wurde er zum Heiligen erklärt, und später wurde er zum Schutzpatron reuiger Mörder.
Ein Korrektiv zu den bisweilen als übertrieben frankenfreundlich eingestuften Darstellungen von Gregor bilden die Schriften von Marius d’Avenches (532–596), des Bischofs von Lausanne (des späteren St. Marius Aventicensis), der gleichermaßen für seine Frömmigkeit und seine Gelehrsamkeit bekannt war. Er war ein Beschützer der Armen und soll eigenhändig seine Äcker bestellt haben; als Gelehrter setzte er die Arbeit von St. Prosper von Aquitanien fort und erweiterte Prospers Weltchronik bis ins Jahr 581.43 Der bedeutendste Geistliche der Zeit war vermutlich St. Caesarius von Arles (gest. 542), ein wortmächtiger Prediger und Theologe. Geboren in Cabillo, studierte er in Lerinum und wirkte fast 40 Jahre als Primas von Gallien.44 Der irische Missionar St. Kolumban (um 540–615) schließlich dürfte ebenfalls zu Guntrams Lebzeiten in die Region gekommen sein. Er lebte zeitweise als Gast am burgundischen Hof und eine Weile als Eremit in den Vogesen.45
Auf dem Höhepunkt seiner Macht, um 587, beherrschte Guntrams Regnum Burgundiae den größten Teil von Gallien, einschließlich Bordeaux, Rennes und Paris, ebenso wie das frühere Burgund von Gundobad. Doch das Reich erwies sich als zu groß und als überdehnt und lud daher seine Nachbarn zu Plünderungszügen ein. Guntrams kriegerische Nachfolger vollzogen mehrere komplizierte Thron- und Gebietswechsel. Mehrere Herrscher werden von den Chronisten als Könige von Burgund, Neustrien und Burgund oder als Könige »aller Franken« bezeichnet; neben Guntram gehören dazu Childebert II. (reg. 592–595), Theuderich II. (reg. 595–613), Sigebert (reg. 613), Chlothar II. (reg. 613–629), Dagobert (reg. 629–639), Chlodwig II. (reg. 639–655) und Chlothar III. (reg. 655–673).
Einige Abschnitte der Merowinger-Herrschaft liegen weitgehend im Dunkeln, doch ein Chronist, der als Fredegar, Fredegarius oder Pseude-Fredegarius (gest. um 660) bekannt ist, wirft einen Lichtblick auf das dritte Viertel des 7. Jahrhunderts. Er lebte in einem Kloster, möglicherweise in Chalons oder Luxueil, und versuchte zunächst einige bereits bestehende Chroniken »zu verbessern«. Ab 624 erstellte er in 18-jähriger Arbeit einen ausführlichen Kommentar über die Ereignisse der Zeit, der deutlich zeigt, dass in allen Schichten der fränkisch-burgundischen Gesellschaft die Blutrache gepflegt wurde. Ein Satz von Attila ist in diesem Zusammenhang sehr treffend: »Quid viro forti suavis quam vindicta manu querere?« (»Was könnte einen starken Mann mehr erfreuen, als eine Blutfehde zu pflegen?«). Fredegar erwähnt einen Vorfall, an dem der byzantinische Kaiser beteiligt war und der anschaulich belegt, wie wenig ein menschliches Leben wert war. Nachdem zwei burgundische Gesandte bei einer Prügelei in dem von Byzanz beherrschten Karthago getötet worden waren, bot Kaiser Maurikios eine Wiedergutmachung in Gestalt von zwölf Männern an, mit denen die Burgunder »tun könnten, was sie wollten«.46 Mit besonders heftigen Schmähungen bedenkt Fredegar die westgotische Fürstin Brunechildis, die aus Hispania an den burgundischen Hof kam und dort angeblich Gewalt und Hass schürte: »Tanta mala et effusione sanguinem a Brunechildis in Francia factae sunt.47
Fredegars Darstellung endet mit der Geschichte des Flaochad, genere Franco (gebürtiger Franke) und Majordomus, der sich an einem burgundischen Adeligen namens Willebad rächen wollte. Mit ihren Anhängern im Gefolge trafen die beiden vor den Mauern von Augustodunum aufeinander:
Berthar, ein transjuranischer Franke, … griff Willebad als Erster an. Und der Burgunder Manaulf, der vor Wut mit den Zähnen knirschte … trat mit seinen Männern nach vorn, um zu kämpfen. Er war einst mit Berthar befreundet gewesen und sagte nun »Komm unter mein Schild, und ich werde dich schützen« … und er hob sein Schild, um ihm Deckung zu bieten. Doch [Manaulf] stieß mit seiner Lanze nach seiner Brust … Als Chaubedo, Berthars Sohn, sah, dass sein Vater in Gefahr schwebte, stieß er Manaulf zu Boden, durchbohrte ihn mit seinem Speer und tötete alle, die seinen Vater verwundet hatten. Und mit Gottes Hilfe rettete der Junge dadurch Berthar vor dem Tode. Wer von den Herzögen seine Männer lieber nicht auf die Seite Willebads Seite gestellt hatte, plünderte nun seine Zelte … Die Männer, die sich nicht am Kampf beteiligt hatten, schafften große Mengen Goldes und Silber sowie Pferde und andere Gegenstände fort.48
Ein Historiker bemerkte dazu: »Das Erstaunliche an der frühmittelalterlichen Gesellschaft ist nicht der Krieg, sondern der Frieden.«49
Zu Fredegars Zeiten wurden die Merowinger zu reinen Marionetten der Hausmeier und Grafen in den königlichen Palästen. Zudem verlagerte sich das politische Machtzentrum in das fränkische Austrasien (das Ostfrankenreich). Dagobert, der über Neustrien herrschte (das »neue Land im Westen«), wurde in einem französischen Kinderlied verspottet: »Le Bon Roi Dagobert/A mis sa Culotte à l’envers« (»Der gute König Dagobert/trug seine Hose verkehrt herum.«)50 Er machte Paris zu seiner Hauptstadt. Eine entscheidende Schlacht bei Tertry in der Picardie im Jahr 687 verfestigte die Unterordnung Burgunds unter Austrasien.
Anfang des 8. Jahrhunderts wurde von Bischof Savarich von Auxerre eine separatistische burgundische Bewegung ins Leben gerufen, deren Aktivitäten aber gerade zu jenem Ergebnis führten, das sie hatte vermeiden wollen. Karl Martell (688–741), der Begründer nicht nur der Dynastie der Karolinger, sondern maßgeblich auch des karolingischen Reiches, fiel über Burgund her, um es gefügig zu machen. Nachdem er aus der historischen Schlacht gegen die Sarazenen bei Tours im Jahr 732 als Sieger hervorgegangen war, vertrieb er diese auch aus ihren Festungen in der Provence und im Languedoc. Die Erstürmung der von den Sarazenen gehaltenen Stadt Arles im Jahr 736 bildete einen der Höhepunkte dieses Feldzugs:
Nachdem sie ihre Truppen bei Saragossa zusammengezogen hatten, waren die Muslime im Jahr 735 in das fränkische Gebiet eingefallen, hatten den Rhein überquert und Arles erobert und geplündert. Von dort stießen sie in das Herz der Provence vor, was zur Einnahme von Avignon führte. … Muslimische Soldaten plünderten Lyon, Burgund und Piemont. Abermals eilte Karl Martell zu Hilfe und eroberte auf zwei Feldzügen in den Jahren 736 und 739 den Großteil der verlorenen Gebiete zurück. … Er setzte den bedrohlichen Vorstößen der Muslime über die Pyrenäen [ein für alle Mal] ein Ende.51
Er zerstörte aber auch die Hoffnung, dass das Regnum Burgundiae in naher Zukunft wieder auferstehen könnte.
Im Jahrhundert nach Karl Martell blühte das Frankenreich zunächst auf, geriet dann in Schwierigkeiten und zerfiel schließlich. Karl der Große hielt sich die meiste Zeit entweder im Norden, in Aachen, auf oder war mit Konflikten an der Peripherie seines Reiches beschäftigt, mit Kriegen gegen die Mauren, die Slawen und die Awaren, und mischte sich kaum in die Angelegenheiten Burgunds ein. Doch 773 versammelte er im burgundischen Genf eine große Armee für seinen lombardischen Krieg. Ermutigt durch Unterstützungsbekundungen des Papstes, zog er mit seinen Truppen in zwei großen Marschkolonnen über die Alpen, wobei eine den Pass des Mont Cenis und die andere den Großen Sankt Bernhard überquerte. Nachdem er Pavia, die Hauptstadt der Lombardei, nach langer Belagerung niedergeworfen hatte, kroch er als Büßer auf den Knien die Stufen des Petersdoms hinauf. Später schuf er in Rom den ersten Kirchenstaat.52
Wie es unter seinen Vorfahren üblich gewesen war, beabsichtigte auch Karl der Große, sein Reich zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Am Ende blieb das Reich jedoch als Einheit erhalten, da nur einer seiner Söhne überlebte; erst 843 wurde es schließlich unter seinen drei Enkeln geteilt. Die Teilungen des Frankenreiches durch den Vertrag von Verdun sollten für lange Zeit bestehen bleiben und die europäische Geschichte nachhaltig beeinflussen. Einer der Enkel erhielt das westfränkische Reich, aus dem sich später das Königreich Frankreich entwickelte. Ein anderer bekam das ostfränkische Reich, aus dem schließlich Deutschland erwuchs. Der älteste Enkelsohn erhielt einen langen Streifen in der Mitte und zugleich die Kaiserwürde. Das »Mittelreich« (Lotharingien) von Lothar setzte sich aus drei Gebieten zusammen. Ein Territorium im Norden erstreckte sich von der Nordsee bis nach Metz, wofür sich der Name Lotharingien (Lothringen) einbürgerte. Der zweite Teil, der in der Mitte lag, war ein erweitertes »Burgundia« einschließlich der Provence. Das dritte Gebiet war ein langer Schlauch, der sich nach Süden durch Italien und bis nach Rom erstreckte. Als integrierte Einheit war Lothars Herrschaftsgebiet ziemlich kurzlebig, doch seine Bestandteile konnten sich lange Zeit der Angliederung an Frankreich oder an Deutschland entziehen. Burgund erwies sich am widerständigsten.
In der karolingischen Geschichte spielte die Zahl drei eine wichtige Rolle; dreimal gab es eine dreifache Reichsteilung. Man kann sich leicht merken, dass jeder der Enkel von Karl dem Großen ein Drittel erhielt und dass Lothars »Mittelreich« aus drei Teilen bestand. Doch der dritte Schritt wird häufig vergessen. Fünfzig Jahre nach dem Vertrag von Verdun wurde das ehemalige Regnum Burgundiae, das jetzt das Mittelstück des Mittelreiches bildete, abermals in drei Teile geteilt. (Die Eselsbrücke dafür lautet »3 × 3 × 3«.) Diese letzte Teilung erfolgte in drei Stadien – in den Jahren 843, 879 und 888 [Verträge von Ribemont, d. Red.] – und brachte drei neue Reiche hervor: das Herzogtum Burgund im Nordwesten, das Königreich Niederburgund im Süden und das Königreich Hochburgund im Nordosten.
Die erste Aufspaltung des Reiches von Karl dem Großen im Jahr 834 war daher nur der erste Schritt in einem längeren Prozess. Lothar erhielt zwar den größten Teil des burgundischen Reiches, einschließlich Lyon, aber ungefähr ein Achtel wurde dem Westfrankenreich zugeschlagen. Die Ausgliederung dieses strategisch bedeutsamen Teils, der aus dem oberen Tal des Flusses Saône bestand und auch Guntrams Hauptstadt Chalon umfasste, war eine der wenigen Bestimmungen des Vertrages von Verdun, die sich als dauerhaft erwies, und verschaffte den neuen Herrschern einen Brückenkopf an den Südhängen der kontinentalen Wasserscheide. Somit verfügten die Streitkräfte des Westfrankenreiches und später die Armeen Frankreichs über ein geschütztes Einfallstor nach Italien.
Im Vertrag von Verdun erhielt dieses neue Territorium des Westfrankenreiches den Namen Regnum Burgundiae, doch diese Bezeichnung war juristisch praktisch bedeutungslos, denn dem Gebiet wurde lange Zeit kein besonderer Status verliehen. Eine dauerhafte Lösung wurde erst in den 880er-Jahren gefunden, als im Westfrankenreich die Verwaltungsstrukturen reformiert und Herzogtümer und Grafschaften gebildet wurden. Dabei wurden sieben Prinzipate eingerichtet, an deren Spitze ein dux (Herzog) stand, dem eine Vielzahl kleiner und großer Grafen untergeordnet war. Das Herzogtum Burgund nahm nun seinen Platz ein neben Aquitanien, der Bretagne, der Gascogne, der Normandie, Flandern und der Champagne. Es verkörperte Burgund Nr. X auf der Liste von Bryce, wenngleich es chronologisch das vierte burgundische Reich war.
Erwartungsgemäß blieb das Herzogtum nicht von Konflikten verschont. Die Hauptfigur in einer Reihe von komplizierten Auseinandersetzungen war Richard Justitiarius, genannt »der Gerichtsherr« (um 850–921), ein Bruder der westfränkischen Königin Richildis, der Ehefrau von Karl dem Kahlen. Richard, dessen Familiensitz in Autun lag, reiste nach Rom, als sich Karl um die Kaiserwürde bemühte, wurde schließlich mit der Verwaltung des (westfränkischen) Burgund beauftragt und erhielt zunächst den Titel marchio (Marquis oder Markgraf) und später den Titel Herzog. Berühmt wurde sein Bekenntnis auf dem Sterbebett: »Ich sterbe als Räuber, aber ich habe das Leben ehrbarer Männer verschont.«
Nach 1004 übernahmen die französischen Könige die direkte Herrschaft über das Herzogtum von den Nachkommen des Gerichtsherrn. Manchmal wurde das Herzogtum als Lehen vergeben, andere Male unterstand es dem König persönlich. Bis 1361 gab es zwölf Herzöge, angefangen mit Robert le Vieux (gest. 1076) bis zu Philippe von Rouvres (reg. 1346–61). Zu den abhängigen Vasallen gehörten die Grafen von Chalons, von Mâcon, Autun, Nevers, Avallon, Tonerre, Senlis, Auxerre, Sens, Troyes, Auxonne, Montbéliard und Bar; alle diese Fürstenhäuser können auf eine lange, wechselvolle Geschichte zurückblicken. Später wurde das Verwaltungszentrum des Herzogtums nach Dijon verlegt, das an einem nach Süden fließenden Nebenfluss der Saône liegt, der passenderweise Bourgogne heißt und über das Plateau de Langres den Zugang zur Champagne oder flussaufwärts zum Oberlauf der Seine und nach Paris ermöglicht.53
Im Herzogtum Burgund gab es bereits altehrwürdige Klöster, doch nun kamen noch neue hinzu. Die 910 gegründete Abtei Cluny, die der Regel des hl. Benedikt folgte, gilt als Ausgangspunkt bedeutender abendländischer Klosterreformen; sie war die Alma Mater von drei oder vier Päpsten.54 Die Abtei Tournus, ebenfalls im 10. Jahrhundert gegründet, bewahrte die Überreste des hl. Philibert, der den Märtyrertod gestorben war. Die Abtei Cîteaux, das Mutterhaus des Zisterzienserordens, entstand im Jahr 1098. Der hl. Bernhard von Clairvaux (1090–1153), ein späterer Förderer der Tempelritter, trat als junger Mann in dieses Kloster ein,55 und am 31. März 1146 rief er im großen Saal der Abtei Vézelay zum Zweiten Kreuzzug auf. Die Abtei Pontiguy am Fluss Yonne stammt ebenfalls aus der Zeit Bernhards.
Den Mönchen dieser burgundischen Klöster wird auch die Wiederbelebung der in Vergessenheit geratenen Weinbaukultur zugeschrieben. Sie waren nicht die Pioniere des Weinbaus, denn schon zu Zeiten König Guntrams wird von der Schenkung eines Weinbergs an die Kirche berichtet. Doch die Mönche konsumierten Wein bei der heiligen Kommunion, und an den Hängen der Côte d’Or oder der »Côte de Baune« bauten sie zielstrebig Weingärten von unübertroffener Qualität auf; sie erfanden sowohl die Produktionsmethoden als auch die Fachbegriffe des cru, des terroir und des clos, die zeitlose Gültigkeit erlangen sollten. Die roten Burgunderweine werden aus der Traube Pinot Noir gewonnen; die meisten Lagen, die heute die Liste der Grand Crus anführen, wie etwa die Domaine de la Romanée-Conti in der Nähe von Vosne, die einst zur Abtei Saint-Vivant gehörte, Aloxe-Corton, die vom Domkapitel Autun in Bewirtschaftung genommen wurde, oder Chambertin, die von der Abtei de Bèze begründet wurde – sie alle begannen als mittelalterliche kirchliche Unternehmungen. Die Weißweine aus Chablis wurden von den Mönchen von Pontigny entwickelt. Der Clos de Vougeot, der erstmals von den Mönchen von Cîteaux angebaut wurde, hatte von 1153 bis zur Französischen Revolution nur einen einzigen Eigentümer.56
Chanter le vin (»den Wein durch den Gesang feiern«) gehört seit jeher zu den kulturellen Traditionen des Herzogtums Burgund. Viele der zeitlosen französischen Trinklieder, wie beispielsweise »Chevalier de la Table Ronde« oder »Boire un petit coup« stammen aus Burgund; in ihnen wird eine Kultur des guten Weins, des guten Essens, der guten Gesellschaft und nicht zuletzt der guten Unterhaltung gepflegt:
Le Duc de Bordeaux ne boit qu’ du Bourgogne,
mais l’Duc de Bourgogne, lui, ne boit que de l’eau,
ils ont aussitôt sans vergogne
un verr’ de Bourgogne contr’ le port de Bordeaux.
(»Der Herzog von Bordeaux trinkt nur Bourgogne,/aber der Herzog von Bourgogne trinkt nur Wasser/daher hatte keiner Grund zu klagen, als sie tauschten/ein Glas Bourgogne gegen den Port aus Bordeaux.«)57
Unterdessen war östlich des aufstrebenden Herzogtums der Großteil des früheren burgundischen Königreiches im Chaos versunken. Nach dem Tod Lothars I. im Jahr 855 folgten mehrere Teilungen, Wiedervereinigungen und erneute Teilungen. Ein kurzlebiges territoriales Gebilde jedoch hinterließ dauerhafte Spuren. Unter Lothar II. (reg. 835–869) wurden die südlichen und westlichen Bezirke einschließlich Lyon und Vienne zu einem neuen Regnum Provinciae zusammengeschlossen, das dadurch die Bezeichnung »Niederburgund« erhielt. In der Folge nannten sich die im Norden und Nordosten gelegenen Gebiete »Hochburgund«. Die Grenzen veränderten sich nach kurzer Zeit, die Namen aber blieben.
Das Königreich Provence, das 879 geschaffen wurde und auch Königreich Niederburgund – le Royaume de Basse-Bourgogne – genannt wurde, hatte mit einer kurzen Unterbrechung 54 Jahre Bestand. Sein Territorium umfasste das Rhône-Tal von Lyon bis nach Arles und die ursprüngliche römische Provinz bis zum Fuß der Meeresalpen. Kulturell war es zur Hälfte burgundisch und zur anderen Hälfte provenzalisch geprägt, wodurch eine neue Sprache entstand, das Frankoprovenzalische. Das bedeutendste Verwaltungszentrum war Arelate (Arles). Dies war der fünfte burgundische Staat und das vierte Königreich (nach Bryce die Nr. III).
Die ersten Jahre dieses Reiches wurden geprägt von Graf Boso (reg. 879–887), der ebenso wie sein jüngerer Bruder Richard Justitiarius dank seiner Verwandtschaft mit dem Frankenkönig und künftigen Kaiser Karl dem Kahlen in die politische Führungsschicht aufsteigen konnte. Er war zunächst Graf von Lyon, doch während Karls Italienfeldzug 875–877 wurde ihm das Amt eines missus dominicus (Gesandter oder Botschafter) übertragen, und er konnte ein enges Verhältnis zum Papst aufbauen. Papst Johannes VIII. adoptierte ihn als Sohn, und Boso begleitete den Pontifex 878 auf seiner Reise in das Westfrankenreich. Als das Westfrankenreich im Jahr darauf innerhalb von 18 Monaten den zweiten König aufgrund einer plötzlichen Krankheit verlor, fasste Boso den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Er kehrte in die Provence zurück und überzeugte die dortigen Bischöfe und die Großen des Reiches, ihn auf einer Synode durch eine »freie Wahl« zum König von Niederburgund zu proklamieren. Er bediente sich der Formel »Dei Gratia id quod sum« (»Dank der Gnade Gottes bin ich, was ich bin«), die seine Auserwähltheit zum Ausdruck bringen sollte. Bosos Handstreich stieß auf Widerstand, doch letztlich konnte er sich behaupten. Er starb 887 und wurde in Vienne beigesetzt; aus seiner Familie, den »Bosoniden«, gingen schließlich drei einflussreiche Adelsgeschlechter hervor.58 Zwei seiner Verwandten regierten nach ihm die Provence: sein Sohn, Ludwig der Blinde (reg. 887–928), der auch König von Italien und nomineller Kaiser war, und sein Schwiegersohn Hugo von Arles (reg. 928–933).
Graf Bosos Reich kontrollierte den einträglichen Handel im Rhône-Tal sowie die wichtigsten Verbindungswege zwischen dem europäischen Binnenland und dem Mittelmeerraum. In seinen alten Städten standen Kultur und Wirtschaft in hoher Blüte. Zwar wurden die Küstengebiete regelmäßig von den Sarazenen heimgesucht, viele Hafenstädte an der Riviera hatten sich Überfällen von Piraten zu erwehren, und der Seehandel mit Italien war unsicher. »Räuberbarone« und Burgherren kontrollierten viele der Bergtäler. Doch ein ehrgeiziger Herrscher wie Boso wusste, dass er ein sehr wertvolles Stück Land besaß. Die Kirche bildete einen Faktor der Kontinuität und der Stabilität. Alle größeren Städte waren ein eigenes Bistum, auch das Klosterwesen spielte eine wichtige Rolle. Die Klosterinsel Lerinum (Lérins), die um 410 vom Heiligen Honortus gegründet worden war, hatte viele Geistliche hervorgebracht, die im gesamten südlichen Gallien im Einsatz waren.59 Dieses Kloster, mittlerweile stark verkleinert, unterstand nun Cluny.
Das Begräbnis des Westgoten Alarich, des »Herrsciners aller«, im Jahr 410 im Flussbett des Busento, Kalabrien. Holzschnitt, um 1855, nach einer Zeichnung von Eduard Bendemann (1811–1899).
»Die Geschichte Frankreichs begann in Vouillé« im Jahr 507: Der Franke Chlodwig tötet Alarich III., den König der Westgoten. Kreidelithografie von Nikolai D. Dmitrijeff Orenburgsky (1838–1898), nach einem Gemälde von Friedrich Tüshaus (1832–1885), 1875.
Y Gododdin – Eine Seite aus dem mittelalterlichen Buch Aneirins, eines altwalisischen Epos aus dem 7. Jahrhundert, das in einer Handschrift aus dem 13. Jahrhundert überliefert ist.
Vogel, Baum, Fisch und Ring – Symbole aus der Legende des hl. Mungo (6. Jahrhundert) im Wappen der Stadt Glasgow.
Statue von William Wallace (1272–1305) in Aberdeen, Schottland. – Kinogängern als Braveheart und seinen gälischen Zeitgenossen als Uilleam Breatnach, »William der Brite«, bekannt.
Rheingold: eine Episode aus der Nibelungensage, einem mittelalterlichen Heldenepos, das den Untergang des ersten Burgunderreiches im 5. Jahrhundert aufgriff. Ölgemälde von Peter von Cornelius, 1859.
Eine seltene Münze mit dem Kopf des Merowingerkönigs Dagobert (um 603–693), »der seine Hose verkehrt herum trug«.
Guntram, auch Guntramnus von Burgund (um 525–592), „the battle crow“, König und Heiliger, bestimmt seinen Neffen Childebert II. als seinen Nachfolger. Miniatur aus den „Chroniken von Frankreich“, gedruckt von A. Verard, Paris, 1493 (handkoloriert). Französische Schule, 15. Jahrhundert.
Friedrich Barbarossa (reg. 1162–1190): deutscher Kaiser, König von Italien und König von Burgund, 1172 in Arles gekrönt, und seine Söhne König Heinrich VI. und Herzog Friedrich VI. Mittelalterliche Malerei aus der Chronik der Welfen, 1179–1191.
Philipp der Gute und Karl der Kahle: Herzöge des burgundischen Herrschaftsverbundes im 15. Jahrhundert. Aus den Chroniken des Hennegaus. IVliniatur von Roger van der Weyden, 1477.
Karl der Kühne, auch Karel de Stoute (reg. 1467–1477): Herzog von Burgund, Graf von Flandern, Markgraf von Namur etc. Aus den Ordensregeln des Ordens vom Goldenen Vlies.
Herzogin, Gräfin und Markgräfin Maria von Burgund (1457–1482), Erbin. Öl auf Holz, Michael Pacher zugeschrieben, 1490.
Die Festung Aljaferia: erbaut im 10. Jahrhundert im ibero-islamischen Stil für die muslimischen Emire von Zaragoza, erobert 1118 von Alfonso El Batallador (Alfons dem Kämpfer), König von Aragón.
Die katalanische Galeerenflotte ankert vor Neapel. Gemälde von Francesco Pagano, 1465, Galleria Nazionale di Capodimonte, Neapel, Italien.
Königin Petronila von Aragón und Graf Ramón Berenguer IV. von Barcelona, durch deren Ehe im Jahr 1137 Aragón und Barcelona für fast 600 Jahre verbunden wurden. Öl auf Leinwand, 1634.
Los Reyes Católicos: Ferdinand von Aragón und Isabella von Kastilien, um 1491. Gemälde, zeitgenössische Kopie nach einem Gemälde von Michael Sittow (1469–1525) aus dem späten 15. Jahrhundert und Gemälde, um 1500, nach Juan de Flandes, Öl auf Holz.
Mattia Preti, Die Schlacht von El Puig, Kapelle der Langue d’Aragón aus dem Altarbild des hl. Georg, Valletta. Die Schlacht, die 1238 nahe Valencia zwischen Katalanen und Mauren ausgefochten wurde, endete mit einem entscheidenden Sieg für die Reconquista.
»Die Himmelsleiter«: byzantinische Ikone aus dem 7. Jahrhundert von Johannes Klimakos. Darstellungen des asketischen Lebens und des Weges zu geistiger Vollkommenheit unterstreichen den theokratischen Charakter der byzantinischen Gesellschaft.
Die Belagerung von Konstantinopel 1453 (französische Miniatur aus dem 15. Jahrhundert). Die osmanischen Türken versetzten dem Oströmischen Reich den Todesstoß.
Burg Trakai, Litauen: eine Festung aus dem 14. Jahrhundert, erbaut von einem Onkel des Groffürsten Jogaila, der Litauen 1385 mit Polen vereinigte.
Mirski Zamak, Schloss Mir, Weißrussland: vollendet im späten 16. Jahrhundert von Fürst Mikołaj Krzysztof Radziwiłł.
Barbara Radziwill (1520–1551), unglücklich mit Sigismund August verheiratet: Königin von Polen und Großfürstin von Litauen für sechs Monate. Öl auf Kupfer, um 1553–1556, Werkstatt Lucas Cranach der Jüngere (1515–1586).
Titelblatt des Dritten Litauischen Statuts, 1588.
»Der polnische Pflaumenkuchen«, Karikatur zur ersten Teilung von Polen-Litauen. Kupferstich, um 1772, John Lodge (bl. 1782–1796).
Stanisław II. August Poniatowski, König von Polen (reg. 1764–1795): geboren in Woltschin in Weißruthenien, gestorben in Sankt Petersburg, »repatriiert« 1938. Pastell auf Papier, aufgezogen auf Leinwand, nach Marcello Bacciarelli (1731–1818).
Schtetl-Juden: orthodoxe Juden aus einer der vielen jüdischen Kleinstädte Galiziens um 1900.
Huzule mit Pferd in Ostgalizien.
Polnische Goralen oder »Hochlandbewohner« aus der Tatra.
Lemberg, Hauptstadt des habsburgischen Galizien um 1900.
Joseph II. (reg. 1780–1790), Kaiser und erster König von Galizien und Lodomerien. Öl auf Leinwand, Georg Weickert, 18. Jahrhundert.
Franz Joseph I. (reg. 1848–1916), Österreichischer Kaiser und letzter König von Galizien und Lodomerien.
Die Lagune der Weichsel (frülner Frisches Haff, heute Kaliningradski Saliw): die Ostseeküste in der wasserreichen Heimat der Prußen.
Małbork, Polen, früher die Marienburg, Hauptsitz des Deutschen Ordens und größte Backsteinburg der Welt, um 1930.
Die Schilacht von Tannenberg, 15. Juli 1410, wie dargestellt von Jan Matejko (1878): Tod des Hochmeisters Ulrich von Jungingen. Öl auf Leinwand, 1878.
Das Tannenberg-Denkmal (1927–1945) zum Gedenken an den deutschen Sieg im September 1914, der deutschen »Revanche« für die Niederlage des Deutschen Ordens bei Tannenberg 1410. Hier 1934 bei der Überführung der sterblichen Überreste Paul von Hindenburgs in die Krypta.
Die preußische Huldigung, wie dargestellt von Matejko. Albrecht von Hohenzollern kniet vor König Sigismund I. von Polen. Öl auf Leinwand, 1882.
Albrecht von Hohenzollern (1490–1568), letzter Hochmeister des Deutschen Ordens und erster Herzog von Preußen. Gemälde, 1522.
Friedrich I. (reg. 1701–1713), erster König in Preufien, Königsberg 1701. Farbdruck, 1890, nach einem Aquarell von Woldemar Friedrich.
Friedrich Wilhelm I. (1620–1688), der »Große Kurfürst« von Brandenburg und letzte Herzog von Preußen. Nach einem Stich von Antoine Masson aus dem Jahr 1683.
Auch in Hochburgund vollzogen sich neue Entwicklungen. Dort hatte ein weiterer fränkischer Abenteurer, Rudolf von Auxerre (859–912), die Initiative ergriffen. Dass er und seine Mitstreiter alle durch Heirat mit den bayerischen Welfen verbunden waren, zeigte, dass sich Deutschland für diesen Raum zu interessieren begann. Keiner der verschiedenen Oberherren von Lotharingien war besonders stark, und dies bot Rudolf eine günstige Gelegenheit. Nachdem sein Versuch, das Elsass zu erobern gescheitert war, zog er sich nach St. Maurice(-en-Valois) zurück, seinen Stammsitz, und schmiedete zusammen mit mächtigen Adeligen und Kirchenmännern einen neuen Plan. Im Jahr 888 wurde in St. Maurice eine Versammlung einberufen, die ihn zum »König von Burgund« wählte, entsprechend dem Beispiel, das in der Provence die Synode von Mantaille gegeben hatte. Rudolf festigte seine Position, indem er auf seinen Anspruch auf das Elsass verzichtete, wofür die Ostfranken seine Eigenständigkeit anerkannten. Zudem schloss er einige kluge Heiratsallianzen. Seine Schwester heiratete Richard den Gerichtsherrn. Eine seiner Töchter heiratete Ludwig den Blinden, eine andere Boso II., den Grafen von Arles und späteren Markgrafen der Toskana. Die Burgunder hielten zusammen.
Ende des 9. Jahrhunderts gab es schließlich drei eigenständige burgundische Reiche. Eines davon, das Herzogtum, lag innerhalb des westfränkischen Machtbereichs. Die beiden anderen, die Königreiche Hochburgund und Niederburgund, waren gerade erst unabhängig geworden. Rudolfs Herrschaftsgebiet erstreckte sich zwischen »Iurum et Alpes Penninas … apud Sanctum Mauritium«. Daher wurde dieses Reich manchmal auch als »Transjuranisches Burgund« bezeichnet, um es vom Herzogtum im »Cisjuranischen Burgund« zu unterscheiden, doch diese alten Benennungen sind verwirrend. In Wirklichkeit umfasste Rudolfs Territorium beide Flanken des Jura und erstreckte sich über die heutigen Schweizer Kantone Wallis, Waadt, Neuchâtel und Genf sowie über Savoyen und die nördliche Dauphiné. Das Verwaltungszentrum war St. Maurice (St. Moritz). Dies war das fünfte burgundische Reich gemäß der Liste von Bryce.
»Hochburgund« kann man sich heute nur im Zusammenhang mit den modernen Bezeichnungen »Frankreich«, »Deutschland« und »Schweiz« vorstellen. Es ist stets zu bedenken, dass die modernen europäischen Staaten nicht neu erfunden wurden und dass die Gemeinschaften, die ihnen vorausgingen, nicht weniger künstlich waren als sehr viele Staaten in der europäischen Geschichte. Die »Hochburgunder« übten sprachlichen Zusammenhalt und drangen niemals über die Grenzen ihrer alten Stammesfeinde, die Deutsch sprechenden Alamannen vor. Sie waren geprägt durch die Sturheit von Bergbewohnern, instinktiv misstrauisch gegenüber Außenstehenden und teilten die Erinnerungen und Mythen aus einer gemeinsamen Vergangenheit, die ein halbes Jahrtausend alt war. Hier, so glaubte man, konnte der Geist des alten Burgund besser bewahrt werden als im französisch regierten Herzogtum oder in Gebieten, die stärker äußeren Einflüssen ausgesetzt waren. Ein Schweizer Historiker schrieb in diesem Zusammenhang: »C’est ainsi que nacquit une improbable patrie entre un matreau et une éclume.« (»So wurde hier, gewissermaßen zwischen Hammer und Amboss, ein schier unmögliches Heimatland geboren.«)60 Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Schweiz aus burgundischen Wurzeln erwachsen ist.
Kaum ein Fachhistoriker dürfte wohl der Einschätzung widersprechen, dass das Hochburgund des 10. Jahrhunderts »einen der undurchsichtigsten Abschnitte der mittelalterlichen Geschichte« darstellte.A Rudolf II. (gest. 937), der einzige Sohn des Begründers des Königreiches, setzte sein Geburtsrecht aufs Spiel, als er sich in die Politik in Norditalien einmischte, in der viele gefährliche Fallstricke lauerten. Nachdem er 923 zum König der Lombarden gekrönt worden war, pendelte er eine Zeit lang zwischen St. Maurice und Pavia. Die italienischen Adeligen erhoben sich erwartungsgemäß gegen ihn und wollten Hugo von Arles, den Regenten von Niederburgund, an seine Stelle setzen. Im Jahr 933 fanden Rudolf und Hugo zu einer genialen Lösung. Rudolf anerkannte Hugos Anspruch auf Italien, wofür Hugo Rudolf als Monarchen eines vereinigten Königreiches aus Hoch- und Niederburgund vorschlug. Rudolfs Tochter heiratete Hugos Sohn, und vier Jahre später kam das glückliche Paar in den Besitz seines vereinten Reiches. Dieses zentrale Ereignis ist allerdings mit einigen Unklarheiten verbunden, da die Könige von Hochburgund abwechselnd Rudolf, Rudolphus, Ralf oder Raoul genannt wurden. Seltsam ist ferner, dass die Zählung der Herrscher nach der Schaffung des neuen Reiches bruchlos fortgesetzt wird. Aus dynastischen Gründen wird der erste Rudolf, der über das Reich der beiden Burgund herrschte, im Allgemeinen als Rudolf II. bezeichnet, was darauf hindeutet, dass es sich eher um eine Übernahme des Südens als um die Gründung eines neuen Reiches handelte.61
Für Verwirrung sorgt hauptsächlich die Einschätzung des politischen Kontextes des Vertrags von 933. In sämtlichen Kommentaren aus Burgund wird er als reines Tauschgeschäft zwischen zwei Herrschern dargestellt. Doch die Entwicklungen in Norditalien wurden in Deutschland stets sehr aufmerksam verfolgt, wo die Abmachungen zwischen Rudolf und Hugo das Misstrauen der Ottonen-Dynastie wecken mussten. Als die beiden burgundischen Herrscher ein enges politisches und verwandtschaftliches Bündnis schlossen, konnten ihre kaiserlichen deutschen Nachbarn nicht untätig zusehen:
Auf die Gefahr, die durch diese Allianz ausging, reagierte [Kaiser] Otto umgehend. Als Schutzherr von Rudolfs 15 Jahre altem Sohn Konrad marschierte Otto in Burgund ein ›brachte den König und das Königreich in seinen Besitz‹ und begegnete dadurch der Gefahr einer Vereinigung von Italien und den burgundischen Landen … Burgund wurde zwar erst 1034 formell mit Deutschland zusammengeschlossen, stand aber seit 938 unter deutscher Hegemonie.62
Der deutsche Faktor war das entscheidende Element bei der burgundischen Vereinigung. Die rudolfinische Dynastie durfte weiterbestehen, und der Zusammenschluss der beiden burgundischen Königreiche schritt voran. Doch der Kaiser hielt stets die Peitsche in der Hand. Wenn sie es für erforderlich hielten, konnten er oder seine Nachfolger das Arrangement rückgängig machen und die burgundischen Angelegenheiten zu ihrem eigenen Vorteil neu ordnen.
Im 10. Jahrhundert wurde allmählich die künftige Gestalt Europas sichtbar. Im Westen bildeten sich im Zuge der langwierigen Reconquista gegen die Muslime wieder christliche Staaten auf der Iberischen Halbinsel. Der erste König von Gesamt-England bestieg den Thron (siehe dazu S. 86). Unter Hugo Capet (reg. 987–996) und seinen Nachfolgern wurde das Westfrankenreich allmählich zu Frankreich umgestaltetB, und die drei ottonischen Herrscher von Sachsen formten jenen Staat, der im Laufe der Zeit zum Heiligen Römischen Reich werden sollte. Als die Erinnerungen an die Franken verblassten, verschwanden auch alte Namen wie Westfrankenreich oder Neustrien und Ostfrankenreich oder Austrasien und wurden durch Frankreich und Deutschland ersetzt. In Italien hatte der Papst sowohl politisch wie auch geistlich an Autorität gewonnen. Im Osten schwanden der Einfluss von Byzanz und der orthodoxen Kirche, und es entstanden neue Staaten. Nach den Ungarneinfällen 895 gingen die Jahrhunderte der Auseinandersetzungen mit den Barbaren in Europa schließlich zu Ende. Bulgarien, Polen, Ungarn und Rus sowie Frankreich, England und Deutschland waren die neuen politischen Akteure. Trotz seiner vielfältigen Wandlungen hatte Burgund mittlerweile ein stattliches Alter erreicht.
Obwohl willkürlich geschaffen, war das Königreich der beiden Burgund – Le Royaume des Deux Bourgognes –, das nach seiner Hauptstadt meist als »Königreich Arelat« bezeichnet wird, alles andere als ein künstliches Gebilde. Es bildete eine natürliche geografische Einheit, bestand aus dem Tal der Rhône und deren Nebenflüssen zwischen den Gletschern und dem Meer. Es beruhte auf dem historischen Burgund und besaß eine gemeinsame postlateinische Kultur. Im Norden verfügte es durch die »Burgundische Pforte« über einen Verbindungsweg zum Rheinland; im Süden war es über die Häfen Arles und Marseille mit Italien und Iberien verbunden. In geopolitischer Hinsicht lag es gewissermaßen im Windschatten jener Stürme, die über die Nachbarstaaten hinwegfegten. Die Zeichen standen gut für eine erfolgreiche historische Entwicklung. Das war das sechste burgundische Reich, gemäß der Auflistung von James Bryce war es Nr. V.
Im ersten Jahrhundert seines Bestehens konnte das Königreich Arelat jene dynastischen Krisen vermeiden, die vielen ähnlichen Staaten zu schaffen machten. Die zwei Nachfolger von Rudolf II., Konrad (reg. 937–993) und Rudolf III. (reg. 993–1032), lebten beide sehr lange. Konrads lateinischer Beiname Pacificus (»der Friedfertige«) klang nach mittelalterlichen Verhältnissen, als Könige per definitionem Kriegsherren waren, etwas abwertend, aber vielleicht tat man ihm damit auch ein wenig unrecht. Zutreffender wäre vielleicht die Übersetzung »der Feige« oder zumindest »der Unkriegerische«. Konrad scheute aber nicht vollständig vor dem Krieg zurück. Im Jahr 954 drangen gleichzeitig plündernde ungarische Horden und Sarazenen in sein Reich ein. Durch Gesandte bat er die Ungarn, ihm zu helfen, die Sarazenen zurückzuwerfen, zugleich aber flehte er die Sarazenen an, gegen die Ungarn vorzugehen. Dann wartete er ab, bis sich die beiden Feinde gegenseitig zerfleischten, und befahl schließlich dem burgundischen Heer, reinen Tisch zu machen. Im folgenden Jahrzehnt unternahm Konrad mehrere Feldzüge gegen sarazenische Siedlungen in der Provence. Man kann ihn daher am besten als einen König bezeichnen, der sowohl mit List und Tücke als auch mit dem Kampf vertraut war. Dass er sich 56 Jahre auf dem Thron halten konnte, war allein schon eine herausragende Leistung.
Konrads Reich ist ausführlich durch Münzen wie auch durch kirchliche Urkunden bezeugt. In Lugdunum wurde eine Bronze-Münze mit der Aufschrift CONRADUS geprägt. Konrad gründete 960 die Abtei Montmajour in Frigolet in der Nähe von Avignon und im Zeitraum bis 99363 das Kloster Darentasia (Tarentaise in Savoyen), dessen heutiger Name Moûtiers eine verballhornte Form von monasterium ist. Er war mit einer westfränkischen Prinzessin verheiratet, doch seine Herrschaft war in politischer Hinsicht zum einen durch ein feindseliges Verhältnis zu den Hugoniden geprägt, die danach strebten, das Abkommen von 933 rückgängig zu machen, und zum anderen durch eine dauerhafte deutsche Vormundschaft. Konrad war ein Mündel des kaiserlichen Hofes gewesen, und seine Schwester Adelheid wurde die zweite Gemahlin Ottos des Großen. Sie war eine großzügige Wohltäterin und wurde später heilig gesprochen. Adelheid spielte eine wichtige Rolle als Regentin (reg. 983–994) während der Minderjährigkeit ihres Sohnes. Dessen späteres Leben stand im Übrigen im Schatten der mit der Jahrtausendwende verbundenen Befürchtungen über das Weltende. »Das 10. Jahrhundert war die Eisenzeit der Welt; das Schlimmste war eingetreten, und nun sollte der Tag des Gerichts und der Abrechnung kommen.«64 Seuchen und Hungersnöte kündigten die Katastrophe an, die nie eintrat. Einige Historiker vermitteln andere Eindrücke. »Das milde Klima des Südens … brachte die ersten Früchte der Ritterlichkeit hervor und die dazugehörigen Lieder«, schrieb enthusiastisch ein Forscher im 19. Jahrhundert. »Während des größten Teils des 10. Jahrhunderts, als Nordfrankreich von inneren Unruhen erschüttert wurde, erfreuten sich die Provence und die nichtfranzösischen Teile des historischen Burgund einer Phase der Ruhe unter der maßvollen Herrschaft von Konrad dem Friedfertigen.«65
Konrads Sohn Rudolf III. war ebenfalls von deutscher Unterstützung abhängig. Als der Adel rebellierte, wurde er von einer deutschen Streitmacht gerettet, die Adelheid entsandt hatte, denn das Königreich der beiden Burgund verfügte über keine starke Zentralgewalt. Der König saß in Arles und war damit weit entfernt von den Regionen im Inland, die er im Griff zu behalten suchte. Grafen, Bischöfe und Städte beharrten auf der Herrschaft über ihre Gebiete. Doch zugleich erwies sich die Dezentralisierung auch als vorteilhaft. Das Gemeinwesen konnte nicht durch einen Schlag gegen das Zentrum ausgelöscht werden; es konnte nur langsam, Schritt für Schritt, zerlegt werden. Das war schließlich auch das Schicksal des Königreichs Arelat. Es bestand weiter, wenn auch in fragilem Zustand, nachdem die meisten seiner wichtigsten Teile schon lange abgefallen waren.
Fairerweise sollten die Historiker aber auch all jene kleinen Herrscher und Staatsgebilde erwähnen, die neben der königlichen Autorität Fuß fassen konnten. So übernahm beispielsweise in Hochburgund der Bischof von Genf nicht nur die Herrschaft über die Stadt, sondern auch über das Gebiet um den See. Daher verlegte der Comitatus (der Graf der Genfer Region) seinen Sitz in das benachbarte Eneci (Annec), wo vom 10. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts eine Dynastie aus 21 Grafen regierte. Ähnliches ereignete sich in Lyon. Die Bischöfe von Lyon, die das Amt des Primas von Gallien beanspruchten, waren in fränkischer Zeit zu Erzbischöfen erhoben worden und herrschten bereits unangefochten über die Stadt, als das Königreich Arelat entstand. Daraufhin zog der Graf von Lyon in den benachbarten Bezirk Forez um, wo er von seiner Festung in Montbrison aus einen endlosen Kleinkrieg mit den Erzbischöfen führen konnte.
Im Norden von Hochburgund genossen die »Pfalzgrafen von Burgund« besondere Privilegien, weil sie die Grenzregion gegen die Deutschen im Elsass und in Schwaben schützten. Ihr Hauptsitz befand sich in Vesontio (Besançon), wo Otto-Wilhelm von Burgund (986–1026) eine Linie aus 36 Grafen begründete, die sich bis ins 17. Jahrhundert halten konnte. In der Grafschaft Vienne errichteten die Grafen von Albon einen Stützpunkt, von dem aus Guignes d’Albon (gest. 1030) ein kleines Reich schuf, das sich bis zum Mont Cenis erstreckte. Einer seiner Nachfahren nahm einen Delfin in sein Wappen. Dessen Nachfolger wurden daher als delfini bezeichnet und ihr Machtgebiet als Delfinat oder als Dauphiné.
In Niederburgund bildete sich im Rhône-Tal, im Valentinois, in Orange in der Comtat Venaissin eine Reihe von weitgehend selbstständigen Grafschaften. Am mächtigsten wurden jedoch die Erben von Graf Boso. Von den drei Linien der Bosoniden endete eine mit Hugo von Arles (siehe oben); eine andere brachte die »Grafen der Provence« hervor, die in Ais (Aix-en-Provence) residierten; die dritte begründete die Grafschaft von Furcalquier in den Bergen. Die Grafen der Provence setzten sich im südlichen Teil des Königreiches nahezu vollständig durch; lediglich die ungebärdigen Herren von Baux (Les Beaux) trotzten mit ihrer uneinnehmbaren Festung und ihrem unbezwingbaren Willen allen Unterwerfungsversuchen.
Diese Zersplitterung der Macht schwächte das Königreich Arelat, und Arles war schließlich nur noch eine nominelle Hauptstadt. Zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert fanden hier keine Königskrönungen mehr statt. Das prachtvolle römische Amphitheater wurde in eine Burg umgewandelt, und in der Arena wurden verschiedene Schutzbauten errichtet. Davor stand die Bischofskirche St. Trophine und wartete auf bessere Zeiten. Rudolf III. versuchte sich unter diesen stetig verschlechternden Bedingungen zu behaupten. Die Chronisten versahen ihn mit den Beinamen »der Faule« (»le Fainéant«) und »der Fromme«, woraus sich »heiliger Faulenzer« ergab. Die größten Sorgen bereiteten ihm die Aufsässigkeiten der Pfalzgrafen aus dem Norden, gegen die er den deutschen König Heinrich II. zu Hilfe rief. Heinrich verlangte dafür – wie zu dieser Zeit auch vom Normannenherzog Wilhelm – das Versprechen, ihn als alleinigen Thronerben einzusetzen. Rudolf war kinderlos geblieben und sein Erbe hätte sonst wahrscheinlich sein Neffe Odo II. von der Champagne beansprucht, einer der schreckenerregendsten Krieger in dieser schreckenerregenden Zeit. Doch Heinrich (reg. 1014–1024) starb schließlich vor Rudolf. Dennoch geriet das Versprechen nicht in Vergessenheit.
Im Jahr 1032 spitzte sich die Situation zu. Wie erwartet, starb Rudolf ohne unmittelbare Nachkommen. Wie erwartet, begannen unverzüglich Odo von der Champagne und Heinrichs Nachfolger, Kaiser Konrad II., um den Thron des Königreiches Arelat zu kämpfen. Der Kaiser setzte sich durch, denn Odos Anspruch wurde von dessen Lehnsherrn, dem König von Frankreich, zurückgewiesen. So ging das »Reich der beiden Burgund« friedlich und unter internationaler Anerkennung in den Besitz der deutschen Kaiser über. Es blieb ein Reichsgut mit formeller Selbstständigkeit innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, bis mehr als sechs Jahrhunderte später der letzte Rest an Frankreich fiel.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nations war ein komplexer politischer Organismus. In seiner Spätphase umfasste es, wie manche sagten, mehr Fürstentümer, als das Jahr Tage hat. Doch nach 1032 bestand es im Kern aus drei Gebieten, dem Königreich Deutschland (Regnum Teutonicum), dem Königreich Italien (Regnum Italiae) und dem Königreich Burgund (Regnum Burgundiae) – das »Königreich Arelat«, das nach der Eingliederung in »Königreich Burgund« umbenannt wurde. Nun gab es nur noch zwei burgundische Reiche: das abhängige Herzogtum innerhalb Frankreichs und das abhängige Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Sollte man Letzteres als ein neues Staatswesen einstufen oder nicht? Bryce verneinte dies und behandelte es als schlichte Fortsetzung des Königreichs Arelat. Doch die gegenteiligen Argumente erscheinen überzeugender. Das politische Umfeld hatte sich grundlegend gewandelt, und auch die territoriale Basis sollte sich verändern. Nach 1032 erlebte das Reichsgut Burgund weitere Transformationen. Es wird hier als das siebte burgundische Reich eingeordnet.
In den folgenden drei Jahrhunderten bemühte sich das Königreich Burgund, sich zu so gut wie möglich zu behaupten. Mit Ausnahme von Friedrich Barbarossa (reg. 1152–1190) zeigten die fernen Kaiser in ihren verschiedenen Residenzen in Deutschland nur selten näheres Interesse. Die politischen Vorgänge im Königreich Burgund wurden von lokalen Gegebenheiten bestimmt – von den fortdauernden Streitereien zwischen den Grafen und den Städten, von Auseinandersetzungen im Verborgenen, von Intrigen zwischen den Fürsten. Dennoch hätte wohl kaum jemand die Vorhersage gewagt, dass das schlichte französische Herzogtum eines Tages mächtiger werden würde als das große Königreich im Heiligen Römischen Reich.
Interessant ist die sprachliche Entwicklung, die sich im Reichsgut vollzog. Trotz der deutschen Oberherrschaft konnte die deutsche Sprache kaum Fuß fassen. Die vorherrschende Sprache blieb ein frankoprovenzalisches Idiom, der Vorläufer des modernen Arpitanischen, das man auch heute noch auf den Straßen von Lyon und in Teilen der Westschweiz und Savoyens hören kann. Menschen mit historischem Gespür vernehmen im Arpitanischen das Echo eines vergangenen Burgunds.66
Das Verfahren der Ernennung von Grafen zu Herzögen war anscheinend völlig willkürlich. Alles hing davon ab, wie viel Macht, Prestige und Glück ein bestimmter Vasall zu einem bestimmten Zeitpunkt besaß. Doch einen besonderen Platz in der Geschichte nimmt ein neues Herzogtum ein, das eng mit dem schwäbischen Adelsgeschlecht der Zähringer verbunden war. Die ehemalige Burg der Zähringer auf einem Berg in der Nähe von Freiburg im Breisgau ist heute eine Ruine, doch im 11. und 12. Jahrhundert war sie der Sitz eines ehrgeizigen Fürstengeschlechts, das bereits zwei Herzogtümer gewonnen und wieder verloren hatte und das nun zum dritten Mal nach einem Herzogtum strebte. Die Zähringer hatten sich als erfolgreiche Verwalter der Eigengüter ihrer Familie erwiesen; sie hatten im Schwarzwald ihre Rechte gegenüber der Kirche durchgesetzt, und nach der Gründung der Stadt Freiburg errichteten sie dort ein organisiertes System der Kommunalverwaltung. Sie führten im Kleinen vor, was der Kaiser in großem Rahmen durchzusetzen hoffte. Sehr viele burgundische Adelige hatten mittlerweile ihren Lehnseid vergessen. Im Jahr 1127 bestellte der Kaiser Konrad von Zähringen zum Rektor (königlicher Stellvertreter) von Burgund und übertrug ihm die Güter eines neu geschaffenen Herzogtums Burgundia Minor (»Klein-Burgund«). Die Zähringer sollten im Königreich Burgund die Disziplin wiederherstellen.67
Der Herzogtum Klein-Burgund umfasste ein großes Gebiet östlich des Jura, das weitgehend identisch ist mit den Grenzen der heutigen frankophonen Schweiz. Es ist die Nr. VI auf der Liste von Bryce. Zum Territorium des Herzogtums der Zähringer gehörte auch ein kleineres Gebiet, die Landgrafschaft Burgund, die auf der Bryce-Liste die Nr. VIII darstellt. Dieses Territorium bestand aus dem Gebiet rechts der mittleren Aare zwischen Thun und Solothurn. Möglicherweise reichte es auch bis Habsburg, der »Habichtsburg«, die über der Aare bei Solothurn steht und als Stammburg der Habsburger gilt, die später zum mächtigsten Herrschergeschlecht in Mitteleuropa aufstiegen. Der Tradition der Habsburger zufolge hieß der Stammvater Guntram.68
Als Rektoren und Herzöge hatten die Zähringer die Lehenshoheit über eine Vielzahl von Edlen, Grafen und Bischöfen inne sowie über ein Archipel von loyalen Städten, die verstreut waren über ein widerspenstiges Land. Sie bauten ein Netz von miteinander verbundenen Städten auf, wozu Freiburg, Burgdorf, Murten (Morat), Rheinfelden und Thun gehörten. Ihr bedeutsamster Repräsentant, Graf Berthold V. von Zähringen (1160–1218), ließ die Burg von Thun erbauen und gründete im Jahr 1191, angeblich nachdem er einen Bären erlegt hatte, die Stadt Bern. Er starb kinderlos, und mit ihm endete die Linie der Zähringer. Das Experiment wurde nicht wiederholt.69
Schon ab Mitte des 12. Jahrhunderts bemühte sich Friedrich Barbarossa darum, die Macht des Kaisertums zu stärken. Er ließ sich 1152 in Aachen zum deutschen König krönen, 1154 in Pavia zum König von Italien, 1155 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und mit einigem zeitlichen Abstand 1173 in Arles schließlich zum König von Burgund. Allen diesen Schritten gingen jahrelange politische Aktivitäten und Feldzüge voraus. Im Laufe dieser Zeit verbündete er sich mit dem Papst und ermöglichte dadurch die Wiederbelebung der »Zwei-Schwerter-Lehre«, wonach Gott den Menschen zwei Schwerter gegeben habe, das geistliche und das weltliche, die vom Papst beziehungsweise vom Kaiser geführt werden sollten. Barbarossas Interesse an Burgund wurde durch seine zweite Ehe entfacht, seine Heirat mit Beatrix von Burgund, der Erbin des burgundischen Pfalzgrafen. Durch diese Heirat unterstellte Barbarossa das Gebiet seiner unmittelbaren Herrschaft und verwickelte sich in die Konflikte im Königreich Burgund, konnte aber keine entscheidenden Erfolge erzielen. Er starb auf dem Zweiten Kreuzzug, ohne jemals das Heilige Land zu Gesicht bekommen zu haben.70
Der langwierige »Investiturstreit«, der Konflikt zwischen geistiger und weltlicher Macht, schwächte die beiden höchsten Autoritäten der mittelalterlichen Welt gleichermaßen. Er begann im 10. Jahrhundert, als die ottonischen Kaiser erstmals die Papstwahl zu beeinflussen versuchten, und setzte sich in mehreren Wendungen bis ins 13. Jahrhundert fort. Dem Konflikt lag im Kern die ungelöste Frage zugrunde, ob der Papst oder der Kaiser die übergeordnete rechtliche Instanz darstellten, und konkret ging es um das Recht auf die Amtseinsetzung (Investitur) von Geistlichen, insbesondere von Bischöfen und Äbten. Der Streit verschärfte die Auseinandersetzungen und Bürgerkriege in Deutschland, bis schließlich 1122 durch das Wormser Konkordat eine Kompromisslösung gefunden wurde. In anderen Ländern jedoch dauerte dieser Streit noch länger an, insbesondere in England unter König John. Seine Bedeutung mag von manchen Historikern übertrieben worden sein, die andere Ursachen für Spannungen unbeachtet ließen,71 doch er führte dazu, dass in allen Teilen des Reiches eine verfahrene Situation entstand, in der weder Papst noch Kaiser den Machtanspruch des anderen anzuerkennen bereit waren, und beschleunigte letztlich die Zersplitterung der Macht:
In der Zeit des Investiturstreits … entstanden neue territoriale Einheiten, und diese Einheiten bildeten die Keimzellen, aus denen sich in Deutschland die Fürstentümer des Späten Mittelalters entwickelten … Es sollte noch viele Generationen dauern, bis die Fürsten die vollständige Kontrolle über ihre Territorien durchsetzen konnten, doch bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts beschritten die großen Adelsfamilien jenen Weg, der am Ende zur territorialen Souveränität führte; und es war der Investiturstreit mit seinen revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen im Gefolge, der ihnen die Möglichkeit eröffnete, ihre Macht zu behaupten und auszubauen.72
Das Königreich Burgund war besonders anfällig für diese Schwächung der staatlichen Autorität. Es stellt sich die Frage, warum die Kaiser nach dem Zwischenspiel des Herzogtums der Zähringer so zögerlich waren und nicht eingriffen und den Niedergang aufhielten. Darauf gibt es geografische, politische und strategische Antworten: Zum einen waren militärische Aktionen in Burgund aufgrund des gebirgigen Terrains stets mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum anderen genoss das Königreich Deutschland eindeutig den Vorrang. Dem Tod eines Kaisers folgte stets eine Auseinandersetzung, in der die führenden Thronanwärter um die Nachfolge rangen, bis schließlich ein neuer Kaiser gekrönt wurde. Und drittens musste jeder Monarch, wenn er seine Position in Deutschland gesichert hatte, sich entscheiden, ob er sein Augenmerk künftig dem Königreich Italien oder dem Königreich Burgund zuwenden wollte. Fast ausnahmslos entschieden sich die neuen Kaiser für Italien. Rom, der Sitz des Papstes, übte eine magische Faszination aus. Die Unterstützung des Papstes besaß enorme Bedeutung, und jeder künftige deutsche Kaiser träumte davon, in die Fußstapfen Karls des Großen zu treten. Daher blieb das Königreich Burgund üblicherweise unbeachtet. Ein deutscher Kaiser überließ nicht nur Burgund, sondern auch Deutschland sich selbst. Friedrich II. (reg. 1220–1250), im normannischen Sizilien geboren, zog es vor, seinen Hof in seinem Stammland Süditalien einzurichten.73
Unaufhaltsam erlebte das Königreich Burgund nun eine Reihe von Abspaltungen. In regelmäßigen Abständen brach ein Teil des Reiches weg. Die ursprüngliche Ansammlung von Territorien schrumpfte stetig. Als erstes Gebiet schied die Provence aus, dann folgten das Comtat Venaissin, Lyon und die Dauphiné. Die Kaiser hielten noch an einigen Ansprüchen und Rechten fest, doch die Entwicklung war unumkehrbar. Das Königreich zerfiel langsam. Die ersten Schritte zur Abspaltung wurden von den Geistlichen vollzogen, von denen einige den Titel »Fürstbischof« beanspruchten. Sie fühlten sich dazu ermutigt, weil die Kaiser die Unterstützung der Kirche benötigten. Die Bischöfe von Sion (im Valais) und von Genf sagten sich schon sehr früh los, und andere folgten ihnen.
Die Haltung der Kirche in der Investitur-Frage wurde am eindrücklichsten im Jahr 1157 in Burgund zum Ausdruck gebracht. Auf der Versammlung von Besanz (Besançon) vertrat der päpstliche Gesandte die Ansicht, dass das Kaiserreich lediglich ein päpstliches benefizium sei, also ein freiwilliges Geschenk, über das der Papst weiterhin verfügen könne. Dadurch riskierte er, wie ein Historiker bemerkte, dass einer der anwesenden Herzöge des Reiches ihm mit seiner Streitaxt den Schädel spaltete, denn mit dieser Aussage stellte er die unbestrittene Autorität des Kaisers eindeutig infrage. Doch der Erzbischof von Besanz wie auch einige Grafen aus der Region kamen dadurch wohl auf neue Ideen.
Die Pfalzgrafschaft Burgund – die diesen Namen aufgrund ihrer Lage an der nördlichen Grenze des Königreiches erhalten hatte – war ein sehr wichtiges Gebiet. Graf Rainald III. (gest. 1148) hatte hier bereits vergeblich ein eigenes kleines Reich aufzubauen versucht. Nachdem er die Grafschaft Mâcon im benachbarten französischen Herzogtum Burgund geerbt hatte, hatte er sich zum Freigrafen (franc comte) innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erklärt. Doch die kaiserlichen Behörden billigten diesen Schritt nicht und beschlagnahmten zur Strafe einen Großteil von Rainalds Gütern. Aber dann heiratete Kaiser Friedrich Barbarossa Rainalds Tochter und die Erinnerung an Rainalds »Freigrafschaft« lebte weiter.74 Im Jahr 1178 gelang es dem Erzbischof von Besanz, einem Enkel von Rainald III., durch Verhandlungen seinen Bischofsitz in eine Reichsstadt umzuwandeln, die von ihren Lehenspflichten gegenüber dem Pfalzgrafen befreit wurde. Das war ein wegweisender Präzedenzfall. Einige Jahrzehnte später ging der Bischof von Basel noch einen Schritt weiter und schuf ein »Fürstbistum«, das nicht nur über seinen Bischofssitz herrschte, sondern auch über die nahe gelegenen beschlagnahmten Güter von Rainald III.75
Auch große Teile der künftigen Schweiz wurden aus dem zum Heiligen Römischen Reich gehörenden Königreich Burgund herausgeschnitten. Anfang des 13. Jahrhunderts wanderten Bauern aus dem Gebiet des Bischofs von Sion im Valais nach Graubünden im Osten. Die Einwanderer brachten Brückenbautechniken mit, machten die Schöllenenschlucht für Reisende passierbar und ermöglichten den Zugang zu dem bedeutsamen Handelsweg über den Gotthard-Pass nach Italien. Im August 1291 gelobten die Männer von Uri, Schwyz und Unterwalden, die Mautstellen am Pass betrieben, dass sie sich jeder Einmischung von außen widersetzen würden. Dies gilt als Gründungsakt der schweizerischen Eidgenossenschaft.76
Die Provence löste sich durch eine Reihe von Heiraten von Burgund. Im Jahr 1127, in der ersten Phase, hatte die letzte Bosoniden-Erbin ihre Rechte ihrem aus Barcelona stammenden Ehemann abgetreten und dadurch die Kontrolle über das Territorium einer Macht außerhalb des Heiligen Römischen Reiches übertragen. Im Jahr 1246 brachte die letzte katalanische Erbin der Provence dieselbe Mitgift in ihre Ehe mit einem angevinischen Gemahl ein, was den Anfang einer Linie von Grafen darstellte, die Vasallen des französischen Königs waren (siehe dazu S. 200).77
Die Erosion setzte sich fort. Im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts eroberten die Franzosen während des Kreuzzugs gegen die Albigenser die Languedoc und fassten dadurch auf dem rechten Ufer der Rhône Fuß. Unter König Ludwig dem Heiligen (reg. 1226–1270) begannen sie mit der Einrichtung eines Außenpostens an der Mittelmeerküste bei Aigues-Mortes, was zur Gründung eines Kreuzfahrerhafens führen und ihre Kontrolle über das untere Rhône-Tal festigen sollte.78 Im Jahr 1229 gelang es Agenten des französischen Königs, den Bischof von Vivarium (Vieviers) zu stürzen und einen französischen Brückenkopf am Fuße der Cevennen zu errichten.79 Das Comtat Venaissin auf dem gegenüberliegenden Ufer, das seinen Namen von der kleinen Stadt Venasque ableitete, wurde von seinem kinderlosen Eigentümer 1274 als Geschenk dem Papst hinterlassen. Die Enklave Avignon innerhalb des Comtat wurde 1348 an einen im Exil weilenden Papst verkauft.80 Die benachbarte Grafschaft Aurasion (Orange) genoss den Status eines autonomen Fürstentums unter den Grafen von Baux, die bekannt wurden durch ihre Auseinandersetzungen mit den Grafen der Provence, die sogenannten »Bausseneque-Kriege«. Ihre Hinterlassenschaft fiel schließlich an das französische Haus Chalon.81
Lugdunum (Lyon), die bedeutendste Stadt im Rhône-Tal, entwickelte sich unterdessen zu einer herausragenden Handelsmetropole. Mit ihren Jahrmärkten, die von zahlreichen italienischen Kaufleuten besucht wurden, bildete sie eine Drehscheibe des Handels zwischen dem nördlichen und dem südlichen Europa. Zunehmend jedoch begann sich Frankreich auch aus strategischen Gründen für die Stadt zu interessieren. Im 13. Jahrhundert war Lyon vor allem ein sehr bedeutender Erzbischofssitz. Hier fanden zwei Kirchenkonzile statt. Auf dem Konzil im Jahr 1245 wurde Kaiser Friedrich II. exkommuniziert und abgesetzt. Am zweiten Konzil in Lyon im Jahr 1274 nahmen 500 Bischöfe teil. Die Päpste leiteten diese Konzilien persönlich, und 1305 wurde Papst Klemens V. in Lyon gekrönt. Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass der Erzbischof von Lyon, Béraud de Got, der Bruder des neuen Papstes war.
Die Absetzungsbulle von Papst Innozenz IV., in der die Exkommunikation von Friedrich II. bekräftigt wurde, nahm kein Blatt vor den Mund:
… Wir können seine Ungereclitigkeiten niclit länger dulden, ohne Christus schwer zu beleidigen, und der Druck unseres Gewissens zwingt uns, ihn gerecht zu bestrafen. Um seine anderen Vergehen beiseite zu lassen, vier äußerst schwere Verbrechen hat er begangen, die mit keiner Ausflucht zu leugnen sind. Er hat mehrfach Meineid geleistet; er hat den Frieden … zwischen Kirche und Reich … willkürlich gebrochen; er hat sogar das Sakrileg begangen, Kardinäle der heiligen römischen Kirche sowie Prälaten und Kleriker … anderer Kirchen gefangensetzen zu lassen, die auf dem Wege zum Konzil waren …; auch der Ketzerei wird er nicht aus zweifelhaften oder geringfügigen, sondern aus schwerwiegenden und eindeutigen Gründen verdächtigt … Daher haben wir offengelegt, dass der genannte Fürst, der sich des Kaisertums, der Königreiche und aller Ehre und Würde so unwürdig erwiesen hat und der wegen seiner Ungerechtigkeiten von Gott verworfen wurde, damit er nicht regiere und nicht herrsche, befangen und verworfen ist aufgrund seiner Sünden … Wir zeigen dies an und entheben ihn … kraft unseres Urteils und kraft apostolischer Autorität verbieten wir streng, dass irgendjemand ihm fürderhin wie einem Kaiser oder König gehorcht … Diejenigen aber, denen in diesem Reiche die Wahl des Kaisers zusteht, sollen in freier Wahl einen Nachfolger bestimmen … Gegeben zu Lyon, am 17. Juli (1245), im dritten Jahr des Pontifikats.82
Ein solches Dokument hätte niemals formuliert und verlesen werden können, wenn der Kaiser auch nur noch begrenzten Einfluss in dieser nominell nach wie vor zum Reich gehörenden Stadt ausgeübt hätte.
Auf dem zweiten Konzil von Lyon (1274) ging es um die Überwindung der Spaltung zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen. Doch dem Konzil gelang es nur, den Begriff filioqueC zu bestätigen und zu definieren, eine zentrale Formel der katholischen Lehre, welche die Wiedervereinigung der West- und der Ostkirchen seit jeher verhindert. (In Lyon hatte auch eine mittelalterhche Ketzerbewegung ihren Ursprung, die sich lange Zeit halten konnte. Der Kaufmann und Wanderprediger Petrus Valdes aus Lyon wurde wegen abweichender theologischer Ansichten von der Kirche gebannt. Doch seine Anhänger, die späteren Waldenser, folgten seinem Beispiel von einem frommen Leben in freiwilliger Armut. Waldensergemeinschaften ließen sich in den Bergen von Savoyen nieder und trotzten jahrhundertelang in bester burgundischer Manier den weltlichen Gewalten.83
Lyon dagegen wurde von inneren Machtkämpfen zerrissen und hatte daher französischen Ränkespielen nicht viel entgegenzusetzen. Der Erzbischof befand sich ständig im Streit mit den Grafen von Lyonnais-Forez und mit den Patriziern der Stadt. Als die Franzosen zuerst den Grafen auf ihre Seite zogen und dann auch die reichen Bürger, geriet der Erzbischof in eine aussichtslose Lage. Im Jahr 1311 nahmen französische Truppen die Stadt ein, ohne auf Widerstand zu stoßen. Der Erzbischof durfte seinen Ehrentitel »Primas der Gallier« behalten, doch die Macht ging auf eine Stadtverwaltung aus gewählten Konsuln über, die ihre Maßnahmen von den Franzosen billigen lassen mussten.84
Die Dauphiné, für die sich Frankreich ebenfalls interessierte, kontrollierte die Straße nach Italien über den Mont Cenis. Doch die Grafen von Albon/Vienne, die Grenoble und die Umgebung des Passes besaßen, hielten sich bis 1349, als sie ihr Gebiet schließlich in einer privaten Transaktion an den König von Frankreich verkauften. Fortan wurde der Titel des Sohnes des Königs und Thronfolgers, des »Dauphin«, von diesem Territorium abgeleitet (ob es weiterhin de jure zum Heiligen Römischen Reich gehörte, ist umstritten).85
In diesem Stadium war das Königreich Burgund schon beträchtlich geschrumpft. Jene Teile, die an Deutschland grenzten, wie Basel und Bern, befanden sich noch unter der Kontrolle des Kaisers. Doch alle Gebiete, die an Frankreich angrenzten, entzogen sich seinem Einfluss. Die deutschen Kaiser fanden sich damit ab. Sie verzichteten zwar nicht förmlich auf ihren Anspruch auf das Königreich, doch nach Konrad IV., der 1254 starb, führten sie den burgundischen Königstitel nicht mehr.
Die politische Zersplitterung sollte sich weiter beschleunigen, doch dieser gängige Begriff wird den komplizierten Prozessen, die sich hier vollzogen, nicht gerecht. Denn nachdem die überkommenen staatlichen Einheiten zusammengebrochen waren, entstanden neue Gebilde, häufig unter Missachtung bestehender staatlicher Grenzen. Heiraten, Brautgaben, Eroberungen und Nachlässe führten zu einer ständigen Abfolge von Zusammenschlüssen, Trennungen und Neugründungen. Der typische burgundische Graf war nicht mehr der Herr über ein direktes Lehen, das einem Oberherrn unterstand. Häufiger war er das Oberhaupt einer Reihe von Gütern, Titeln und Ansprüchen, die im Laufe von Generationen durch die vereinten Bemühungen der Ritter, der Frauen, Kinder und Anwälte seiner Familie entstanden waren.
Bei den burgundischen Pfalzgrafen beispielsweise wurde das ursprüngliche Erbe wiederholt von einem politischen Bereich in einen anderen weitergegeben und durch Heirat von einer Familie zu einer anderen: Im Jahr 1156 fiel es an das deutsche Geschlecht Hohenstaufen, 1208 an das bayerische Haus Andechs und 1315 an das französische Königshaus. Jedes Mal fügte der Begünstigte die Titel und Besitztümer seiner Ehefrau seinen eigenen hinzu, wobei er manchmal den früheren Oberherrn anerkannte, manchmal auch nicht. Für adelige Stammbaumforscher trat 1330 ein wichtiges Ereignis ein, als Jeanne III. von Frankreich, die Gemahlin des Herzogs des französischen Burgund, von ihrer Mutter den Anspruch auf die zum Heiligen Römischen Reich gehörende Freigrafschaft Burgund erbte. Das französische Herzogtum und die deutsche Grafschaft standen damit vor einer dauerhaften Vereinigung. Im Zuge der verwirrenden burgundischen Erbfolge (siehe unten) bemühte sich Margarete, die Freigräfin von Burgund (1310–1382), eine Tochter des französischen Königs, diesen Zusammenschluss zu beschleunigen. Im Jahr 1366 begann sie, ohne besonderen rechtlichen Grund, in ihren Urkunden und Dokumenten den Begriff »France-Comté« (sic) zu verwenden und ließ die traditionelle Bezeichnung »Grafschaft Burgund« fallen. (Damit griff sie das Beispiel von Rainald III. auf, der sich als franc comte bezeichnet hatte.) Die mittlerweile etablierte Bezeichnung »Franche-Comté« entstand eindeutig erst nach Margaretes Tod. Das war das Königreich Nr. VII. auf der Liste von Bryce.86
Die Mitte des 14. Jahrhunderts war in Europa eine schwierige, turbulente Zeit. Im Jahr 1348 wütete der Schwarze Tod, und dies war bei Weitem nicht der letzte Ausbruch der Beulenpest. Frankreich stand vor dem Hundertjährigen Krieg mit England, und im Heiligen Römischen Reich herrschte Aufruhr wegen der Goldenen Bulle von 1356, durch die ein neues Grundgesetz für das Reich eingeführt und die Modalitäten der Königswahl neu geregelt wurden. Infolge der Spaltung der Kirche gab es einen Papst in Rom und einen Gegenpapst in Avignon. Die wenigen verbliebenen Teile des Königreichs Burgund waren oft zwischen den Nachbarstaaten umkämpft. Darüber hinaus brachen gleichzeitig im Königreich Frankreich, im Herzogtum Burgund und in der Freigrafschaft Burgund langwierige Erbfolgekrisen aus.
Dabei ist es hilfreich, wenngleich zu Beginn klargestellt wird, dass drei verschiedene Frauen den Namen »Margarete von Burgund« verwendeten und dass drei verschiedene Männer »Philipp von Valois« genannt wurden. Einer von ihnen, der auch unter dem Namen Philipp von Rouvres (1347–1361) bekannt ist, löste die Krise aus, als er 1361 bei einer Wiederkehr der Pest vorzeitig starb, ohne seine Ehe vollzogen zu haben. Hätte er länger gelebt, hätte er mühelos seine eigenen Ansprüche auf das Herzogtum und jene seiner Gemahlin auf die Freigrafschaft durchsetzen können. Stattdessen fielen seine sämtlichen Titel an konkurrierende Anspruchshalter. Dazu kam, dass der französische König Johann der Gute das Erstgeburtsrecht missachtete und, wiederum aus politischen Gründen, das Herzogtum Burgund für seinen vierten Sohn beanspruchte.
Das forsche Vorgehen dieses vierten Sohnes Philipp von Valois (Philipp dem Kühnen), der sich bereits als junger Mann 1356 in der Schlacht von Poitiers gegen den Schwarzen Prinzen von England hervorgetan hatte, liefert den Schlüssel für alle späteren Entwicklungen. Obwohl er in der französischen Erbfolgelinie nur einen mittleren Platz einnahm, gelang es ihm, maßgeblichen Einfluss auf den Regentschaftsrat auszuüben, der nach dem Tod seines Vaters 1364 jahrzehntelang die französische Politik bestimmte.87 Durch seine Heirat mit Margarete Dampierre, der Witwe von Philipp von Rouvres und Erbin von Flandern (wo sie unter dem Namen Margarete von Male bekannt war), sicherte er sich zudem eine Vielzahl von Ansprüchen und Titeln, die vorher auf verschiedene Personen verteilt gewesen waren. Dazu gehörte auch der Anspruch auf die Freigrafschaft Burgund, der 1384 nach dem Tod ihres Vaters an Margarete zurückfiel. Dies führte zur Bildung eines neuen vereinten Burgund, das im Kern aus einer Union des Herzogtums und der Grafschaft bestand und sich in den letzten beiden Jahrzehnten des langen Lebens von Philipp dem Kühnen formte. Auf der Liste von Bryce erscheint es nicht als eigenes Reich, sondern als eine Kombination aus den Reichen Nr. X und Nr. VII.
Erwartungsgemäß sorgte die Entstehung des neuen Staatswesens, das nur dank der gleichzeitigen Schwäche von Frankreich wie von Deutschland möglich geworden war, für heftige Konflikte. In Frankreich löste sie einen erbitterten und langwierigen Bürgerkrieg zwischen zwei Adelsgruppierungen aus, den »Bourguignons« und den »Armagnacs«, deren Auseinandersetzungen bald vom Hundertjährigen Krieg überlagert wurden. Die Bourguignons setzten sich für gute Beziehungen sowohl zu den Nachfolgern von Philipp dem Kühnen als auch zu den englischen Verbündeten Burgunds ein. Die Armagnacs, die sich als französische Patrioten verstanden, verurteilten die Aktivitäten des abtrünnigen Herzogtums und die verräterische Allianz mit dem englischen Erbfeind. Von 1418 bis 1436 beteiligten sich burgundische Truppen an der englischen Besetzung von Paris. Die Deutschen, durch ihre eigenen Streitigkeiten hoffnungslos zersplittert, waren außerstande, einzugreifen, bis schließlich in den 1430er-Jahren die Ära der Habsburger begann. Niemand, vielleicht mit Ausnahme der Mitarbeiter der Reichskanzlei, erinnerte sich noch daran, dass das Königreich Burgund offiziell noch nicht erloschen war. Unterdessen hatten die Herzöge und Grafen freie Hand.
Das neue Staatsgebilde, das vom Ende des 14. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts bestand, wird allgemein, aber ungenau als »Herzogtum Burgund« bezeichnet, manchmal auch als »Valois-Burgund«; es wurde von einem französischen Fürstengeschlecht regiert, das sich kurzzeitig der Vormundschaft von Paris entziehen und ein eigenständiges wohlhabendes und kultiviertes Reich aufbauen konnte.88 Doch die vorherrschende französische Sichtweise ist nicht notwendigerweise die treffendste, man sollte besser die historische Bezeichnung »Staaten von Burgund« verwenden und für seine Herrscher den doppelten Titel »Herzöge und Grafen«. Der Erfolg dieser Unternehmung beruhte darauf, dass das französische Herzogtum und die deutsche Grafschaft in Personalunion von Herrschern geführt wurden, die ein neues Staatswesen schufen, das weder französisch noch deutsch war. Die Familie von Philipp dem Kühnen war nur zur Hälfte französisch und zur anderen Hälfte flämisch, und da Philipps flämische Ehefrau Margarete von Dampierre als Untertanin des deutschen Kaisers geboren war, gehörte sie zumindest teilweise auch zum Reich. Darüber hinaus lag diesem außergewöhnlichen kleinen Reich der Herzöge und Grafen, das sich von der Boulogne bis zum Schwarzwald erstreckte, die romantische Vorstellung zugrunde, dass es eine Wiedergeburt des vor langer Zeit verschwundenen Lotharingien sei.
Nur vier Herrscher regierten die Staaten von Burgund im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts: Philipp der Kühne/Filips de Stoute (reg. 1364–1404), Johann Ohnefurcht/Jean sans Peur/Jan zonder Vrees (reg. 1404–1419), Philipp der Gute/Philippe le Bon/Filips de Goede (reg. 1419–1467) und Karl der Kühne/Carles le Téméraire/Karel de Stoute (reg. 1467–1477). Die niederländischen und flämischen Historiker haben natürlich eigene Bezeichnungen gefunden. Bei der Auflistung jener Herrscher, die zugleich Herzog und Graf waren, werden auch die nichtburgundischen Grafen von Flandern und Artois berücksichtigt. Zu den burgundischen Landen gehörten aber nicht nur die beiden Burgund sowie Flandern und Artois. Karl der Kühne beispielsweise besaß 15 Titel: Graf von Artois, Herzog von Limburg, Herzog von Brabant, Herzog von Lothringen, Herzog von Burgund, Herzog von Luxemburg, Pfalzgraf von Burgund, Markgraf von Namur, Graf von Charolais, Graf von Seeland, Graf von Flandern, Graf von Zutphen, Herzog von Geldern und Graf von Holland.89
Keiner der burgundischen Herrscher war tatsächlich König, sie waren lediglich Herzöge. Doch mit ihrem höfischen Glanz, ihrem Reichtum, ihren Städten und ihrem üppigen Mäzenatentum übertrafen die Burgunder fast alle gekrönten Häupter dieser Zeit und waren de facto Könige, wenn sie diesen Titel auch nicht trugen.90
Die territoriale Basis des neuen politischen Gebildes unterschied sich deutlich von jenem der vorgehenden burgundischen Reiche. Den Kern bildeten zwar das Herzogtum und die Grafschaft im Süden, doch der größere Teil des burgundischen Länderkomplexes lag in den Küstengebieten im Norden, und der Hauptteil des historischen Burgund wurde davon nicht umfasst. Das persönliche Erbe von Margarete von Dampierre, die aus Brügge stammte, war wesentlich größer und reicher als das ihres Ehemannes. Es erstreckte sich von den ehemals französischen Grafschaften Vermandois und Panthieu bis zu den früher deutschen Grafschaften Holland und Geldern und schloss alle großen niederländischen Städte ein: Amiens, Arras, Brügge, Gent, Brüssel und Amsterdam. Mehrere Lücken im Flickenteppich – Utrecht, Cambrai, Lüttich und Luxueil – waren abhängige Fürstbistümer. Eines der Fragmente des ehemals zum Heiligen Römischen Reich gehörenden Burgund, an dem die deutschen Könige festhielten, war die Grafschaft Neuchâtel (heute ein Kanton in der Nordwestschweiz). Dies wurde möglich, weil König Rudolf I. Neuchâtel in seinen persönlichen Besitz nahm, bevor er es als Lehen an einen seiner Gefolgsmänner übergab. Da dieses Gebiet nahe an Deutschland lag, kümmerte sich der König fortlaufend darum, und so konnte es sich bis zum Westfälischen Frieden 1648 den Zugriffsversuchen sowohl des Hauses Valois-Burgund als auch der schweizerischen Eidgenossen entziehen.91 Von 1707 bis 1806 gehörte es seltsam genug zu Preußen.
Im 15. Jahrhundert erlebten die mittelalterlichen Städte eine Blütezeit. Es bildeten sich zwei bedeutsame Zentren heraus, Norditalien und die Niederlande (d.h. die burgundischen Staaten), die auch zu den Geburtsstätten der Renaissance wurden. Kunst und Gelehrsamkeit gingen Hand in Hand mit Wirtschaft und Handel:
Brügge, zu dieser Zeit die weltläufigste Handelsstadt im nordwestlichen Europa, war unzweifelhaft das pulsierende Herz [von Burgund]. Hunderte Ausländer hatten sich hier niedergelassen … Mindestens zwölf »Nationen« von fremden Kaufleuten … genossen rechtlichen Schutz. Vierzig oder fünfzig Kaufleute der Hanse hielten sich das gesamte Jahr in der Stadt auf. Noch zahlreicher waren die Süditaliener. Außerdem gab es Katalanen, Kastilier, Portugiesen, Basken, Schotten und Engländer.
Brügge war das Zentrum eines weit verzweigten Netzes. Für den sechs Wochen dauernden Pfingstmarkt verließen alle Ausländer Brügge … und begaben sich nach Antwerpen. Dort beherrschten sie den Handel mit teuren Stoffen wie Leinen und Samt und mit Gütern aus Übersee wie Gewürzen, Wein, Öl, tropischen Früchten, Zucker und Pelzen. Somit können wir uns Brügge an der Spitze der Pyramide vorstellen, Antwerpen an der zweiten Stelle und dazu Gent und Ypern als regionale Marktorte.
Seit dem 13. Jahrhundert hatten italienische Firmen den Herrschern der Niederlande Kredite gewährt … Herzog Philipp der Kühne unterhielt enge Beziehungen zu Dino Rapondi, einem Bankier aus Luca … Dino ließ sich in Flandern nieder und lieh dem Herzog und den Städten große Summen Geldes … Mit einem Wechsel über sechzigtausend Franc, einzulösen in Venedig, und einem umfangreichen Darlehen stellte Dino das Lösegeld für Johann Ohnefurcht bereit, der von den Türken 1396 gefangen genommen worden war.92
Die Herrscher des Hauses Burgund unterhielten keinen ständigen Hof. Ihr Heimatstandort war der »Palais de Duc« in Dijon, wo sie den Winter verbrachten, doch im Frühjahr begaben sie sich auf ihren jährlichen Zug; regelmäßige Anlaufstellen waren die alten Grafensitze in Hesdin im Artois und in Mechelen in der Nähe von Antwerpen. Zeitgenossen beschrieben immer wieder ihren Glanz und Prunk. Die Bezeichnung »burgundisch« ist zu einem Inbegriff für teure Kleidung, aufwändige Lebenshaltung und ausgelassenes Feiern geworden. Die Umzüge und Festspiele zum »Einzug« der Herrscher und ihrer Gäste wurden bewusst als politische Schauspiele inszeniert. Der burgundische Hof fühlte sich ausnahmslos allen seinen Nachbarn ebenbürtig:
Der König von Frankreich … reiste nach Troyes in der Champagne … Er wurde begleitet von seinem Onkel, dem Herzog von Bourbon, dem Herzog von Tourraine und vielen anderen Rittern … Bei seinem Einzug in Dijon wurde er von der Herzogin von Burgund mit hohem Respekt und Zuneigung empfangen, und alle, die gekommen waren, erwiesen ihm die Ehre. Große Volksbelustigungen wurden bei dieser Gelegenheit veranstaltet, und der König weilte acht Tage in Dijon.93
Die herrschenden Kreise Burgunds pflegten die Kunst und das Ritterethos mit beispielloser Leidenschaft. Im Jahr 1430 wurde der Ritterorden vom Goldenen Vlies gegründet, der dem englischen Hosenbandorden nachempfunden war. Mit seinen Ritualen und Zeremonien stellte er alle anderen Ritterorden in den Schatten. Das Ordensabzeichen, ein an einer Collane hängendes Widderfell, waren mit den Worten Pretium Laborum Non Vile (»Kein geringer Preis der Arbeit«) versehen.94 Dass ein nichtchristlicher Hintergrund für den Orden gewählt wurde, signalisierte nach außen ein gewisses Interesse an der Antike. Gleiches gilt für die Manuskripte und literarischen Werke wie Épopée troyenne (»Trojanisches Epos«), die die Bibliotheken der burgundischen Herrscher schmückten. William Caxton, der erste englische Buchdrucker, brachte 1473 ein Recuyell of the Histories of Troye heraus, das auf einem burgundischen Original beruhte.95
Die Malerei der flämischen Schule, ein zentraler Bestandteil der Renaissance in den Niederlanden, entwickelte sich mit burgundischer Unterstützung. Maler wie Robert Campin (um 1378–1444) und Jan van Eyck (um 1390–1441), die beide für den Grafen von Holland und Philipp den Kühnen arbeiteten, Roger van der Weyden (um 1400–1464) und Hans Memling (um 1430–1494), ein Deutscher, der sich in Brügge niederließ, trugen maßgeblich zur Verweltlichung der europäischen Kunst bei. Sie wandten sich aufgeschlossen neuen Genres zu, wie etwa Porträts, Stillleben, Alltagsszenen und Landschaften.96 Auch herausragende Bildhauer wurden gefördert. Der Niederländer Claus Sluter (um 1350–1405) wurde Hofbildhauer in Dijon. Sein bekanntestes erhalten gebliebenes Werk ist der Mosesbrunnen, der für die Grabkirche der Herzöge von Burgund im Kloster Champmol geschaffen wurde.97 Auch Tapisserien waren eine burgundische Spezialität. Die aufwändige Technik des Einwebens von Goldfäden in farbige textile Flächengebilde wurde in Arras erfunden. Im 15. Jahrhundert konnten die tapissiers große Wandteppiche anfertigen, die Schlachten, historische Szenen, Legenden und Landschaften darstellten.98
Neben der bildenden Kunst blühte auch die Musik. Die Burgundische Schule entstand in der Herzogskapelle in Dijon, wo man bereits um die Jahrhundertwende den »burgundischen Geist im Lied« hören konnte.99 In der Folge verbreitete sie sich geografisch und veränderte sich auch stilistisch. Guillaume Dufay (um 1397–1470) aus Brabant war vermutlich der berühmteste europäische Komponist in dieser Zeit. Die spätere französisch-flämische Schule brachte eine Vielzahl von Talenten im Umfeld des genialen Joskin van de Velde (um 1450–1520) hervor, der besser bekannt ist unter dem Namen Josquin des Prez und die Polyphonie zu ihrer Vollendung führte.100
Die Literatur der Renaissance befasste sich mit vielen Gebieten von der Dichtkunst bis zur Philosophie. Erasmus von Rotterdam (1466–1536), der bedeutendste Humanist seiner Zeit, war ein Burgunder.101 Neben Latein entwickelten sich die französische und die niederländische Sprache, und die Vermischung der beiden Sprachen wurde als »ein Dialog zwischen zwei Kulturen« bezeichnet. Burgund bildete auch den Hintergrund für eines der wichtigsten historiografischen Werke des 20. Jahrhunderts, Johan Huizingas Herbst des Mittelalters (1919). Der Kulturhistoriker Huizinga, Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität Leiden, entwickelte anhand einer detaillierten Analyse der Rituale, Kunstformen und Schauspiele am burgundischen Hof seine Theorie über den rohen und stark gefühlsbestimmten Charakter des Lebens im Spätmittelalter und widersprach damit der vorherrschenden Meinung, dass es eine von der Anmut der Renaissance, von Ästhetik und aufgeklärten Debatten bestimmte Zeit gewesen sei:
Als die Welt noch ein halbes Jahrhundert jünger war, hatten alle Geschehnisse im Leben der Menschen viel schärfer umrissene äußere Formen als heute. Zwischen Leid und Freude, zwischen Unheil und Glück schien der Abstand größer als für uns; was man erlebte, hatte noch jenen Grad von Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit, den die Freude und das Leid im Gemüt der Kinder heute noch besitzen. Jede Begebenheit, jede Tat war umringt von geprägten und ausdrucksvollen Formen, war eingestellt auf die Erhabenheit eines strengen, festen Lebensstils. Die großen Ereignisse: Geburt, Heirat, Sterben standen durch das Sakrament im Glanz des göttlichen Mysteriums. Aber auch geringere Geschehnisse, eine Reise, eine Arbeit, ein Besuch, waren von tausend Segnungen, Zeremonien, Sprüchen und Umgangsformen begleitet.102
Huizingas Werk war sehr einflussreich, doch es rief auch Ablehnung unter manchen seiner holländischen Kollegen hervor und Befremden bei seinem belgischen Freund Henri Pirenne.103
Trotz ihres außergewöhnlichen kulturellen Engagements stand die Politik für die burgundischen Herzöge im Vordergrund. Burgund tat sich sowohl durch seine Bemühungen zur Schaffung eines integrierten Staatswesens als auch durch seine höchst geschickte Diplomatie hervor. Zwar wurden Aufmüpfigkeiten gewaltsam unterdrückt, doch die Eigenheiten der verschiedenen Teilgebiete des Reiches wurden respektiert; die Herrschaftspraxis beruhte auf etablierten Verfahren und dem Bemühen um Konsens. In einem typischen Erlass vom 13. Dezember 1385 erfuhr die Stadt Gent sowohl die harte Hand ihres Herrschers als auch seinen Großmut:
Philipp I. von Frankreich, Herzog von Burgund, Graf von Flandern und Artois, Pfalzgraf von Burgund … tut es allen kund: unseren vielgeliebten Untertanen in unserer schönen Stadt Gent, die uns inständig angefleht haben, ihnen Gnade angedeihen zu lassen, dass [Wir] alle Übertretungen und Unbotmäßigkeiten verziehen haben … und dass [Wir] alle genannten Gebräuche, Privilegien und Rechte bekräftigen, sofern sie in vollem Umfange [Uns] gegenüber Gehorsam üben.104
Die burgundischen Herzöge nutzten ähnlich wie die englischen Monarchen ihre vielfach verschlungenen Verwandtschaftsverhältnisse, um ihren Anspruch zu untermauern, dass sie die wahren Könige Frankreichs seien, und insbesondere Philipp der Kühne beschäftigte sich eingehend mit den Angelegenheiten Frankreichs. Bei seinem Tod 1404 war seine Position als Vertreter des Hauses Valois und als unabhängiger Herrscher unangefochten. Doch er hatte auch Burgund nicht vernachlässigt. Er war ein vorzüglicher Weinkenner und untersagte in detaillierten Erlassen beispielsweise den Anbau der minderwertigen Rebsorte Gamay oder dass durch übermäßigen Einsatz vom Dünger der Quantität der Vorzug vor der Qualität gegeben werde. Kleinstädte wie Pommard, Nuits St. George und Beaune entwickelten sich während seiner Regierungszeit zu bedeutenden Zentren des Weinhandels. In einem seiner Güter im Château de Santenay an den Hängen der Côte d’Or werden noch heute Weine produziert, die seinen Namen tragen.105 Außerdem war er der erste Bauherr des Palais de Duc in Dijon.106
Phihpps Sohn Jean sans Peur (Johann Ohnefurcht), der als junger Kreuzritter bei Nikopolis gegen die Türken gekämpft hatte, festigte die Macht und den Einfluss des Hauses Burgund. Nach endlosen Auseinandersetzungen mit seinen französischen Verwandten wurde er im September 1419 vom Dauphin zu einer Unterredung auf die Brücke von Montereau in der Nähe von Paris gelockt und dort von dessen Begleitern ermordet.107 Johanns Sohn Philippe le Bon (Philipp der Gute) war als junger Mann Graf von Charolais und führte die burgundischen Lande zu hohem Ansehen und Wohlstand. Er vergrößerte sie durch den Erwerb von Namur und Luxemburg, durch die Eroberung von Holland, Seeland und Friesland in den sogenannten Kalten Kriegen und durch das Erbe von Brabant, Limburg und Antwerpen. Ganz und gar unbescheiden, stellte er sich gerne als »Großherzog des Westens« vor.108
Die Bestattung von Philipp dem Guten wird häufig als eines der prunkvollsten burgundischen Schauspiele gerühmt. Sie fand 1467 in Brügge statt und wurde ausführlich vom Hofchronisten Chastellain beschrieben. Hunderte schwarz gekleidete Trauergäste wurden auf Kosten des Hofes mit Umhängen ausgestattet, die ihren gesellschaftlichen Status zum Ausdruck brachten. In der Kirche St. Donatian in Brügge waren so viele Kerzen entzündet worden, dass man die Buntglasfenster durchbrechen mussten, um die Hitze entweichen zu lassen. Zwanzigtausend Zuschauer verfolgten den Fackelzug:
Die sterblichen Überreste von Herzog Philipp … wurden in einen geschlossenen bleiernen Sarg gebettet, der mehr als 240 Pfund wog. Ein goldenes Tuch, das 32 Ellen maß und mit schwarzem Satin besetzt war, bedeckte den Sarg. Zwölf Armbrustschützen der Garde trugen ihn, während das goldene Sargtuch von 16 Baronen gehalten wurde … Ein Baldachin, der auf vier großen Stangen ruhte, wurde von vier burgundischen Edlen in die Höhe gehoben: den Grafen von Joigny, Bouquan und Blancquehain sowie dem Seigneur von Chastelguion. Unmittelbar dahinter gingen Meriadez, der Oberstallmeister … und der fürstliche Beisetzungsleiter. Er trug das Herzogsschwert seines verstorbenen Herrn, das in seiner reich verzierten Scheide steckte und mit der Spitze auf den Boden zeigte.109
Während der Beisetzung wurde das Schwert, ähnlich wie im französischen Hofzeremoniell, an Karl übergeben, den Sohn und Erben des Verstorbenen. Dies symbolisierte die Kontinuität der fürstlichen Herrschaft – es wies aber auch bereits darauf hin, dass Karl sich des Schwertes ausgiebig bedienen sollte.
Charles le Téméraire erhielt die Beinamen »der Kühne«, der »Tapfere« oder auch »der Schreckliche«. Er war Sohn einer portugiesischen Prinzessin und aufgrund aufeinanderfolgender Eheschließungen Schwager der Könige von Frankreich und von England. Seine kriegerische Einstellung zeigte sich schon vor dem Tod seines Vaters, als er 1466 in der aufständischen Stadt Dinant alle Männer, Frauen und Kinder töten ließ. Sein größter Fehler war, dass er gleichzeitig alle Nachbarn gegen sich aufbrachte, und während der komplizierten burgundischen Kriege in den 1470er-Jahren verbündeten sich schließlich seine Feinde gegen ihn. Bald sah er sich im Westen von Ludwig XI. von Frankreich bedrängt, der auch »der Listige« oder »die Spinne« genannt wurde, und im Osten von den Lothringern, den Kaiserlichen und den Schweizern.110
Die Schweiz, die sich mittlerweile große Teile des früheren »Hochburgund« einverleibt hatte, erwies sich als der gefährlichste Gegner des burgundischen Reiches. In drei Schlachten wurde Karl gedemütigt, ausgespielt und schließlich vernichtet. In der Schlacht bei Grandson im Kanton Waadt (2. März 1476), wo er zuvor die Garnison massakriert hatte, wurden Karls Truppen in die Flucht geschlagen, und den Eidgenossen fiel in deren zurückgelassenen Lagern reiche Beute in die Hände, darunter auch Karls silberne Badewanne. In der Schlacht am See von Morat (Murten) im Kanton Bern (22. Juni 1476) wurde Karls Armee praktisch ausgelöscht, und viele seiner Soldaten ertranken. Bei der Belagerung von Nancy (5. Januar 1477) fand auch Karl schließlich den Tod. Der Chronist Philippe de Commynes berichtete, was er erfahren hatte:
Die wenigen Soldaten des Herzogs … die in schlechter Verfassung waren, wurden sogleich entweder getötet oder in die Flucht geschlagen … Der Herzog von Burgund fiel im Feld … Wie dies geschah, wurde mir von Gefangenen erzählt, die sahen, wie er zu Boden gestoßen wurde … Eine Gruppe von Soldaten stürzte sich auf ihn, tötete ihn und beraubte seinen Leichnam, ohne ihn zu erkennen. Dieser Kampf … fand am Vorabend der Erscheinung des Herrn statt. [Zwei Tage später] wurde der nackte Leichnam des Herzogs, der mitüerweile zu einem Eisklumpen gefroren war, erkannt: Der Kopf war bis zum Kinn von einer schweizerischen Hellebarde gespalten und der Leib mehrfach von schweizerischen Lanzen durchbohrt worden.111
Commynes, der früher Karl dem Kühnen gedient hatte, traf ein hartes Urteil. »Nicht einmal halb Europa«, schrieb er, »hätte ihm genügt.«112
Als »Beute von Burgund« wurden die vielen kostbaren Kunstgegenstände bezeichnet, die den Schweizern bei Grandson in die Hände fielen und die später auf dem europäischen Kunstmarkt auftauchten,113 doch diese Bezeichnung lässt sich auch auf das Schicksal des gesamten burgundischen Herrschaftsverbunds beziehen. Im Laufe weniger Jahre zerfiel der Machtbereich der burgundischen Herzöge und Grafen. Das Herzogtum, das schnell von französischen Truppen besetzt wurde, fiel an Frankreich. Die Freigrafschaft, »Franche-Comté«, kam einige Zeit später zum Heiligen Römischen Reich. Damit war die Verbindung zwischen dem Herzogtum und den Niederlanden durchtrennt.
Die 19 Jahre alte Tochter des verstorbenen Herzogs, Maria von Burgund (1457–1482), konnte sich nun vor Freiern kaum mehr retten. Da sich die Franzosen ihr Herzogtum angeeignet hatten, blieben ihr nur noch die Niederlande. Doch auch dort brodelte es. Die niederländischen Adeligen wollten ihr erst dann zu heiraten erlauben, wenn sie ihnen ein »Großes Vorrecht« eingeräumt und alle Verpflichtungen aufgehoben hatte, die ihnen ihr Vater auferlegt hatte. Schließlich durfte Maria ihre freie Wahl treffen, und sie entschied sich für Maximihan von Habsburg, den Sohn des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Die Hochzeit fand in Gent am 19. August jenes Jahres statt, das mit der Schlacht von Nancy begonnen hatte. Fünf Jahre später lebte Maria nicht mehr – sie kam bei einem Sturz vom Pferd ums Leben114 –, doch in dieser kurzen Zeit hatte sie drei Kinder zur Welt gebracht, die das politische Vermächtnis ihrer Heirat sicherten. Ihr verwitweter Ehemann wurde Erbe des Kaisertitels, ihr Sohn Philipp IV. heiratete die Königin von Aragónien und Kastilien, und ihr Enkel, Karl von Gent, Keizer Karel, besser bekannt als Kaiser Karl V., sollte die größte Ansammlung von Titeln und Territorien sein eigen nennen, die jemals ein europäischer Monarch besaß.115
In geografischer Hinsicht war das bedeutendste Ergebnis der Regelung von 1477 die dauerhafte Trennung des Herzogtums Burgund vom Rest des »Burgundischen Erbes«. Das Herzogtum kehrte zurück in das Königreich Frankreich, in dem es als »Bourgogne« eine der Provinzen des Ancien regimes wurde. Die restlichen Gebiete fielen an die Habsburger, die für zusätzliche Verwirrung sorgten, indem sie den Titel »Herzog von Burgund« annahmen, ohne das Herzogtum zu besitzen. Der Titel des Herzogs von Burgund, den alle habsburgischen Kaiser von 1477 bis 1795 führten, bezog sich daher auf ein ganz anderes Gebiet als jenes, das einst dem Titel »König von Burgund« zugrunde gelegen war und den die früheren Kaiser verwendet hatten.
Die Freigrafschaft entwickelte sich in eine andere Richtung. Im Jahr 1477 wurde sie von Frankreich annektiert, aber 16 Jahre später kam sie durch den Vertrag von Senlis wieder zum Heiligen Römischen Reich und wurde von den Habsburgern als „heimgefallenes Lehen“ [A. d. Red.] dem »Burgundischen Erbe« hinzugefügt. Ihr Status wurde 1512 bekräftigt, zu einer Zeit, als der Titularherzog Karl II., (der noch nicht Kaiser Karl V. war) die Schaffung einer neuen Verwaltungseinheit, des Burgundischen Reichskreises, erwog.116 Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gab es im Heiligen Römischen Reich zehn derartige Reichskreise. Der Burgundische Reichskreis, der formell 1548 gebildet wurde, ist das Reich Nr. IX auf der Liste von Bryce.
Doch der Frieden von Senlis hatte keinen Bestand, und so wurde ein dauerhafter Kriegszustand zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich zu einem bestimmenden Merkmal der modernen europäischen Geschichte. Im Zuge dieser Entwicklung wurde das Territorium des Burgundischen Reichskreises allmählich immer weiter verkleinert, wie es auch mit dem Königreich Burgund geschehen war. Im Jahr 1512 umfasste der Reichskreis 20 Landesherrschaften. Im Lauf der Jahre schrumpfte er immer mehr. Im Jahr 1555 wurde ein großer Teil der Burgundischen Niederlande in die Hoheit des Königreichs Spanien übertragen, doch 25 Jahre später löste sich die Hälfte dieser Provinzen aus der spanischen Herrschaft und gründete die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (Vereinigte Niederlande). Als die verbliebenen Territorien schließlich 1715 von Spanien an Österreich zurückgeben wurden, bildeten nur noch acht der ursprünglich 20 Provinzen die »Österreichischen Niederlande«.117 (Das Herzogtum Lothringen dagegen, wo Karl der Kühne gestorben war, wurde nicht in den Reichskreis eingegliedert. Es blieb nominell unabhängig, und sein letzter Herrscher, le bon roi Stanislas (reg. 1735–1766), war ein arbeitsloser polnischer Monarch, dessen Tochter zufällig Königin von Frankreich war.118)
Auch die Entwicklung der Freigrafschaft, der »Franche-Comté«, verlief außergewöhnlich. Der Großteil der Region gelangte 1553 zusammen mit dem Rest des Reichskreises unter spanische Herrschaft. Doch die Hauptstadt dieses Gebietes, Besanz (Besançon), blieb bis 1651 eine Reichsstadt innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Dann war es eine Generation lang die Hauptstadt des »El Contado Franco«, bis es 1678 durch den Vertrag von Nijmegen zusammen mit dem übrigen Territorium an Frankreich abgetreten wurde, wodurch die letzte Verbindung des Heiligen Römischen Reiches mit seinem früheren Königreich Burgund beseitigt wurde.119
Die Provinzen Bourgogne und Franche-Comté waren von der Regierungszeit Ludwigs XIV. bis zur Französischen Revolution Bestandteile des Königreichs Frankreich. Die Einwohner der Bourgogne, die von Dijon aus verwaltet wurde, hießen offiziell Bourguignons und Bourguignonnes; die Bewohner der Franche-Comté, deren Verwaltungszentrum Besançon war, nannte man Comtois und Comtoises. Im Jahr 1791 wurden beide Provinzen aufgelöst und durch republikanische Departements mit Namen ohne historische Bezüge ersetzt. Alles was mit dem Ancien régime zusammenhing, wurde verachtet und streng gemieden. Die Franzosen sollten sich nicht mehr als Bewohner einer bestimmten Provinz verstehen und das Königreich Frankreich vergessen, insbesondere die vielen burgundischen Reiche.120
Der moderne französische Staat ist bekannt für seine zentralisierte Verwaltungsstruktur. Im Laufe der beiden letzten Jahrhunderte hat sich jedoch vieles verändert. Die revolutionäre Republik wurde vom Kaiserreich abgelöst; darauf folgten ein restauriertes Königtum, eine zweite Republik, ein zweites Kaiserreich und dann eine dritte, vierte und fünfte Republik. Eines hat sich in dieser Zeit aber nicht geändert: Paris gab die Richtung vor, der Rest von Frankreich folgte.
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diese Praxis etwas modifiziert. Im Jahr 1956 wurde zur Verbesserung der staatlichen Planungsmöglichkeiten ein gewisses Maß an Dezentralisierung eingeführt, und 1982 wurden Regionalräte geschaffen. Seither ist Frankreich in 22 Regionen gegliedert, die in Größe und Form weitgehend den 34 vorrevolutionären Provinzen entsprechen. Eine dieser Regionen heißt Bourgogne, ihr unmittelbarer Nachbar Franche-Comté.121 Doch die französischen Regionen besitzen keine vergleichbaren Kompetenzen wie die Landesteile des Vereinigten Königreiches nach der Umsetzung der Devolutionspolitik oder die schweizerischen Kantone. Die Macht der französischen Zentralregierung wurde nicht eingeschränkt, sondern nur ein wenig beschnitten; Bezüge auf historische Formationen spielen kaum eine Rolle. Die Bürokraten und Politiker der Nachkriegszeit, welche die Regionen schufen, dachten anscheinend nur bis zum Ancien régime. Sie ignorierten die burgundischen Hintergründe von Franche-Comté und wiesen den Namen Burgund ausschließlich dem früheren Herzogtum zu. Dabei wird übersehen, dass die Region, die heute »Rhône-Alpes« heißt, ebenso stark burgundisch geprägt ist wie die übrigen.122
Dennoch ist die historische Erinnerung noch bemerkenswert lebendig. Sie mag ungenau, verworren oder verzerrt sein, aber sie ist nicht völlig verschwunden. Zwischen der Auflösung des merowingischen Burgund und der Gründung des karolingischen Herzogtums vergingen 111 Jahre; zwischen der Abschaffung der königlichen französischen Provinz »Bourgogne« und ihrem Wiederaufleben als Region verstrichen 162 Jahre. Diese Zeitspannen sind nicht lange genug, dass das kollektive Bewusstsein alles vergisst. Heute scheint es, als habe die Erinnerung an das Burgund des 15. Jahrhunderts jene an die anderen Epochen verdrängt, wahrscheinlich wegen der künstlerischen Pracht dieser Zeit. Doch man sollte niemals »nie« sagen. Vielleicht kommt noch der Tag, an dem die Bürger von Genf, Basel, Grenoble, Arles, Lyon, Dijon und Besançon ihre Banner entrollen und ihre Hymne singen werden: »Burgund ist nicht vergangen, so lange wir leben!« Und dann laden sie vielleicht einen Vertreter oder eine Delegation aus Bornholm zu ihren Feierlichkeiten ein.
Die »Anmerkung A« von Bryce über die burgundischen Reiche umfasste zehn Punkte und er erwähnte einen möglichen elften. Bryce beschäftigte sich nicht mit den Provinzen des Ancien régime und konnte aus offensichtlichen Gründen auch die heutigen Regionen nicht aufnehmen. Dennoch ist seine Aufzählung von zehn oder elf »burgundischen Reichen« eindeutig zu kurz. Je nach Definition gab es fünf, sechs oder sieben Königreiche, zwei Herzogtümer, eine oder zwei Provinzen, eine Frei- oder Pfalzgrafschaft, eine Landgrafschaft, ein Gebilde, das man als »Vereinte Staaten« bezeichnen könnte, einen Reichskreis und zumindest eine Verwaltungsregion. Damit umfasst die Liste mindestens 13 und maximal 16 Staaten. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, kann man durchaus davon sprechen, dass es in der Geschichte insgesamt 15 burgundische Reiche gegeben hat. Das erinnert an den lateinischen Wahlspruch von Philipp dem Guten Non Aliud (»Nichts anderes«) – den man frei vielleicht auch mit »Genug, aber nicht zu viel« übersetzen könnte.123
Es erscheint daher angebracht, die Auflistung von Bryce in überarbeiteter Form noch einmal aufzugreifen:
| 1. 410–436 | Das erste burgundische Königreich von Gundahar (Bryce Nr. I) |
| 2. 451–534 | Das zweite burgundische Königreich, gegründet von Gundioch |
| 3. um 500–734 | Das dritte (fränkische) Königreich Burgund (Bryce Nr. II) |
| 4. 843–1384 | Das französische Herzogtum Burgund (Bryce Nr. X) |
| 5. 879–933 | Das Königreich Niederburgund (Bryce Nr. III) |
| 6. 888–933 | Das Königreich Hochburgund (Bryce Nr. IV) |
| 7. 933–1032 | Das vereinte Königreich der beiden Burgund (Königreich Arelat) (Bryce Nr. V) |
| 8. um 1000–1678 | Die Frei- oder Pfalzgrafschaft Burgund (Franche-Comté) (Bryce Nr. VII) |
| 9. 1032–? | Das Königreich Burgund im Heiligen Römischen Reich |
| 10. 1127–1218 | Das Herzogtum Klein-Burgund im Heiligen Römischen Reich (Bryce Nr. VI) |
| 11. 1127 | Die Landgrafschaft Burgund im Heiligen Römischen Reich (Bryce Nr. VIII) |
| 12. 1384–1477 | Die vereinten »Staaten von Burgund« (Machtbereich des Hauses Burgund) |
| 13. 1477–1791 | Die französische Provinz Burgund (Bourgogne) |
| 14. 1548–1795 | Der Burgundische Reichskreis (Bryce Nr. IX) |
| 15. seit 1982 | Die gegenwärtige französische Region Bourgogne |