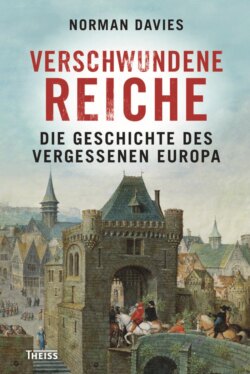Читать книгу Verschwundene Reiche - Norman Davies - Страница 21
III
ОглавлениеSucht man nach Informationen, geht man heutzutage mit dem Computer ins Internet. Dort ruft man Suchmaschinen wie Webcrawler, Yahoo, Google oder Baidu auf, tippt ein Schlüsselwort ein, klickt einmal mit der Maus, und im Handumdrehen erscheinen unzählige »Treffer«. Nach Meinung von Traditionalisten, die noch auf herkömmliche Rechercheverfahren setzen, bringt die neue Technik aber häufig unbrauchbare Ergebnisse.
Im Falle von »Burgund« ergab eine Suche bei Google (im Februar 2009) rund 23,9 Millionen Einträge. Die Liste wurde verlängert durch die Option, den Schlüsselbegriff oder die Schlüsselbegriffe definieren zu lassen. Der Klick auf »Definition«, der von der Seite »answers.com« bereitgestellt wurde, erbrachte Folgendes:
Burgund Eine historische Region und frühere Provinz im Osten Frankreichs. In dieser Region wurde erstmals im 5. Jahrhundert von den Burgundern, einem germanischen Volk, ein Königreich begründet. Auf dem Höhepunkt seiner Macht im 14. und 15. Jahrhundert beherrschte es große Gebiete in den heutigen Niederlanden, in Belgien und Nordostfrankreich. Im Jahr 1477 wurde es durch Ludwig XI. in die französischen Kronlande eingegliedert.124
Man möchte ja nicht unnötig pedantisch sein, doch wer nach genauen Informationen sucht, sei gewarnt: Jeder Satz in der vorstehenden Definition enthält falsche oder irreführende Behauptungen. So liegt beispielsweise das Gebiet, in dem die Burgunder erstmals ein Königreich errichteten, nicht in Ostfrankreich.
Doch man sollte mit den Autoren von »answers.com« auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Wenn es insgesamt 15 burgundische Reiche gegeben hat, dann haben sie drei erfasst, also 20 Prozent, was bei näherer Betrachtung gar nicht so übel ist. Dazu kommt, dass ihre fehlerhaften Informationen aus glaubwürdigen Quellen stammen. The Britannia Concise Encyclopedia, auf die sich »answers.com« stützt, definiert Burgund als eine »historische und administrative Region, Frankreich«. In der Wikipedia-Enzyklopädie ist die Rede von einer »historischen Region im heutigen Frankreich und der Schweiz die im 4. Jahrhundert von den Römern … den Burgunder zugewiesen wurde, die dort ihr eigenes Königreich errichteten«.125
Die Unterschiede zwischen diesen Definitionen sind augenfällig. Gemeinsam ist ihnen aber der Aspekt der Unbeweglichkeit: Sie versuchen beide, den Begriff Burgund fest mit einem bestimmten Gebiet zu verknüpfen. Keine erfasst das wesentliche Merkmal, nämlich dass der Name Burgund im Laufe der Geschichte eine komplexe Wanderung vollzogen hat.
Studenten werden häufig davor gewarnt, sich Informationen aus dem Internet zu beschaffen. Als besonders suspekt gilt Wikipedia, die in Gemeinschaftsarbeit erstellte freie Online-Enzyklopädie. »Wie kann man hier die Angaben überprüfen?«, lautete eine häufig gestellte Frage. »Die Leute können doch schreiben, was ihnen gerade einfällt.« Derartige Befürchtungen sind zweifellos nicht unbegründet. Doch damit geht meist die Annahme einher, dass die traditionellen, gedruckten Nachschlagewerke, »die anerkannten Autoritäten«, von vornherein verlässlicher und vertrauenswürdiger seien. Eine Probe aufs Exempel liefert ein Vergleich von Internetseiten mit den herkömmlicheren, akademischen Produkten.
Burgund ist zweifellos ein komplexer Begriff. Er ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bezüge und Assoziationen verbunden. Im Englischen beispielsweise hat er zwei Bedeutungen: Er bezeichnet einen Ort und ein Produkt. Im Shorter Oxford English Dictionary (SOED) wird der Ort definiert als »1. Ein Königreich und später ein Herzogtum im Heiligen Römischen Reich, nach dem anschließend eine französische Provinz benannt wurde«. Das Produkt ist »2. Ein Wein, der in Burgund erzeugt wird«. Natürlich kann man von Engländern nicht erwarten, dass sie sich in Angelegenheiten des europäischen Kontinents besonders gut auskennen, und es ist daher nicht völlig überraschend, dass auch der Eintrag im SOED Fehler enthält. Überraschend ist allerdings, dass eine fehlerhafte Wortstellung die Zusammenhänge unnötig verwirrt. Hätte der Eintrag gelautet »1. Ein Königreich im weströmischen Reich und später ein Herzogtum …«, wäre er korrekt, wenn auch unvollständig gewesen. Doch so wie er formuliert ist, ist er sowohl ungenau als auch unvollständig. Und was den Wein betrifft, so dürften Weinkenner wohl vom Grausen gepackt werden bei der Vorstellung, dass jedem angejahrten Fusel aus dieser Region das Qualitätssiegel »Appellation d’Origine Contrôlee«, die kontrollierte Herkunftsbezeichnung, zustünde (Trefferquote 1:15).126
Im ausführlichen Oxford English Dictionary (OED) werden die oben genannten Definitionen wiederholt und weitere hinzugefügt:
– »rote Farbe des Burgunderweins«
– »Kopfbedeckung für Frauen = BOURGOIGNE (veraltet)«
– »Burgunder-Heu«: Bezeichnung britischer Autoren für die Luzerne (Medicago sativa), im Französischen aber ursprünglich Sainfoin (Onobrychis sativa) (die beiden Bezeichnungen wurden früher gleichbedeutend verwendet)
– »Burgundische Mischung, ein Präparat aus Soda und Kupfersulfat, das zum Besprühen von Kartoffelpflanzen verwendet wird«
Unter »Burgunder« wird zuerst »zu Burgund gehörend« (adj.) und »Bewohner von Burgund« aufgeführt, dann erwähnt das OED seltsamerweise »eine der teutonischen Nationen Burgunds« und »2. (in der Form von Burgonian) ein Schiffstyp … der in den burgundischen Landen gebaut wurde, zu denen im 15. Jahrhundert auch die Niederlande gehörten.« Die »teutonische Nation Burgunds« ist eine begriffliche Verballhornung, aber zumindest die geografische Verortung ist nicht frankozentrisch.127
Webster’s American Dictionary gibt sich minimalistisch. Es bietet eine »Region in Frankreich« an, einen »verschnittenen Rotwein, der in anderen Regionen (wie etwa Kalifornien) erzeugt wird« und »eine rötliche Farbe«. Dies suggeriert, dass ein kalifornischer Burgunder das einzig Wahre sei, ein Burgunder aus Burgund dagegen eher von geringerer Qualität.
Man könnte annehmen, dass die Franzosen selbst besser informiert sind. Das Littré gehört zu den älteren französischen Enzyklopädien: »BOURGOGNE, s.m vin de Bourgogne. E de Burgundi, nom d’un peuple germain, s.f nom vulgaire du sanfoin.« Die Definitionen sind dürftig: ein Wein, ein Staat, ein Volk und eine Pflanzenart, genau wie im Oxford English Dictionary. Doch dann folgen noch die Kopfbedeckung, die Provinz und, völlig unüblich, »ein abgebrochenes Stück einer Packeisscholle«: nom donné par les marins aux morceaux de glace détachée de la banquaise«. Diese Eisschollen hat aber sonst noch niemand zu Gesicht bekommen.
Als Nächstes kommt der Robert, und abermals ist die Ausbeute enttäuschend. Wie im Littré ist Burgund auch hier nicht mehr als eine Provinz. Und trotz der Auflistung von Grand Crus gibt es keinen Hinweis auf die AOC.
Daher greift man zu Imbs und seinem Trésor de la langue française (»Schatz der französischen Sprache«). Auch dieses Werk ist nicht ergiebiger. Burgund ist immer noch lediglich eine Provinz (Trefferquote 1:15). Doch es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für die alten Burgunder (Burgondes) und die gegenwärtigen (Bourguignons). Dennoch muss man feststellen: Definitionen in Nachschlagewerken sind in hohem Maße unzureichend, vor allem wenn es um historische Fragen geht.
Enzyklopädien sind eine sehr breitgefächerte Kategorie. The New Encyclopedia Britannica (1974) kann sich auf die überragende Encyclopedia Britannica (11. Auflage, 1911) stützen. Sie enttäuscht den Suchenden nicht. Nachdem sie die alten Burgunder als »Skandinavier« beschreibt, stellt sie kurz die sechs burgundischen Königreiche sowie die Freigrafschaft vor, erwähnt ein Herzogtum, die »Staaten von Burgund« und auch die Provinz. Das siebte Königreich wird zumindest angedeutet. Es fehlen nur der Reichskreis, ein Herzogtum, eine Landgrafschaft und die Provinz (Trefferquote 11:15).
Der Nouveau Petit Larousse, ein allgemein bekanntes Werk in Frankreich, beginnt mit einer unbefriedigenden Definition: Burgund, »eine Region in Ostfrankreich, die mehr eine historische als eine geografische Einheit darstellt«. Doch der nachfolgende Artikel umfasst sechs Königreiche, dazu die Freigrafschaft, das Herzogtum, die »Staaten von Burgund« und die Provinz. Aber auch hier kein Reichskreis. Der Text schließt mit den Worten: »Burgund gehörte lange Zeit zu Deutschland. Die französischen Könige lösten es im Laufe der Jahrhunderte allmählich aus dieser Verbindung.« Wer hätte das gedacht: Der Larousse ist nicht frankozentriert.128
Entscheidend ist der internationale Aspekt des Problems, denn die burgundische Frage überschreitet nationale Grenzen. Idealerweise sollte man daher nicht nur Nachschlagewerke aus Frankreich, sondern auch aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz heranziehen. Jede dieser Quellen würde in einigen Punkten aussagekräftiger sein als in anderen.
Wir haben beispielsweise einen deutschen Brockhaus zur Hand. Der Eintrag ist angemessen lang und ausführlich. Er unterscheidet zwischen dem Burgund der Gegenwart, das als »eine Region, die aus fünf Departements besteht«, definiert wird, und fünf burgundischen Reichen der Vergangenheit: dem Königreich der Burgunder ab 443, dem Burgund der Franken ab 534, dem Königreich Burgund (Arelat), dem Herzogtum Burgund und der Freigrafschaft Burgund (Franche-Comté). Bei der Erklärung der Entstehung von Arelat führt der Brockhaus auch das »Königreich Niederburgund« auf. Überraschenderweise fehlt aber auch hier der Reichskreis.129
Auf der Suche nach einer unparteiischen Sichtweise wenden wir uns einem Land zu, das keine direkte Beziehung zu Burgund hatte. Wir haben eine alte Ausgabe der Wielka Encyklopedia Powszechna PWN zur Verfügung. Daraus ergibt sich, dass die Polen nach wie vor die lateinische Form des Namens (Burgundia) verwenden. Die Enzyklopädie beschreibt Burgund als »ein historisches Gebiet (kraina historyczna) in Ostfrankreich« und als »eine bedeutende Weinbauregion«. Doch die ausführliche historische Darstellung weist auch einige Mängel auf. Man begegnet dem »Königreich der germanischen Burgunder aus dem 5. Jahrhundert«, den Königreichen Hochburgund, Niederburgund und Arelat und einem ab 1032 existierenden »Königreich innerhalb des deutschen Reiches«. Dass fünf von sieben möglichen Reichen erwähnt werden, ist eine gute Trefferquote. »Der Name Burgund«, fährt das Lexikon fort, »blieb nur in der Freigrafschaft (Franche-Comté) erhalten, die bis 1382 zu Deutschland gehörte«. Diese Aussage ist ungenau, doch die allgemeine Darstellung entspricht den Tatsachen. »Die große Blütezeit des Herzogtums begann unter der Herrschaft von Filip Smialy (Philipp dem Kühnen)«, heißt es. Und wie in vielen anderen Nachschlagewerken endet die Darstellung nicht mit dem letzten Herzog und Grafen aus dem Hause Valois. »Nach dem Tod von Karl dem Kühnen 1477 heiratete Marie, seine Alleinerbin, Erzherzog Maximilian von Österreich, worauf eine erneute Teilung Burgunds folgte. Frankreich erhielt das Herzogtum B. zurück sowie die Picardie. Die Habsburger behielten die Niederlande sowie Franche-Comté, das schließlich 1678 an Frankreich zurückfiel130 (Trefferquote 9:15). Noch immer kein Reichskreis.
Wer nicht Französisch, Deutsch oder Polnisch beherrscht, muss seine Hoffnungen in das vor kurzem erschienene Werk Gazetteer of the World setzen, das von einer angesehenen amerikanischen Institution herausgegeben wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung geografischer Orte und historischer Territorien: »Burgund (BUHR-ghun-dee), fr. Bourgogne (BOORGON-yuh), historische Region und frühere Provinz in Zentral- und Ostfrankreich. Der Name leitet sich ab von zwei alten Königreichen und einem Herzogtum, die ein wesentlich größeres Gebiet umfassten als die Provinz im 17. und 18. Jahrhundert. Nach 1790 wurde B. in Departements aufgeteilt. Heute bildet es eine Verwaltungsregion Frankreichs.« So weit, so gut. Doch dann schleichen sich Anachronismen ein: »Von Cäsar in den Gallischen Kriegen erobert, wurde es später (im 5. Jh. n. Chr.) von den Burgunder besiedelt, einem deutschen Stamm, der das erste Königreich Burgund errichtete.« Zeiten und Orten werden falsch zugeordnet, und dann folgen zahlreiche weitere Missverständnisse:
Nachdem es während der Merowinger- und Kapetinger-Herrschaft geteilt gewesen war, wurde es (933) wiedervereinigt zum zweiten Königreich, welches das Cisjuranische Burgund (bereits Provence genannt) im Süden und das Transjuranische Burgund im Norden umfasste. Kurze Zeit später wurde durch Kaiser Karl II. ein kleineres Herzogtum Burgund geschaffen, das (1034) im Heiligen Römischen Reich aufging. Das Herzogtum erlebte sein goldenes Zeitalter unter Philipp dem Guten und umfasste die heutigen Niederlande und Belgien sowie Nord- und Ostfrankreich.
Der Ausdruck »kurze Zeit später« zeigt, dass sich die Verfasser verzweifelt bemühen, aus dem Sumpf herauszukommen. In der Chronologie herrscht ein ziemliches Durcheinander, die Namen sind verkehrt, und dass das Herzogtum im Heiligen Römischen Reich aufgegangen wäre, ist reine Einbildung. Doch im letzten Abschnitt gewinnen die Tatsachen doch wieder die Oberhand:
Im 15. Jahrhundert war Burgund … ein Zentrum der Kunst, das das übrige Europa überstrahlte. Doch die Kriege des ehrgeizigen Karls des Kühnen erwiesen sich als ruinös. … Seine Tochter, Maria von Burgund, führte durch ihre Heirat mit Kaiser Maximilian den Großteil des erweiterten Burgund (nicht aber das französische Herzogtum) mit dem Haus Habsburg zusammen. Das Herzogtum wurde von Ludwig XI. annektiert, der es zu einer französischen Provinz machte … Durch Burgund führen heute die wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen Paris, Lyon und Marseille.131
(Trefferquote: schwer zu berechnen)
Was soll man also tun, wenn man Informationen sucht? Insgesamt betrachtet, sind die »anerkannten Autoritäten« nicht weniger unvollkommen als alle anderen Quellen. Wie jede Bibliothek enthält das Internet Werke von unterschiedlicher Qualität. Wie alle Quellen muss es mit einem wachen kritischen Auge genutzt werden, aber es ist nicht von vornherein schlechter als die anderen. Untersuchungen haben ergeben, dass es Wikipedia trotz aller seiner Schwächen durchaus mit dem meisten bekannten akademischen Namen aufnehmen kann. Es hat den Vorteil, dass es ständig korrigiert und auf den neuesten Stand gebracht wird.132
Die Suche lässt sich endlos weiterführen. Der Unermüdliche wird vielleicht die von vielen verschiedenen Autoren verfassten historischen Sammelwerke heranziehen, die häufig auch als Nachschlagewerke empfohlen werden. Bedauerlicherweise beginnt das entsprechende Kapitel beispielsweise in der großen New Cambridge Medieval History nicht sehr vielversprechend. »Die Region, die als Burgund bezeichnet wird«, heißt es hier, »besaß die beweglichste Grenze aller französischen Regionen.« Abermals wird Burgund nur in seiner begrenzten französischen Form wahrgenommen. Mediävisten sollten doch etwas mehr Sorgfalt walten lassen.133
Andere versuchen vielleicht ihr Glück mit alten Büchern mit romantisch klingenden Titeln. The Lost Kingdom of Burgundy beispielsweise, das zwischen Fakten und Fiktion hin und her schwankt, beginnt mit einer blumigen Eröffnung. »In einer Nacht wie dieser«, raunt der erste Satz geheimnisvoll, »ritt Karl von Burgund in den Tod. Er verlor sein Reich, weil er es nicht wagte, eine schöne Frau zu retten.« Einige Seiten später wird es noch schlimmer: »Das Königreich lebt weiter, weil seine unterschiedlichen Könige, heruntergekommenen Krieger, Gitarre spielenden Haudegen und Keulen schwingenden Chorknaben sich weigerten, in ihren modrigen Gräbern zu verharren.« Auf Seite 8 stößt man schließlich auf einen Satz, der alles andere verzeihen lässt: »Das alte Burgund war und ist etwas ganz anderes als das Frankreich, das es geschluckt hat – eine Art von Atlantis, das von Wogen immer neuer Völker verschlungen wurde.« Dieser Autor verfügte über die unschätzbare Fähigkeit zur anteilnehmenden Sympathie, die den wesentlich renommierteren Sammel- und Nachschlagewerken abgeht. Und er brachte einen weiteren großartigen Satz hervor: »Das Mondlicht«, so schrieb er, »ist der beste Wiedererschaffer verschwundener Reiche.«134
A Der Autor dieser Einschätzung, R. Lane Poole, der zeitweilige Chefredakteur der Fachzeitschrift English Historical Review und Fellow des Magdalen College in Oxford, mühte sich wacker mit diesem Problem. Seine Notes on Burgundy, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, konnte man leicht als eine staubtrockene Abhandlung abtun. Doch sie stecken voller verhaltener Begeisterung, wenn er mehrdeutige Hinweise in kaum bekannten Urkunden und Chroniken vergleicht und sich bewundernd darüber äußert, wie präzise Flodoard von Reims zwischen drei Völkerschaften unterscheidet, die alle denselben Namen tragen. In zweien seiner Untersuchungen leistet Poole investigative Detektivarbeit und versucht, die Identität von Männern herauszufinden, deren vollständige Namen nicht aufgezeichnet wurden. Eine Untersuchung befasst sich mit »einem Herzog in der Nähe der Alpen«, der angeblich eine Tochter des englischen Königs Edward des Älteren (reg. 899–924) heiratete; die anderen beschäftigen sich mit einem Burgunder, von dem nur der Name Hugo Cisalpinus bekannt war. Handelte es sich dabei um Hugo den Schwarzen oder Hugo den Weißen oder vielleicht um Hugo, den Neffen von Hugo von Italien? Keine der Spuren erweist sich letztlich als zielführend. Der Reiz liegt in der Suche.
B Vorher war der Name Frankreich nur für die kleine Region im Seine-Tal verwendet worden, die heute île de France heißt. In diesem Sinne wurde Hugo Capet zunächst als Herzog von Franzien (Dux Francorum) bekannt. Nachdem er König geworden war, dehnte er diesen Namen auf sein wesentlich größeres gesamtes Königreich aus und brachte dadurch seinen Anspruch zum Ausdruck, dass er und seine Untertanen die einzigen wahren Erben der fränkischen Tradition von Karl dem Großen und Chlodwig seien. Sein Erfolg lässt sich auch daran ermessen, dass die deutsche Bezeichnung Frankreich (»Land der Franken«) für den westlichen Teil des ehemaligen Reiches von Karl dem Großen verwendet wurde, nicht jedoch für den östlichen Teil, der nun unter dem Begriff Deutschland zusammengefasst wurde. Diese Namensverschiebung wurde zweifellos auch durch die Gleichgültigkeit der ottonischen Kaiser ermöglicht, denen es als Sachsen nichts ausmachte, dass im Osten die fränkische Bezeichnung verloren ging. [Die Landschafts- und Dialektbezeichnungen im heutigen Franken bestehen selbstverständlich noch, auch wenn sie nicht „direkt“ vom Ostfrankenreich abstammen. A. d. Red.]
C Filioque (wörtlich »und dem Sohn«) ist der Kerninhalt der Glaubenslehre vom doppelten Hervorgang des Heiligen Geistes. Seit dem 9. Jahrhundert vertrat die Westkirche die Auffassung, dass der Heilige Geist »aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht«. Die Ostkirche glaubt dagegen nur an eine einzige Quelle des Heiligen Geistes und bevorzugt daher eine subordinierende Formel, wonach der Heilige Geist »aus dem Vater und durch den Sohn« hervorgeht. Dieser feine Unterschied ist seit Jahrhunderten der wichtigste theologische Streitpunkt zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen.