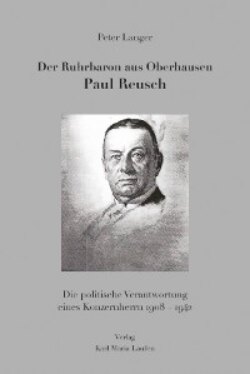Читать книгу Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch - Peter Langer - Страница 24
„Burgfrieden“ bei der GHH: Personalprobleme in der ersten Kriegshälfte
ОглавлениеIn den ersten beiden Kriegsjahren kümmerte sich der Konzernchef Reusch nur eher sporadisch um die Arbeitskräfte-Problematik. Als sich die Ernährungskrise in der zweiten Kriegshälfte verschärfte und gleichzeitig die Arbeiter durch das Vaterländische Hilfsdienstgesetz mehr Rechte erhielten, forderten die Konflikte mit den Gewerkschaften aber verstärkt seine Aufmerksamkeit.
Schlagartig mit Kriegsbeginn Anfang August wurden 5.879 Arbeiter der GHH und 374 „Beamte“ zum Wehrdienst eingezogen. Dies führte zu spürbaren Einschränkungen der Stahlproduktion. Reusch schrieb seinem Aufsichtsratsvorsitzenden, dass von sieben Hochöfen drei nur noch „gedämpft“ betrieben werden könnten. Wie Reusch die Lücken in der Belegschaft füllen wollte, sagte er nicht.69 Kurzfristig kamen nur zwei Gruppen in Frage: Vor allem Frauen und in geringerem Umfang Jugendliche.
Die Arbeitsbedingungen der Frauen waren ab 1915 ständiges Thema im Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (VdESI). In einer Denkschrift über Arbeiterfragen für das Kriegsministerium wand sich der Vorstand ganz entschieden gegen die Verkürzung der Nachtschicht für Frauen auf acht Stunden. Reusch wurde zusammen mit sechs anderen prominenten Kollegen in die Delegation gewählt, die dem Kriegsminister diese Denkschrift überreichen sollte. Offenbar genoss er das besondere Vertrauen seiner Kollegen, denn in der gleichen Sitzung im Hotel Adlon in Berlin beauftragte ihn der Vorstand auch mit der Wahrnehmung der Industrie-Interessen im Landeseisenbahnrat.70 Am 1. November 1915 trug Reusch gemeinsam mit seinen Kollegen dem Kriegsminister und anderen Vertretern der Reichsregierung die Forderungen des VdESI vor: Beibehaltung des Zehn-Stunden-Tages für Frauen mit Zwölf-Stunden-Schicht. Die Hauptversammlung bekräftigte diese Forderung am 9. Dezember. Als der Regierungspräsident von Düsseldorf trotzdem die Acht-Stunden-Schicht ab dem 1. Januar 1916 anordnete, wollte Reusch hart bleiben: „Ich habe mich dagegen gewehrt und auch die Hilfe des Kommandierenden Generals angerufen. … Einführen werde ich die Achtstundenschicht nicht.“ Falls der Regierungspräsident auf der Anordnung beharren sollte, würde die GHH die Produktion der Geschossfabrik Sterkrade auf die Hälfte drosseln und eventuell den Reichskanzler, das Handelsministerium, das Kriegsministerium, den Feldzeugmeister, und den Kommandierenden General per Telegramm darüber informieren. „Wir werden dann ja sehen, was die Herren weiter machen.“71 Noch ein Jahr später beharrte der Hauptvorstand des VdESI auf seiner Ablehnung der Acht-Stunden-Schicht für Frauen. Reusch trug diese Entscheidung mit. Wie sehr er sich auf die Unterstützung seiner Kollegen verlassen konnte, wurde im Februar 1917 deutlich, als er als Vertreter der Eisen- und Stahlindustrie in die betreffende Fachgruppe des Centralverbandes deutscher Industrieller delegiert wurde.72
Auch die Bezahlung der Frauen wurde im Vorstand diskutiert, ohne allerdings einen Beschluss herbeizuführen. Reusch vertrat auch in dieser Sache einen besonders harten Standpunkt. Er wollte den Frauen keinesfalls den gleichen Akkordsatz zubilligen wie den Männern: „Das tun wir im Westen nicht.“ Auch die Gewerbeaufsicht habe einer Zwei-Drittel-Regelung für Frauen nicht widersprochen, weil nämlich „die Ausnutzung der Maschinen nicht in demselben Umfange stattfindet wie von den männlichen Arbeitern. Außerdem besteht die Gefahr, dass, wenn wir die Frauen so viel Geld verdienen lassen, die Männer sagen: wir wollen mehr haben. … Im großen und ganzen verdienen die Frauen bei uns doch sehr viel Geld, zwischen 3 und 6 Mark, mehr als Herr Hilger von Oberschlesien erwähnt hat.“ Auch durch einen Zwischenruf von „Geheimrat Hilger“ ließ Reusch sich nicht beirren: „Wir bleiben im Westen dabei, dass wir den Frauen zwei Drittel des Akkordsatzes der Männer geben.“73
Schon vor Kriegsausbruch hatten sich die Unternehmer der Schwerindustrie Gedanken über den Einsatz von Jugendlichen gemacht. Sie sahen eine Chance, Schutzvorschriften für jugendliche Arbeiter wieder zu beseitigen. Bei einer Besprechung von „Arbeitnordwest“, des Arbeitgeberverbandes im Bereich der Nordwestlichen Gruppe des VdESI, am 14. Juli 1914 in Düsseldorf erhielten die Vertreter der Firmen Tipps, wie die Anträge für die Genehmigung von Nachtarbeit Jugendlicher mit Aussicht auf Erfolg zu stellen waren. „Unbedingt erforderlich … ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsstellen der jugendlichen Arbeiter nur der Ausbildung dieser Arbeiter dienen und die Nachtarbeit keine erhöhte Gefahr für Leben und Gesundheit bringt.“74 Um den Anträgen bei der Gewerbeaufsicht mehr Durchschlagskraft zu verleihen, sollten die Väter vorgeschickt werden. „Das eine oder andere Werk kann auch einen Hinweis auf die immer mehr von Regierungsseite gewünschte und geförderte Jugendpflege in den Genehmigungsantrag aufnehmen und dabei ausführen, dass ein unbedingtes Erfordernis einer richtigen Jugendpflege die rechtzeitige Erziehung zur Arbeit ist. Schließlich empfiehlt es sich auch zu bemerken, dass durch die Beschränkung der Verdienstmöglichkeit der Jugendlichen die soziale Lage der Älteren verschlechtert wird, was zweifellos auch einen Einfluss auf die Geburtenzahl ausüben wird.“ 75 Also: Die schwere Nachtarbeit von Jugendlichen in den Walzwerken dient der Jugendpflege, wird von den Arbeiterfamilien gewünscht und erhöht die Geburtenzahl! Reusch zeichnete das Schriftstück ab. Er hatte gegen diese Sicht der Dinge nichts einzuwenden.
Einen Monat später – die deutschen Truppen marschierten jetzt an beiden Fronten – konnte „Arbeitnordwest“ den Betrieben die Genehmigung aller Anträge betreffend die Nachtarbeit Jugendlicher und die Verkürzung der Pausenzeiten in Aussicht stellen. Mit dem Regierungspräsidenten Düsseldorf war die Sache schon geregelt; mit den anderen Regierungspräsidenten des Bezirks von „Arbeitnordwest“ standen die Gespräche vor dem erfolgreichen Abschluss. Lediglich für einzelne Arbeitsstellen legte die Gewerbeaufsicht später Einschränkungen fest. „Arbeitnordwest“ appellierte deshalb an die Werke, die sich daraus eventuell ergebenden Wettbewerbsverzerrungen nicht zum Nachteil einzelner Firmen auszunutzen. Reusch nahm alle diese Schreiben zur Kenntnis. Einwände machte er nicht geltend.76 Der Lohn der Jugendlichen wurde anscheinend in vielen Fällen an deren Väter ausgezahlt. Diese Praxis fand Reusch allerdings nicht gut. Als sich der Leiter einer Tochterfirma dagegen aussprach, weil die Väter das Geld nur für Tabak und Alkohol missbrauchen würden, stimmte Reusch ihm voll und ganz zu.77
Seit 1915 wurden auch in der Schwerindustrie französische Kriegsgefangene eingesetzt. Nach einem Protest der französischen Regierung gegen deren Einsatz unmittelbar in der Rüstungsproduktion forderte die deutsche Regierung Berichte aus der Industrie an, da sie Repressalien gegen deutsche Kriegsgefangene befürchtete. Im Berliner Hotel Adlon wurde daraufhin am 13. Oktober 1915 bei einer informellen Besprechung der führenden Männer der Schwerindustrie – Reusch war auch dabei – über eine einheitliche Linie beraten. Nur wenige Tage später legte der Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller (VdESI) den Entwurf einer „Denkschrift über die Arbeiterfrage im Kriege“ auf den Tisch und bat die Vorstandsmitglieder, u.a. Reusch, um eventuelle Änderungsvorschläge für die nächste Sitzung des Hauptvorstandes am 1. November. Haupttenor der Denkschrift war die Forderung, mehr Facharbeiter vom Kriegsdienst freizustellen. Bei der Vorstandssitzung stand aber auch die Gefangenenbeschäftigung und die Frauenarbeitszeit auf der Tagesordnung. Reusch informierte den VdESI kurz vor der Sitzung über einen französischsprachigen Aushang im Gefangenenlager der GHH. Darin hieß es: „Die Verrichtung aller Arbeiten, zu denen die Kriegsgefangenen herangezogen werden, wird im Bedarfsfalle durch Anwendung von Gewalt von ihnen gefordert werden, selbst, wenn die Gefangenen der Ansicht sein könnten, dass die Arbeiten sich auf Kriegslieferungen beziehen. Gefangene können sich nicht auf die Verordnungen und Gesetze ihres Landes berufen, denn während der Kriegsdauer unterstehen sie allein den deutschen Verordnungen und Militärgesetzen. … Im Falle der Weigerung wird man die Arbeit durch Strafen erzwingen. Es liegt umso weniger Grund vor zur Rücksichtnahme, da im Auslande die deutschen Gefangenen mit den größten Gewalttätigkeiten mit allen möglichen Arbeiten beschäftigt werden.“78 Reusch bat die Geschäftsstelle des VdESI, diesen Aushang den deutschen Behörden nicht zur Kenntnis zu geben, „da wir Wert darauf legen, dass vorläufig an den bestehenden Zuständen nichts geändert wird.“79
Der Arbeitskräftemangel war so groß, dass Reusch sich nicht nur für die französischen, sondern auch für die russischen Kriegsgefangenen interessierte. Woltmann, gerade von der Ostfront zurückgekehrt, sollte sich beim Kriegsministerium dafür einsetzen, dass Deutsch-Russen aus einem Gefangenenlager in Westpreußen der deutschen Industrie als Arbeiter zugeführt wurden.80 Dieser Vorstoß scheint jedoch keinen Erfolg gehabt zu haben.
Unweigerlich führten die Arbeitsbedingungen in der Kriegsindustrie zu Beschwerden bei den Gewerkschaften. Reusch war in höchstem Maß alarmiert, als ihm zu Ohren kam, dass „ein Arbeitersekretär namens Cohen“ beim Kriegsministerium vorstellig geworden sei, um sich über die zu niedrigen Löhne für Industriearbeiter zu beschweren. Die Beschwerde beruhte angeblich auf anonymen Anzeigen, worauf ein Offizier zur Überprüfung in die Betriebe entsandt wurde. Reusch wollte sichergestellt wissen, dass im Westen ein eventuell mit gleichem Auftrag entsandter Offizier höchstens die Lohnliste einsehen, aber keinesfalls mit den Arbeitern reden dürfte. Eine „direkte Fühlungnahme“ würde nur „Beunruhigung in die Arbeiterschaft tragen“.81
In der Tat suchte das Kriegsministerium schon frühzeitig nach Möglichkeiten, durch Zugeständnisse an die Arbeiter die Stimmung in den Betrieben und damit die Produktion zu verbessern. Nach guten Erfahrungen in Berlin und Dresden sollten überall Beschwerdeausschüsse mit Arbeitervertretern eingerichtet werden. Dagegen machte der VdESI massiv Front. Von verschiedenen Seiten – so Reusch wörtlich – müsse „ein kleines Trommelfeuer auf das Kriegsministerium eröffnet“ werden, um die Einrichtung derartiger Ausschüsse zu verhindern.82 Als Ende des Jahres 1916 die Planungen für das Vaterländische Hilfsdienstgesetz liefen und die Einrichtung ständiger Arbeiterausschüsse ernsthaft erwogen wurde, ruhten die Hoffnungen der Industrie vor allem auf General Groener. Ihn wollte der VdESI „für den schweren Kampf gegen das Reichsamt für Sozialpolitik“ mit Material versorgen. Dabei erkannten die Unternehmer dessen schwierige Situation durchaus an: Um die „Arbeiter bei Laune zu halten“, dürfe der General nicht zu unternehmerfreundlich klingen.83 Reusch hatte in der Hauptversammlung des VdESI heftig gegen die Einrichtung von Arbeiterausschüssen polemisiert: Diese wären „für den Burgfrieden, eine geordnete Betriebsführung, … überhaupt für das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern eher schädlich als nützlich“.84 Und wenn z. B. Schiedsämter zur Behandlung von Arbeiterbeschwerden nicht zu verhindern seien, dann müssten sie „militärisch aufgezogen“ sein, damit sie „nach dem Krieg von selbst wieder verschwinden“.85 Zwei Jahre nach Kriegsbeginn klammerte sich Reusch hartnäckig an die Illusion, dass nach dem – natürlich siegreich beendeten – Krieg die sozialen Verhältnisse der Zeit vor 1914 restauriert werden könnten. Die Ereignisse in der zweiten Kriegshälfte fegten derartige Träume hinweg.
Ein Sonderproblem war seit Kriegsbeginn der Arbeitermangel in den Erzgruben und Stahlwerken in Lothringen. Der gesamte Grubenbetrieb war durch den deutschen Einmarsch in Belgien und Nord-Frankreich unterbrochen worden. Die rasche Wiederinbetriebnahme scheiterte jedoch am akuten Personalmangel. Grund war die Einberufung der deutschen Arbeiter zum Wehrdienst und die gleichzeitige Ausweisung der Italiener aus ganz Lothringen. Der deutsche Generalstab verbot nämlich die Beschäftigung von ausländischen Arbeitern in einer breiten Zone hinter der Front. So konnte auf den GHH-Gruben86 Carl Lueg, Steinberg und Sterkrade-Anschluss Anfang September 1914 mit 90 Mann nur in ganz geringem Umfang der Betrieb wieder aufgenommen werden.87 Reusch bat deshalb auch im Namen seiner Kollegen August Thyssen, Beukenberg, Springorum und Klöckner um einen Termin bei Delbrück im Innenministerium.88 Die Besprechung mit der hochrangigen Delegation aus dem Ruhr-Revier fand am 20. November statt.89 Aber gegen die Militärbefehlshaber an der Front konnte anscheinend selbst der Innenminister und Vize-Kanzler wenig ausrichten. Deswegen wandte sich der Verein deutscher Eisenhüttenleute im Dezember 1914 mit einem dramatischen Appell an den Generalquartiermeister an der Westfront. Die Lage der Eisenindustrie sei verzweifelt; die italienischen Arbeiter würden in den Erzgruben in Lothringen unbedingt gebraucht. Aber auch dieser Vorstoß blieb ohne Ergebnis.90
Zwei Jahre später klagte die Schwerindustrie immer noch darüber, dass der Arbeitskräftemangel einer Steigerung der Erzförderung in Lothringen im Wege stünde. Im Sommer 1916 drängte die italienische Regierung die Arbeiter zur Rückkehr nach Italien. Reusch machte sofort Staatsminister Helfferich auf die drohende Auswanderung der Italiener aufmerksam. Die Reichsregierung konnte oder wollte jedoch dagegen keine Zwangsmittel anwenden.91 GHH-Direktor Kellermann berichtete wenig später aus Lothringen, dass zwar 500 Hauer „aus dem Felde“ abgezogen worden seien und dass mittlerweile 200.000 Kriegsgefangene in den Erzgruben arbeiteten. Das reichte aber nicht. Klöckner, so der Bericht von Kellermann, plädierte dafür, notfalls „auf dem Zwangswege … das in Belgien brach liegende Menschenmaterial“ heranzuziehen. Unterstaatssekretär Richter aus dem Innen-Ministerium musste die Industriellen bremsen: Er war nicht bereit, Zwangsmittel anzuwenden, für die Arbeit in den Erzgruben sollten in Belgien nur Freiwillige rekrutiert werden.92 Kellermann kommentierte Klöckners Vorschlag nicht. Auch von Reusch ist keine Antwort überliefert. Da er aber in der Regel nicht zögerte, abweichende Ansichten zum Ausdruck zu bringen, darf man wohl annehmen, dass er nichts dagegen gehabt hätte, den Arbeitermangel auf die Weise zu beheben, die sein Kollege Klöckner vorschlug.
Um den Arbeitermangel in den Stammwerken der Schwerindustrie weit hinter der Front zu lindern, wurden aber Ende 1916 in Belgien dann doch Zwangsmittel angewandt. Die Reichsregierung gab offenbar dem Drängen der Ruhr-Industriellen nach, denn bereits im November 1916 konnte „Arbeitnordwest“ den Mitgliedsfirmen folgende Mitteilung machen: „Durch die in Belgien vorgenommene zwangsweise Überweisung der belgischen Arbeiter an die deutsche Industrie hat die freiwillige Anwerbung durch das Deutsche Industriebüro einen starken Anstoß erhalten.“93 Die Geschäftsführung wies in diesem Rundschreiben auf zahlreiche Anmeldungen hin und forderte die Mitgliedsfirmen auf, ihren Bedarf an Arbeitskräften zu melden. Die angeworbenen belgischen Arbeiter seien in Deutschland wie Kriegsgefangene unterzubringen.94
Kriegsgefangene und belgische Zwangsarbeiter konnten selbstverständlich die deutschen „Beamten“ und Facharbeiter nicht ersetzen. Während des ganzen Krieges war die Konzernleitung deshalb bemüht, vor allem die Freigabe der Techniker vom Kriegsdienst zu erreichen. Vor allem in der zweiten Kriegshälfte gab die Heeresverwaltung kaum noch Soldaten frei, ja sie verlangte sogar die Rückkehr der „Reklamierten“ an die Front. Im Sommer 1917 betraf dies 400 Facharbeiter der GHH, vor allem aus dem Brückenbau in Sterkrade.95
Der jahrelange Ärger um die Arbeitskräfte in der Schwerindustrie mag die Konzern-Chefs der GHH Ende 1916 zu einer etwas bizarren Initiative mit veranlasst haben. Mitten im Krieg wollten Reusch und sein Stellvertreter Woltmann bereits mit den Planungen für den nächsten Krieg beginnen. In einem Schreiben an den Kriegsausschuss der deutschen Industrie in Berlin plädierten sie für die Einrichtung eines „Kriegswirtschaftsamtes“, um eine bessere wirtschaftliche Vorbereitung des nächsten Krieges sicherzustellen. Im Einzelnen dachten sie dabei (1) an die Sicherstellung der Rohstoffversorgung für die Industrie, (2) die Ernährung, (3) die Rüstungsproduktion und (4) an die Zuführung der Arbeitskräfte hinter der Front.96
Der „Burgfrieden“ wurde im Herbst 1916 auch in den Werken der GHH aufgekündigt. Von da an ging es nicht mehr um die „Zuführung der Arbeitskräfte hinter der Front“, sondern um die Rechte der Arbeiter, um die Anerkennung der Gewerkschaften und um die Beilegung von Streiks.