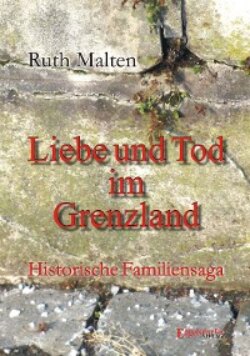Читать книгу Liebe und Tod im Grenzland - Ruth Malten - Страница 10
4. Kapitel
Elise organisiert ihr Leben mit Emma neu
ОглавлениеElise fand eine Hilfe für die Versorgung des Babys am Tage. Frau Rösler, Witwe ohne eigene Kinder, war dankbar, erneut einen kleinen Menschen aufzuziehen zu dürfen. Die große, vollschlanke Frau mit Wangengrübchen, blauen Augen, schlicht rückwärts gekämmten und in einem Knoten verschlungenen silbergrauen Haaren strahlte Wärme und gelassene Heiterkeit aus. „Willkommen auf unserer Erde, kleine Emma“, sagte sie sanft und neigte sich dem Baby zu, das in einem von Elise mit geblümtem Batist bespannten Körbchen lag. Lächelnd erwiderte der Säugling ihren Blick, mit Armen und Beinen lebhaft ruckelnd. „Was für ein feines, zartes Kind Du bist.“ Emma krauste die Stirn, schürzte die Lippen und schob die kleine Faust in den Mund. Elise nahm ihr Baby aus dem Korb und schmiegte ihr Gesicht an seinen Hals. Dieser Duft nach Milch, Haut und Baby! Ihr fielen keine Worte ein für diesen unvergleichlichen Wohlgeruch. Sie hätte ohne Ende ihren Säugling beschnuppern mögen. Frau Rösler stand daneben, ihre Augen umrankt von freundlichen Knitterfältchen, das Gesicht heiter und in Vorfreude, diesen Sprössling bald ganze Tage bei sich zu haben.
Kam Elise morgens in den Friseur-Salon und grüßte mit einem munteren „Guten Morgen“ ihre Kolleginnen und wartende Kunden, erhellten sich die Gesichter.
Während ihre heutige Kundin noch beschrieb, welche Frisur ihr vorschwebte, wog Elise deren Haar in der Hand, prüfte kundig Gesicht und Kopfform. Sie bewegte das Haar in unterschiedlicher Weise, experimentierte und prüfte, während sie mit der Kundin redete. Nach einer Entscheidung arbeitete sie konzentriert und plauderte dennoch scheinbar entspannt. Elise war beliebt, hatte einen beachtlichen Kreis von Stammkunden und eine zufriedene Chefin.
Als Elise am Abend das Haus betritt, in dem sie wohnt, empfängt sie im Flur ein aufdringlicher Geruch nach Kohl. Die Böttchers in der ersten Etage lassen oft ihre Wohnungstür zum Hausflur hin offen. So riecht im Haus jeder Eintretende, was bei Böttchers am Abend auf dem Tisch stehen wird, heut offenbar Weißkohleintopf. Im Vorbeigehen hört Elise unfreiwillig, wie die beiden Eheleute, Heini und Lena, wieder einmal lautstark zanken. Erneut geht es ums Geldausgeben. Lena hat im Resteladen Stoff für Küchengardinen gekauft, genäht und gehofft, Heini würde sich darüber freuen. Aber er dröhnt, wofür in Drei-Teufels-Namen in der Küche Gardinen hängen müssen. „Ich habe nicht in der Lotterie gewonnen, heiliger Strohsack“, donnert er, und Lena äußert flennend, enttäuscht und wütend Unverständliches.
Elise braucht viel Kraft, ihren Kummer nach außen zu verbergen. Christian, ihre große Liebe, ihre Hoffnung auf eine gute gemeinsame Zukunft war zu einem zersprungenen Traum geworden. Die Erinnerung daran, wie sie durch die Art ihres Wiedersehens in Hannover gedemütigt worden war, ließ sie wieder und wieder vor Scham erröten. ‚Ich verstehe die heikle Situation, in der er war: leben mit mir ohne Existenzgrundlage oder ohne mich in vorgegebenen Gleisen ohne Glück‘, dachte Elise, denn sie ging davon aus, er habe sie geliebt wie sie ihn. ‚Aber es ist vorbei und muss vorbei sein‘, beschwor sie sich und straffte ihren Körper; dennoch konnte sie nicht verhindern, an einsamen Abenden oder strahlenden Sonntagnachmittagen von ihren Erinnerungen an die gemeinsame Zeit eingeholt zu werden. Das tat weh.
„ Unzertrennlich beide, gehe, lieb und leid“, zitierte ihre Mutter Helene die alte Volksweisheit. In solchen Momenten fand Elise Trost in einem schönen Text oder einer Melodie. Besonders liebte sie das Lied von den zwei Königskindern:
‚Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief.‘
Sie begann die Melodie zu summen. Ihre Mutter sah Elise an verstand deren Kummer, verlassen worden zu sein und dieses nie ganz vergehende Weh. Helene stimmte summend ein. Sie sangen mit ihren klaren Sopranstimmen die drei Verse, in denen erzählt wird, wie der Königssohn zu seiner Liebsten schwimmen will, aber ertrinkt. Als sie geendet hatten, waren beider Augen feucht. Gerade weil der Text so traurig war, tröstete er Elise. Andere vor ihr hatten demnach auch Liebesweh erlitten. Der innige Text war noch in ihnen, wenn Helene später wieder an der Nähmaschine saß, den harten Stoff der Militäruniformen unter ihren Händen und das knarrende Rattern des Fußantriebs den Raum erfüllte.
Elise hatte ihre buntbedruckte Arbeitsschürze umgebunden und das Abendessen vorbereitet. In ihrer Wohnküche verbreitete sich der Duft von garenden Hefeklößen, die beide Frauen so liebten. In einem zweiten Topf köchelten geschälte und kleingeschnittene Apfelstücke mit Zucker, einer Gewürznelke und einem Stückchen Zimtstange für Apfelkompott. Bei dem Duft der Äpfel brummte Helene ein zufriedenes „Hm“. Sie schaute zu Elise und lächelte aus immer noch feuchten Augen. Als Elise einen duftig aufgegangenen Hefekloß auf jeden Teller legte, mit Zimt und Zucker bestreut und wenigen Tropfen gebräunter Butter begossen hatte, hielt es Helene nicht mehr an ihrem Arbeitsgerät. Beflügelt erhob sie sich, mit einem herzhaften ‚hab ich einen Hunger‘ setzte sie sich an den hübsch gedeckten Küchentisch. Elise hatte die von ihr vor Jahren mit bunten Streublumensträußen bestickte Tischdecke aufgelegt, die Helene so gefiel. Dankbar und hungrig verspeisten sie ihr gemeinsames Mahl von ihrem blau-weiß gemusterten Bunzlauer Geschirr.
Elise schaute auf ihr Leben und fand viel Gutes: Sie war zur Freude ihrer Mutter Helene bei ihr geblieben. Da Helene, um leben zu können, ihre Arbeit tun musste und keine Zeit für das Baby blieb, war sie froh, dass es Frau Rösler gab. Das kleine Mädchen war guter Dinge, wenn es am späten Nachmittag, nach Elises Arbeitsende, zu Mama Elise und Oma Helene gebracht wurde. Mit ihrem freudestrahlenden Lächeln, ihrem begeistert-erregten Glucksen und Brabbeln, dem erwartungsfroh zitternden Ruckeln ihrer Arme, Beine und des ganzen Körpers kamen Frohsein und Behagen in die mütterliche Wohnung.
Oft saßen die beiden Frauen mit dem Kind auf dem Boden und dachten sich zum Ergötzen der kleinen Madam drollige Fingerspiele aus. Sie liebkosten ihre flaumige Haut an den Armen, fuhren mit einem Finger kosend den seidigen Nasenrücken entlang, kraulten sein gelocktes, blondes Haar mit zwei Fingern und plauderten in melodischem Singsang. Emma schaute mal ernst, mal sprudelte sie vor Wonne. Warm geborgen schwelgte sie in ihrem Mütternest.
„Was für ein gutes Leben wir haben“, bemerkte Elise. „Ja, viel Arbeit und viel Glück“, ergänzte Helene, um deren helle Augen sich die ersten müden Fältchen eingegraben hatten. Beim Anblick ihrer Enkelin blühte sie auf, wenn sie dieses Leben mit ihrer vorherigen herben Einsamkeit verglich.
Elise liest ihrer Mutter Helene aus der Zeitung vor, Textil-Heimarbeiter in einem Dorf in Sachsen träten in den Ausstand. Sie forderten einen zehnstündigen Arbeitstag und eine Lohnerhöhung um vierzehn Prozent.
Kaiser Wilhelm II bespricht eine Edison-Walze und beschreibt, wie er sich den idealen deutschen Bürger vorstellt: „ Hart sein im Schmerz, nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos, zufrieden mit dem Tag, wie er kommt; in allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben, wie sie nun einmal sind … und an Herz und Können immer sein Bestes geben, wenn es auch keinen Dank erfährt.“
„Dieses Idealbild erfüllen wir doch schon, oder?“, stellt Elise fest und lacht.
„Nur das mit den zehn Arbeitsstunden pro Tag soll wohl ein Witz sein! Wer kann schon in zehn Stunden seinen Lebensunterhalt verdienen? Kann mir nicht vorstellen, dass solche Träume jemals in Erfüllung gehen werden.“
Elise lacht laut auf. „Nicht zu fassen! Hör dir das an: ‚Der Arbeitslose Wilhelm Voigt beschlagnahmt in Offiziersuniform die Stadtkasse von Köpenick.‘“ Beide Frauen finden das ziemlich komisch. „Aber das hier ist, glaube ich, weniger zum Lachen“, sagt Elise und liest weiter: „Die Germania-Werft in Kiel baut für die deutsche Marine das erste Unterseeboot . Wofür brauchen wir ein Unterseeboot?“
Emma wuchs heran und wurde bald zu einer kleinen Dame mit Wünschen: Sie wolle Klavierspielen lernen. Frau Rösler hatte mit ihrem Zögling eine Freundin besucht, bei der die fünfjährige Emma erstmals Klaviermusik vernahm. Zunächst verharrte sie wie angewurzelt im Zimmer, nahte leise wie ein Kätzchen auf Zehenspitzen, kletterte behutsam einen Sessel nahe am Klavier empor und lauschte mit geöffneten Lippen, kaum noch atmend, den Klängen. „Das war ganz wunder-wunderbar!“, schwärmte sie am Abend bezaubert und mit heißen Wangen bei Mama und Oma.
Da für ein Klavier weder freier Raum in der Wohnung noch genügend Geld da waren, erwarb Elise eine gebrauchte Zither, und Emma erhielt Zither-Stunden bei einem alten Musiklehrer.
Seine Gruppe begann mit acht Kindern. Zwei Jahre später waren zwei verblieben, kurz danach nur noch Emma. Die Kinder hatten wegen blutiger, aufgeplatzter Hornhautschwielen an den Fingerspitzen aufgegeben, weil sie vorübergehend weder üben noch schlafen konnten. Auch Emma hatte diese Phasen erlitten, klagte jedoch nicht, bis ihre Fingerkuppen hart wie Leder waren, und die reine Freude am Musizieren blieb. Mit unermüdlichem Fleiß und großer Begeisterung spielte sie Melodie und Begleitung von Liedern aus dem Riesengebirge, ihrer schlesischen Heimat und andere Volkslieder. In der Schule konnte sie mit ihrem Zitherspiel manche Feier mitgestalten und war beglückt, durchgehalten zu haben. Manche Feierstunde fand ihren Höhepunkt mit dem schlesischen Heimatlied:
„ Blaue Berge, grüne Täler, mittendrin ein Häuschen klein,
herrlich ist dies Stückchen Erde und ich bin ja dort daheim.
Als ich einst ins Land gezogen, ham die Berg’ mir nachgesehn
mit der Kindheit, mit der Jugend, wusst’ nicht recht, wie mir geschehn.
Oh mein liebes Riesengebirge, deutsches Gebirge, du meine liebe Heimat du.
Ist mir gut und schlecht gegangen, hab’ gesungen und gelacht,
doch in manchen bangen Stunden hat mein Herz mir still gepocht.
Und mich zog‘s nach Jahr und Stunden wieder heim ins Elternhaus,
hielt’s nicht mehr vor lauter Sehnsucht bei den fremden Leuten aus.
Du mein liebes Riesengebirge, deutsches Gebirge, du meine liebe Heimat du.“
Nach und nach standen Lehrer und Schüler auf und sangen mit. Schnäuzen war zu vernehmen, und einige Taschentücher verschwanden danach verschämt wieder in Jacken- oder Hosentaschen.
Nach solchen Abenden, meist Elternabenden, ging Emma innerlich glühend vor Stolz und Freude heim. Besonders froh war sie, wenn Elise und Helene mitgekommen waren, denn auch sie machte stolz und glücklich, Emma bei ihrem wunderbaren Zitherspiel zu erleben, mit dem sie vielen Menschen Freude bereitete.
Elise hatte von Selma Havel gehört, die Kindern Lauten-Unterricht gab. Als Emma davon erfuhr, war sie hellauf begeistert. Fortan ging sie auch zur Lauten-Gruppe und kam schnell voran, da sie durch ihr Zitherspiel bereits Noten lesen konnte und wegen ihrer abgehärteten Fingerkuppen die schmerzenden Schwielen hinter sich hatte, an denen die anderen noch litten. Wenn Emma abends mit ihren beiden Müttern und Frau Rösler zu Hause war, sangen sie gemeinsam, begleitet von Emmas Zither- oder Lautenspiel wenigstens ein kleines Lied, auch wenn die Zeit knapp war. Elise lernte von Emma die gebräuchlichsten Griffe und konnte bald selbst mit der Laute ihre gemeinsamen Feierabendlieder ausgestalten. Elise blühte auf, die Gesichtszüge ihrer vormals verhärmten Mutter Helene wurden weicher, und auch Frau Rösler verweilte meist bei dem kleinen Feierabendkonzert mit zwei Instrumenten, drei Frauen- und einer Mädchenstimme. Diese tägliche kleine Abendmusik verzauberte wie Goldstaub ihre arbeitsreichen Tage. Frau Rösler nahm diese innigen Lieder und Klänge tief im Herzen auf und trug sie erfüllt mit sich heim.
Wenn sich Elise im Spiegel betrachtete, sah sie eine strahlende junge Frau mit blond-gewelltem Haar, deren lose Strähnen weich ihr voller gewordenes Gesicht umspielten. Ihre Augen hatten die Farbe eines hellen Sommerhimmels. Sie wusste, einige männliche Kunden kamen ihretwegen in den Salon. Dann und wann wurde sie zu einem Kaffee eingeladen. Mit zwei befreundeten Kolleginnen ging sie zuweilen zum Tanzen. Meistens liefen nette Tänzer zuerst auf Elise zu.
„Wir profitieren von dir, auch wenn wir eigentlich eifersüchtig sein müssten“, meinte die eher unscheinbare Ursula, eine der beiden, „wer Elise nicht ergattert, holt eine von uns, ist doch fabelhaft“, ergänzte die große, schlanke dunkelhaarige Marga. „Wie erfreulich, dass die Kavaliere Augen im Kopf haben. Du bist nun mal die Schönste aus unserem Kleeblatt.“
An einem dieser samtweichen Frühlingsabende lernte Elise in einem mit farbigen Lämpchen beleuchteten Tanz-Cafe an der Oder Theo Keil kennen, einen Witwer, der seit fünf Jahren seinen Sohn allein aufzog. Seine Frau war an einer Blinddarmentzündung verstorben, als Sohn Harald acht Jahre alt war. Theo Keil, Facharbeiter in einer Schuhfabrik, war als eingearbeitete und verlässliche Kraft für den verantwortungsvollen Leder-Zuschnitt zuständig.
Elise und Theo hatten als alleinerziehende Eltern vergleichbare Erfahrungen, als ein Elternteil das Pensum von zweien zu bewältigen. Das bedeutete viel Arbeit auch nach Feierabend und wenig Ruhepausen. Beide verband die Sehnsucht, ein gleichgestimmtes Gegenüber zu haben. Nach des Tages Mühen zu zweit Herz und Seele aufzutanken, und die Kinder in einer vollständigen Familie aufwachsen zu lassen.
Sie kannten sich ein halbes Jahr, als Theo an einem Sonnabendnachmittag Elise in ihr Café an der Oder einlud. Sie saßen wie beim ersten Mal einander gegenüber und lächelten sich an, nun schon viel vertrauter. Sie lauschten dem beruhigenden Fluten des Flusses, dem Schlappen auslaufender, geschäumter Wellen an seinen Ufern, atmeten den schilfigen Duft des Wassers und genossen das sanfte Raunen des Windhauchs in den Baumkronen und auf ihrer Haut.
Elise betrachtete Theos dichtes, leicht gewelltes mittelblondes Haar, seinen stets gepflegten Kaiser-Wilhelm-Bart, beidseitig in aufwärts weisender Spitze endend, seine kernige und durch jahrelangen Leistungssport als Geräteturner gestählte Figur. Ihre Augen wanderten auf seine groben, verarbeiteten Hände mit den Schwielen, aufgeplatzten und halb abgeheilten Blasen und den eingerissenen Fingernägeln, die von der schweren und unvermeidlich schmutzigen Arbeit kaum vollständig zu reinigen waren. Elise sah wohl, Theo hatte versucht, die bei der Arbeit unvermeidlichen, dunklen Ränder wegzuschrubben. Er war stets korrekt gekleidet, wenn er Elise traf. Heut trug er ein helles Hemd, eine beigefarbige Fliege, braune Cordhose und Cord-Jackett. ‚Sicher nicht mein Traum-Prinz, aber solide und vorzeigbar‘, überlegte Elise. Sie wollte nicht dauerhaft allein leben wie ihre Mutter, tagaus, tagein nur schuftend, wobei der karge Lohn der Heimarbeit gerade für das Nötigste gelangt hatte. Elise wollte wie Theo eine vollständige Familie.
In diese Gedanken hinein fragte er Elise, ob sie ihn heiraten wolle. Elise hatte sich das wiederholt selbst gefragt. Ihre Antwort hatte sich nach und nach herauskristallisiert. Dennoch klopfte ihr Herz, als sie nach leichtem Zögern mit kleinem Lächeln „ja“ sagte. Sie entschied: „Nicht lange mäkeln, Kopfsprung, mutig loslegen und mit dem Segen von oben was Gutes daraus machen.“
Sie heirateten wenige Monate später und mieteten eine größere Wohnung in der Nähe der vorherigen, in der Großmutter Helene blieb und wieder ausreichend Platz hatte für ihre Uniform-, Einlagen- und Futterstoffe, die Kästchen mit Knöpfen und Garnrollen, ihre Scheren, ihr Bügeleisen und das Bügelbrett. Helene hatte in der Zeit, in der Theo und Elise einander kennenlernten, angefangen, sich innerlich von Elise zu verabschieden und bereit zu sein, nun bald ihre geliebte Tochter ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Sie hatte sich vorgenommen, kein Drama mehr aufzuführen wie bei Christian, zumal ihr Theo als künftiger Schwiegersohn recht gut gefiel. „Ein solides Mannsbild“, hatte sie Elise gegenüber geäußert. Auch sie wünschte Elise ein anderes Leben als ihr eigenes, eines, das sie selbst nie erfahren durfte, ein Familienleben mit einem Ehemann und einem Vater für die Kinder.
Theo und Elise waren bis zu ihrer Heirat gewöhnt, Entscheidungen zu treffen, ohne einen Dritten zu fragen.
„Selbstverständlich kann Emma jetzt zu ihren Freundinnen gehen“, entschied Elise. Theo fand, sie könne zuvor noch einkaufen und den Abwasch machen. Schnell kippte anfangs die Stimmung, wenn Theo sich in Dinge einmischte, die Elise als ihre Angelegenheiten ansah. Elise war sensibler als Theo und schneller verletzt. Sie war nicht bereit, sich bevormunden zu lassen von dem robuster gearteten Theo. Elise kämpfte immer wieder für ihre Tochter und für ihren eigenen Platz innerhalb der Familie, auch als es um die Frage ging, Volks- oder Realschule. Sie hatte selbst Unterstützung erfahren durch Onkel Tritschke, dem sie verdankte, dass sie die Schule besuchen, Hausaufgaben machen und eine Ausbildung zur Frisörin durchlaufen konnte. Das alles hatte ihr ein Mindestmaß an Unabhängigkeit gebracht, die sie nicht mehr preiszugeben bereit war. Schließlich verdiente sie nach wie vor den Lebensunterhalt für sich und Emma selbst.
Auch etwas anderes beunruhigte sie. Wandte sich Elise Theo in erhöhtem Maße zu, sah sie, wie sich ihr Mädchen an die Seite geschoben fühlte. Kümmerte sie sich intensiver um Emma, reagierte Theo empfindlich eifersüchtig und fühlte sich vernachlässigt. Zuweilen befürchtete Elise, schlapp zu machen bei der Aufgabe, Theo, Emma und dem 14-jährigen Stiefsohn Harald gerecht werden zu sollen. Harald, Jüngling in der Pubertät, ließ sich weder von ihr noch von seinem Vater etwas sagen.
„Wären wir lieber allein geblieben“, sagte Emma eines Tages zu Elise. „Der Theo Keil hat sich wie ein Keil zwischen uns geschoben.“ In unglücklichen Momenten hatte Elise selbst diesen Gedanken erwogen, ihn aber eilig verscheucht, ahnend, dass eine Ehe unter den gegebenen Umständen allgemein nicht leicht sein konnte. „Das wird sich einspielen“, ermutigte sie Emma, vor allem aber sich selbst.
„Hast du das gelesen“, sagt Theo zu Elise, „der Reichstag beschließt den Bau von 41 Schlachtschiffen und Kreuzern. Außerdem soll die Armee vergrößert werden. Gleichzeitig betont der Kaiser bei der Einweihung des deutschen Stadions in Berlin-Grunewald, wie wichtig Sport zur Wehrertüchtigung sei. Wenn das nicht Kriegsgeklingel ist!“ Theo legt einen Moment die Zeitung weg, fährt sich mit allen zehn Fingern durch seine dichten Haare, hebt seinen Bierkrug und nimmt einen kräftigen Schluck. Elise, die mit dem Abendessen für die Familie beschäftigt ist, wirft ihm einen flüchtigen Blick zu. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was das alles bedeuten könnte.“ Sie rührt in einem großen Topf eine Kartoffelsuppe um, die würzig nach frischem Majoran duftet.
Schon im Frisör-Laden war große Aufregung. Die Kundinnen kamen hereingestürzt: „Haben sie das schon gelesen?“ An allen Kiosken lägen die Extrablätter. Zeitungsverkäufer riefen allerorten die Schlagzeilen aus. Die Unruhe auf den Straßen sei körperlich zu spüren. Elise hatte ihre Schere zur Seite gelegt. Alle wollten nur darüber reden, das Ereignis des Tages.
Als Elise nach Hause kam, kam ihr Theo mit der Zeitung in der Hand entgegen. „Hast du schon die Zeitung gelesen?“, rief er aufgeregt. „Jetzt haben wir den Salat. Das bedeutet Krieg. Keine Frage. Kronprinz Franz-Ferdinand und seine Frau, Herzogin Sofie, in Sarajevo erschossen.“ Die beiden Eheleute schauten sich ratlos an. „Mann o Mann“, sagte Theo nur.
Der erste Weltkrieg bricht aus. Viele sind begeistert, in Deutschland und im Ausland. Endlich tut sich was. Die Kritischeren unter ihnen befällt große Sorge. Im Krieg sterben Menschen. „Die Deutschen werden siegen, keine Frage“, rufen die einen. „Und wenn nicht?“, fragen die anderen. „Miesmacher, Hasenfüße“, entgegnen die Selbstsicheren.
Die Briten verhängen eine Wirtschaftsblockade, die ab November 1914 den Außenhandel stark einschränkt. Da viele Bauern zum Kriegsdienst eingezogen werden, wird in der Landwirtschaft weniger erzeugt. Futterkartoffeln werden zur Ernährung der Menschen gebraucht. Auch Düngemittel sind auf dem heimischen Markt nicht ausreichend vorhanden. Pferde werden für die Front beschlagnahmt.
Theo und Elise müssen sich daran gewöhnen, beim Einkaufen Marken für Mehl und Brot mitzunehmen.
Seit Juni 1916 wird Verdun zu einem Menetekel. Die Soldaten graben sich ein. Im Kampf um Verdun fallen 335.000 deutsche und 360.000 französische Soldaten.
Elise ist froh, wenn sie im Winter 1916 noch Kohlrüben kaufen kann. Eine Familie zu ernähren, wird immer schwieriger. Man spricht vom Kohlrüben-Winter. Ein Winter ohne Hoffnung, ein Winter des Mangels. Mangel an Heizmaterial, an Nahrung. Die Menschen frieren, hungern, werden krank, und viele überleben den Winter nicht.
Da eröffnet Elise ihrem Mann Theo, dass sie schwanger sei.
Mitte März, dem gleichen Tag, an dem Emma 14 Jahre zuvor das Licht der Welt erblickte, wird Minna geboren.
Elise empfand dieses Kind als endgültige Besiegelung ihrer Ehe. Von da an stellte sie ihre Entscheidung, Theos Frau geworden zu sein, nie mehr in Frage. „In guten wie in schweren Tagen“, bekräftigte sie sich selbst ein zweites Mal das Versprechen, das sie vor dem Altar gegeben hatte.
Minna zog mit in Emmas Zimmer ein. Die nun 14-jährige Emma liebte dieses kleine Mädchen vom ersten Tag an wie ihr eigenes Kind. Alles, was sie für dieses Baby tun konnte, war für Emma vollkommenes Glück. Sie badete und wickelte es, sang ihm Lieder vor und spielte auf der Zither. Schon bald gluckste das Kind vor Freude, wenn es seine Schwester-Mama sah, Gesang oder Zither-Spiel hörte und schien mit den rudernden Bewegungen seiner Ärmchen zu dirigieren. Emma brachte der kleinen Minna alles bei, was ihr aus eigener Kinderzeit im Gedächtnis haftete und dem Kind Freude bereiten konnte. Sie las vor, dachte sich lustig klingende Verse oder kleine Geschichten aus.
Elise stand ab und zu lächelnd daneben, die Daumen in je einer Schürzentasche, den Kopf wiegend und meinte: „Mir ist, als wenn ich mir selbst zuschaute, wie ich 14 Jahre zuvor mit Dir, meine Emmi, Freude hatte. Als sei es gestern gewesen.“
Das zu bestaunen entschädigte sie für die ärgerlichen Reibereien und nervenverschleißenden Machtkämpfe in ihrer Ehe, die sich daraus ergaben, dass Theo und sie in vielen Dingen sehr verschieden dachten und fühlten.
Theo erwartete abends eine aufgeräumte Wohnung und ein warmes Abendessen, wie von seiner verstorbenen Frau gewohnt. Er brauchte lange, zu begreifen, dass eine berufstätige Mutter mit drei Kindern nicht mit einer Ein-Kind-Nur-Hausfrau zu vergleichen sei. Gern hätte Elise den Haushalt perfekt bewältigt. Sie war flink, wenn sie abends nach einem anstrengenden Tag im Frisier-Salon noch kochte, bügelte und abwusch. Aber die Zeit reichte nicht, wenn sie auch noch mit den Kindern singen und spielen wollte, was ihr wichtiger war, als einmal mehr oder weniger Möbel abzustauben. Die Zeit reichte meist nur für das Nötigste. Was dieses Nötigste war, sahen Elise und Theo leider unterschiedlich.
Das Kochen wurde mehr und mehr zum Problem. Außer Kohlrüben, Kartoffeln und Brot waren kaum noch Lebensmittel zu haben. Die kalorienarme Nahrung ließ die Fettpolster schmelzen. Die Menschen hatten Hunger und wurden gereizt. Theo vergaß oft diesen Zusammenhang, wenn er abends müde und hungrig von der Arbeit kam. Er gab Elise die Schuld, wenn ihm das einseitige Essen nicht schmeckte und er nicht satt wurde. Die Lebensmittel waren inzwischen rationiert, durften nur noch in kleinen Mengen verkauft werden, was die Menschen an bestimmte Läden band, die von staatlichen Stellen kontrolliert wurden. Das bedeutete zusätzlich zur vorhandenen Arbeit im Salon und zu Hause für Elise und Emma noch Schlangestehen vor dem Lebensmittelladen.
Theo nahm abends für sich in Anspruch, müde zu sein und seine Füße auf der Fußbank hochzulegen. Auch Elise schmerzten abends die Füße, aber sie redete nicht davon. Sie schluckte herunter, wenn er maulte, weil bei seiner Heimkunft noch Spielsachen in der Wohnküche auf dem Boden lagen oder Bügelwäsche auf einem Stuhl. Mit anzupacken war für ihn nun, da er wieder eine Frau hatte, eine Zumutung. Dass Elise mitverdiente, war willkommen. Die Arbeit zu Hause hingegen war für ihn nach wie vor Frauensache.
Theo lernte nur widerwillig, dass seine zierliche Elise nicht unbegrenzt belastbar war und seine Hilfe brauchte. Er sah als sein gutes Recht an, dreimal wöchentlich in seinen Turnverein zu gehen.
Die vierzehnjährige Emma half ihrer Mutter jenseits von Hausaufgaben, Zither- und Lautenstunden so viel wie möglich, ärgerte sich jedoch, wenn Harald, ihr Stiefbruder, sich mehr und mehr an seinem Paschavater orientierte. Statt, wie in der Familie vereinbart, regelmäßig den Müll runterzutragen und die Schuhe zu putzen, ging er Fußball spielen und zu seinen Freunden.
„Und wo bleibe ich?“, stieß es zuweilen Elise auf, wenn sie abends wieder mal mit Kochen, Abwasch und Bügelwäsche allein geblieben war und Grund hatte, sich als Packesel der Familie zu fühlen. Meist war sie zu abgespannt, um sich zu beklagen oder zu wiederholen, was schon hundertmal gesagt worden war. Streit laugte sie aus; lieber erledigte sie liegen- gebliebene Arbeit der anderen zusätzlich.
Ihr fehlten Mußestunden für ihre Bedürfnisse: Mal ein Buch lesen, um auf andere Gedanken zu kommen. Bilder betrachten, um ihre Seele aufzutanken. Ein ungestörter Spaziergang, Wolken zuschauen oder dem Gesang von Vögeln lauschen. Denken und Stress hinter sich lassen, Zeit, um mit offenen Sinnen Leib und Seele mit Schönem zu sättigen. Sie vermisste Stunden gleichgestimmter Zweisamkeit jenseits von Pflichten in Haushalt und Schlafzimmer.
In Augenblicken wie diesen überfielen Elise ungewollt Gedanken an Christian. Dieser Gleichklang, diese Harmonie ohne Worte, dieses vollkommene Wohlbefinden in Gegenwart des anderen! Sie nahm all ihre Kraft zusammen und entschied: „Mit derartigen Gedanken mache ich mich unglücklich. Theo ist nicht Christian, das wusste ich vorher.“ Sie verbot sich künftig solcherlei Träumereien.
Die Vorstellung, ihre Ehe könne zu einer Zweckgemeinschaft verflachen, in der ihre Zweierbeziehung durch stetige Arbeitsüberlastung, fehlende Freiräume und zu wenige Gemeinsamkeiten versanden könnte, ängstigte Elise. Die kleinen Liederabende mit Emmas Zitherspiel und ihrer Lautenbegleitung versuchte sie in ihrem abendlichen Zeitplan fest zu verankern, auch wenn ihr zuweilen die Augen zufielen und sie vor Müdigkeit kaum noch bei Stimme war.
Sie hatte begonnen, der Familie Novellen von Theodor Storm vorzulesen. Zuvor las Emma für Minna aus einem bunten Bilderbuch einfache Tiergeschichten, was bei dem Kind helles Entzücken auslöste. Sie quietschte und jauchzte, strampelte mit den Beinen und war mit dem ganzen Körper in Bewegung vor innerer Anteilnahme. Elise war glücklich, wenn ab und zu die ganze Familie versammelt war und das geschah, was sie unter Familienleben verstand, gemeinsam zu essen, zu erzählen und einen kleinen Feierabendritus zu pflegen. Es war das Neue in ihrem Leben, das sie auch dann durchzuhalten versuchte, wenn alle erschöpft und schlafbedürftig waren.
Auch Theo hatte Freude daran, wenngleich diese Rituale ihm weniger bedeuteten als Elise. Was der Turnverein für Theo, war für Harald der Fußball. ‚Traurig, dass es so ist‘, dachte Elise zuweilen, wenn wieder einmal die beiden Männer lieber woanders waren als zu Hause, aber sie hatte sich damit abgefunden, die beiden zu nehmen, wie sie waren und das Gute zu sehen: ‚So habe ich zwei wohlgebaute und durchtrainierte Mannsbilder im Haus, sofern sie denn mal im Haus sind‘, stellte sie fatalistisch fest. „ Was man nicht kann ändern, das muss man lassen schlendern “, bemerkte ihre Mutter Helene, als Elise einmal mehr ihr Missbehagen andeutete.
Da Elise nicht mehr zum Zeitunglesen kam, las ihr Theo zuweilen einige der Überschriften vor, während sie das Abendessen zubereitete:
„Das Deutsche Reich verkündet den uneingeschränkten U-Boot-Krieg …“
„Ist das nun gut oder schlecht für uns?“, wollte Elise wissen. Durch ihre viele Arbeit verlor sie langsam den Überblick darüber, was draußen in der großen Politik geschah. „Das bedeutet klaren Sieg für uns“, erklärte Theo eindeutig. Nur ein müdes: „Na hoffentlich“, kam von Elise.
Auf ihrem Weg zur Arbeit las sie an einem Kiosk die Überschriften: „Die USA erklärt dem deutschen Reich den Krieg …“
Als sie im Salon ankam, diskutierten ihre Kolleginnen bereits eifrig. Die Kundinnen redeten mit. Das schien eine einschneidende Botschaft zu sein.
„Ist das nicht brandgefährlich?“, fragte Frau Boller, die sehr für diesen Krieg gewesen war.
„Das geht ins Auge!“, entgegnete Kollegin Susanne, eine entschiedene Kriegsgegnerin der ersten Stunde.
„Wieso?“, wollte Boller wissen. „Unseren Soldaten geht die Munition aus. Viele sind angeschlagen, müssen trotz Kriegsverletzungen zurück an die Front. Sie hungern und frieren. Die Amis schicken alles an Material, was ein Soldatenherz sich nur wünschen kann und das in jeder Menge! Wie soll das gutgehen? Der Krieg ist verloren, sag ich euch!“ Susanne hielt sich sofort nach ihrer Rede die Hand vor den Mund. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu laut geplappert, dachte sie erschrocken.
In der nächsten Zeit gab es noch öfter Anlass zu Diskussionen im Salon, in die sich auch die männlichen Kunden leidenschaftlich einmischten.
„Haben Sie das schon gelesen, die ersten Langstreckenbomber vom Typ ‚Gotha‘ greifen London an“, eröffnete Kunde Kröger. „Sollen die Amis doch kommen. Unsere Langstreckenbomber werden das Rennen machen.“ Es klang triumphierend. Elise, die ihm die Haare schnitt, schaute eher mitleidig, als sie entgegnete: „Ich wünsche von Herzen, dass Sie recht haben.“ Sie vermied Streit und fühlte sich verantwortlich für eine gewisse Neutralität von Seiten der Kolleginnen. Sie wollten Kunden mit allzu deutlichen eigenen Aussagen nicht vergraulen.
Auf ihren Heimwegen nahm sie sich hin und wieder Zeit für einige Überschriften. Zudem hatte sie sich angewöhnt, beim Schlangestehen über die Schultern ihres Vordermannes mitzulesen.
Zu den nach ihrer Meinung herausragenden Ereignissen gehörten die Meutereien auf der deutschen Hochseeflotte. Verständlich, dass die Matrosen sich weigerten, noch einmal hinauszufahren, um gegen die Engländer anzutreten. Sie verweigerten dieses Himmelfahrtskommando. ‚Hätte ich auch gemacht‘, dachte Elise, ‚wir sind erst mal zum Leben, nicht vorrangig zum Sterben hier auf dieser Erde.‘ Dieser Krieg ist verloren, dessen war sie sicher. Außerdem war sie grundsätzlich gegen Krieg. Wenn es überhaupt einen Sieger gab, so gab es mit absoluter Sicherheit unendlich viel mehr Verlierer. Tote Väter, Söhne, Brüder. Verhungerte Frauen, Kinder und Alte. Von den Kriegsversehrten nicht zu reden. Nein, keinen Krieg, diesen nicht und nie wieder einen anderen. Sie war erstaunt, wie viele ihrer Bekannten, Kolleginnen und Kunden, immer noch Krieg für unerlässlich hielten. ‚Werde ich nie nachvollziehen können‘, dachte sie und schüttelte den Kopf, während sie nach dem Anstehen nach Kohlrüben auf dem Heimweg war.
Später war von einer letzten großen West-Offensive die Rede, was Elise nur noch mit ‚so ein Wahnsinn‘ kommentieren konnte.
Als Reichskanzler Max von Baden die Abdankung des Kaisers und seinen Rücktritt verkündete, war sie erleichtert und sicher, das Ende stünde nun kurz bevor.
Extra-Blatt-Verkäufer riefen aus, Kaiser Wilhelm II sei ins Exil nach Doorn geflohen.
Dass britische Truppen Köln und Bonn besetzen, empfand Elise als eine unerhörte Schmach.
Sie hatte das Gefühl, dass ihre Kräfte ausgingen, die immer neuen Unglücksmeldungen zu ertragen. Sie lehnte Krieg zwar generell ab, nun aber fühlte sie sich vor allem als Deutsche und gehörte zu den geschmähten Verlierern. Sie fühlte sich persönlich betroffen, persönlich als Verliererin.
Waren das die Gründe, dass es ihr seit Wochen nicht gut ging? Sie war niedergeschlagen. Ihr war übel. Sie sah ihr Leben grau in grau. Alles durch den verlorenen Krieg? Wegen der schlechten Nahrung seit langem? Wegen der zerstörten Zukunft für ihre Familie und ihr Land? Sie war sich nicht sicher.
Schon seit Tagen wartete sie auf den richtigen Zeitpunkt, um mit Theo zu reden. Der richtige Zeitpunkt kam jedoch nicht. Sie waren abends müde, die schlechte Ernährung machte sie schlapp. Das immer gleiche Essen mit dem Wenigen, was es zu kaufen gab, ließ Theo ungenießbar werden. Er maulte unverhohlener denn je, dass Elises Wassersuppen grässlich seien. Aber gerade in dieser Zeit hätte sie von ihm ein gutes Wort gebraucht. Zärtlichkeit. Was für ein Wunsch! War sie eine Träumerin, wenn sie sich von ihrem Mann gelegentlich eine Berührung, ein Wort, einen Blick, etwas wünschte, das sich nach Liebe anfühlte? Oder waren das Jungmädchen-Phantasien? Hatten sie nicht geheiratet, um sich liebzuhaben und gemeinsam stärker zu sein als allein? Dieser eine Blick hätte Mut gemacht. Als er nicht kam und auch das gute Wort oder die liebevolle Berührung nicht, fasste sich Elise eines Abends ein Herz, denn es musste sein.
„Wir werden noch ein Kind haben“, eröffnete sie behutsam ihrem Mann die Botschaft. Erwartungsbang schaute sie Theo an. Er sah auf den Boden. Sie wartete mit einem kleinen Lächeln. Dann berührte sie sachte seine Hand, die herunterhing. Er nahm ihre Hand nicht. Er schüttelte unwillig den Kopf, warf ihr einen kurzen Blick zu und brummte: „Wenn es denn sein muss.“
Er ging an diesem Abend früh aus dem Haus und kam spät wieder. Sie hörte ihn weit nach Mitternacht, wie er die Treppe hochtappte. An seinem Gang und der Art, wie er wiederholt ungeschickt versuchte, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, erkannte sie, dass er betrunken war.
Die zweijährige Minna war wach geworden und weinte. Elise ging zu ihr hin und beruhigte das Kind.
Im Jahre 1918, zwei Jahre nach Minna, gebar Elise den blonden, braunäugigen Udo. Bis auf die Augenfarbe sah er aus wie seine Mama und seine kleine Schwester Minna. Udo lebte am Tage bei Tante Knorrn, einer warmherzigen, fröhlichen Frau, deren eigene zwei Kinder erwachsen waren und das Haus verlassen hatten. Ihre überschüssige Liebe schenkte sie Udo, der wie Minna abends fröhlich und wohlig in seine Familie zurückgebracht wurde. Nun war außer Frau Rösler häufig abends auch Tante Knorrn bei dem kleinen Familien-Abend-Konzert dabei, sang mit heller, klarer Stimme mit und trat zufrieden und froh- gestimmt ihren Heimweg an. Als Udo ein halbes Jahr alt war, bis dahin schlief er bei den Eltern, zog er in Haralds Zimmer ein.
Harald mochte seinen kleinen Baby-Bruder. Wurde er nachts von seinem Weinen gestört, reagierte er zwar unwirsch, weil er aus dem Schlaf gerissen und müde war, wusste aber den Baby-Bruder schnell zu trösten; meist lag dessen Schmusetüchlein am Boden.
Im gleichen Jahr unterschreibt der Leiter der deutschen Waffenstillstands-Delegation, Matthias Erzberger, in einem Eisenbahnwagen im Wald von Compiegne den Waffenstillstands-Vertrag und beendigt die Kampfhandlungen nach vier Jahren.
Die Frauen hatten sich auf den Mangel an Nahrungsmitteln eingestellt. Sie hofften, nach Ende des siegreichen Krieges für ihr Durchhalten an der Heimatfront, wie dieser Kampf der Mütter ums Überleben ihrer Familien genannt wurde, entschädigt zu werden.
Aber alles kam anders. Der Krieg ging verloren. Tausende Kriegsversehrter kamen in die Heimat zurück. Es gab nicht genug Holzprothesen für all die Soldaten, die ein Bein oder beide Beine auf dem Schlachtfeld verloren hatten. Soldaten, die beide Beine verloren hatten, mussten sich mit einem Holzbrett behelfen, unter dessen vier Ecken je ein Rädchen befestigt war und sich mit den Händen vom Boden abschieben.
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln brach zusammen. Vor dem Krieg waren die Lebensmittel zum Teil aus dem Ausland importiert worden. Durch die britische Seeblockade war die Versorgung der Menschen mit Essbarem bereits während des Krieges erheblich erschwert. Diese Seeblockade wurde nach Beendigung des Krieges von den Briten beibehalten. Die Massen der heimgekehrten Soldaten mussten zusammen mit der Bevölkerung mit Nahrung versorgt werden. Die Menschen lebten nach wie vor überwiegend von Steckrüben, Kartoffeln und Brot. Aber auch diese Magerkost war nur in völlig unzureichender Menge verfügbar. Milch und Fleisch sah man schon lange nur noch in Kinderbilderbüchern. Zu allem Übel kam hinzu, dass 1918 die Ernte wegen ungünstiger Witterungsbedingungen schlechter ausfiel als in den Jahren zuvor. Auch für Nahrungsmittel galt der Import-Stopp.
Die Not der Menschen war groß, der Hunger ihr täglicher Begleiter. Alles Denken und Sinnen drehte sich um die Beschaffung von Essbarem und als der Winter kam, auch von Heizmaterial. Die Widerstandskraft der Menschen ebbte ab. Viele erkrankten im kalten Winter an Lungenentzündungen und Tuberkulose. Viele Menschen, zuweilen arbeits- und wohnungslos, starben entkräftet oder erfroren auf einer Parkbank oder auf der Straße.
Immer mehr Suppenküchen versuchten, die größte Not zu lindern. Immer länger wurden die Schlangen der nach einem Teller heißer Wassersuppe anstehenden Menschen.
Die Kriegsheimkehrer versuchten Arbeit zu finden. Durch die Bedingungen des Versailler Friedensvertrages mussten enorme Summen für Kriegsschäden, von Deutschen im Ausland verursacht, aufgebracht werden. Die Seeblockade und die Unmöglichkeit, Material im Ausland zu kaufen sowie das fehlende Geld für Investitionen, hatten zur Folge, dass die Industrie zusammenbrach. Tausende von Industriearbeitsplätzen gingen verloren. Während des Krieges hatten Frauen die Arbeitsplätze der Männer ausgefüllt. Die Kriegswitwen versuchten nun, ihre Arbeitsplätze zu behalten.
Der Staat versucht, durch Geldvermehrung Investitionen anzukurbeln. Diese Geldvermehrung führt nach und nach zu einem Verfall des Geldwerts, der Inflation.
Spekulanten kaufen Vermögenswerte, Häuser, Grundstücke und werden reich. Sparer verlieren nach und nach ihre Ersparnisse durch Geldentwertung und werden arm.
Im Jahr 1918 beträgt der Wertverlust auf 100 Mark gegenüber dem Vorjahr 26 Mark, die Mark ist also gegenüber 1917 noch 74 Pfennig wert, 1921 noch 35 Pfennig. Wer einen Dollar kaufen will, bezahlt 1918 vier Reichsmark und zwanzig Pfennige. 1921 kostet ein einziger Dollar bereits 270 Mark. Im Jahr 1923 wird ein einzelner Dollar 4,21 Billionen Reichsmark kosten, die Mark wertloses Papier sein, Papier zum Ofen-Anzünden, Spielgeld für Kinder!
Theos Chef lässt seine Mitarbeiter kommen. Sie treffen sich eines Morgens im „Zuschnitt“.
„Kollegen“, beginnt der Chef, „noch seht ihr an den Wänden die Häute hängen, die gegerbten und gefärbten Leder. Noch habt ihr hier den altbekannten Ledergeruch um euch und in der Nase. Ihr lest Zeitung und wisst, was ‚Seeblockade der Engländer‘ heißt. Ich kann das meiste Material, das wir bisher aus dem Ausland bezogen haben, nicht mehr beschaffen. Import-Verbot für alle ausländischen Waren heißt das. Es gibt zwei Möglichkeiten: den Betrieb schließen oder verlagern. Um es kurz zu machen, ich werde in die Schweiz verlagern.“
Fendler, der Chef, steht am Kopf des langen Zuschneide-Tisches, neigt sich leicht nach vorn, fährt sich mit den Händen durch die Haare, stützt sich mit beiden Fäusten auf den Tisch und schaut seine zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reihe nach an. Seine Leute stehen hohlwangig, mit grauen Gesichtern wie versteinert vor ihm, Arme und Hände herab hängend wie nutzlos gewordene Werkzeuge. Es ist grabesstill im Raum.
„Ich weiß. Das klingt schlimm“, bemerkt Fendler abwartend. „Aber es gibt Hoffnung: Wer mitgehen will, kann mitgehen. Drei Häuser für sechs Familien werden in der Nähe des neuen Betriebsgeländes bereitstehen. Ja, ich war da, hab’ mir alles angesehen. Die Bedingungen sind gut. Die Kinder können dort die Schule besuchen. Die Schweizer sprechen etwas merkwürdig und sind schwer zu verstehen, Schwiezer Dütsch, Schweizer Deutsch, aber das lässt sich lernen. Natürlich müsst ihr erst mal drüber schlafen und zu Hause alles bereden. Dennoch vorab: Wer von euch würde voraussichtlich mitgehen?“
Eine große Bewegung entstand unter den Frauen und wenigen Männern. Viele Männer der hier anwesenden Frauen, zuvor bejubelte Soldaten in schneidigen Uniformen, waren nun, verunstaltet und demoralisiert, von der Front heimgekehrt, den Frauen und Kindern zu Hause oft eine Last. Sie fanden keinen Platz mehr im zivilen Leben. Ruhm und Ehre für ihre beschädigten Körper und Seelen blieben aus. Sie waren mit einzubeziehen.
Alle Finger gingen nach oben.
Als im März 1919 Theo mit Elise, Harald, der dreijährigen Minna und dem Baby Udo in die Schweiz umzogen, waren einige Familien schon dort und erwarteten sie. So hörten sie neben dem neuen Schwiezer Dütsch zu ihrem Trost auch den Dialekt ihrer schlesischen Heimat.
Die dreijährige Minna glaubte, sterben zu müssen, als es hieß, sie müsse sich von ihrer geliebten Emma trennen. Als die Familie in Kreuzlingen das Schiff bestieg, tanzte sie auf dem Schiffsdeck und trällerte fröhliche Lieder. Die Leute hatten Freude an diesem munteren kleinen Mädchen.
Später erzählte sie ihren eigenen Kindern und Enkeln, sie tanzte und sang gegen ihren Schmerz, ihre grenzenlose Verzweiflung an. Sie war so unglücklich, dass sich auch später noch bei der Erzählung dieses Ereignisses ihre Augen mit Tränen füllten. Ebenso litt Emma. Am ersten Tag nach dem Wegzug ihrer Familie fand sie sich in der leeren Wohnung wieder. „Ich hatte nicht einmal mehr einen Spiegel“, erzählte sie. „Ich hatte mein Bett, meine Zither und meine Laute.“ Auch diese Erinnerung trieb ihr noch nach Jahrzehnten Tränen in die Augen.
Ihr wurde bewusst, mit dem Wegzug ihrer Familie hatten ihre Kindheit und Jugend ihr Ende gefunden.
Aber das Leben würde weitergehen, wenngleich das Wie im Augenblick noch völlig im Dunklen lag.