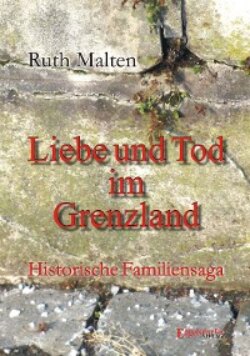Читать книгу Liebe und Tod im Grenzland - Ruth Malten - Страница 9
3. Kapitel
Gustav will weiterkommen und zieht nach
Breslau um
Оглавление„Das ist ja erstaunlich“, sagt beim Frühstück Gustav zu Hermine. „Was schätzt du, wie viele Menschen gegenwärtig in Deutschland leben?“ Hermine, die selbst Zeitung liest und noch in Gedanken ist, kräuselt die Stirn, schaut ihren Mann an und schüttelt den Kopf: „Keine Ahnung, vielleicht fünfzigtausend?“ Sie streicht sich über die Stirn. Die Frage passte nicht in ihren eigenen Gedankengang. „Knapp daneben“, sagt Gustav und lacht: „Nach der jüngsten Volkszählung vom 1.12.1910 sind es 64.926 Millionen. Aber zu deiner Beruhigung, ich hätte es auch nicht gewusst.“
„Noch eine Frage, schon schwieriger: Wie viele Schachtanlagen sind gegenwärtig im Ruhrgebiet in Betrieb?“ Hermine lächelt Gustav an: „Du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich könnte sagen drei oder dreitausend. Keine Ahnung.“
„Hatte ich auch nicht“, entgegnet Gustav. „Aber ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass es 174 sind mit 353.347 Beschäftigten und dass dort jährlich 89 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr gefördert werden. Da bekommt man einen Begriff, wie wichtig das Ruhrgebiet für unsere Volkswirtschaft ist. Hab ich, ehrlich gesagt, nicht gewusst.“
Bei seiner Post liegt ein Brief seines Freundes Otto, mit dem er gemeinsam die Ausbildung zum Fliesenleger erfolgreich durchlaufen hat. Vor einem Jahr verzog Otto nach Breslau, um in einem anderen Betrieb Neues hinzuzulernen und voranzukommen.
„Ich kann nur sagen, komm her. Breslau hat sich gelohnt“, schreibt er. „Die Stadt begeistert mich: Die Oder, der Dom, das Schloss, das tolle Rathaus. Dann die Möglichkeiten nach Feierabend: Kino, Theater, urige Kneipen. Unser Sohn ist im Turnverein, das Mädchen in einer Flötengruppe. Ihnen gefällt’s. Das Beste: Ich verdiene mehr als zuvor und kann den kleinen Wohlstand bezahlen. Wie wär’s mit Dir und Deiner Familie?“
Gustav und Hermine erwogen seit längerem, eine geräumigere Wohnung zu mieten. Ilse brauchte mit ihren vier Jahren ein eigenes Schlafzimmer anstelle ihres Bettes im Schlafzimmer der Eltern. Gustav hatte mit seinem gegenwärtigen Chef über mehr Lohn verhandelt. Seine beachtliche Berufserfahrung als Geselle und Meister hatten ihren Wert. Das wusste sein Chef, konnte ihn jedoch nicht höher entlohnen. So empfand Gustav die momentanen Verhältnisse für sich und seine Familie als Sackgasse.
Da sie ohnedies umziehen mussten, konnte auch der Ort ein anderer sein, befand Gustav. Ein Umzug in die schlesische Hauptstadt mit ihren 600.000 Einwohnern hatte auch für Hermine ihren Charme.
Im Jahre 1911 siedelte die Familie in die Breslauer Stadtmitte über in eine Wohnung mit drei Schlafzimmern und einer großen Wohnküche. Gustav machte schnell eine neue Anstellung bei der Baustofffirma Walter ausfindig als rechte Hand des Chefs, befugt zu planen, zu kalkulieren, einzukaufen und auszuliefern. Dank schneller Auffassungsgabe, dem guten Blick für das Wesentliche und seiner offenen, einnehmenden Wesensart wurde er bald ein unentbehrlicher Mitarbeiter, angesehen bei Kollegen und Kunden. Er fühlte sich in seinem neuen Wirkungsfeld wohl. Er lernte, wie eine Firma zu führen sei und sah, was ein Handwerker, einmal selbständig, wirtschaftlich erreichen konnte. So keimte sein Traum: Eine eigene Baustoffhandlung. Diesen Traum vergrub er einstweilig in seinem Herzen. Seine Familie sollte sich zunächst in Ruhe hier einleben können und nicht durch neuerliche Pläne verunsichert werden.
Arthur besuchte die Oberrealschule; Paul das zweite Jahr der Volksschule. Beide kamen gut voran und hatten Freude am Lernen.
Ilse mit ihren fünf Jahren schlenderte mit der Mutter zuweilen die nach und nach aufgespürten reizvollen Wege entlang: Am Ufer der Oder, zur Dom-Insel, der Sandinsel, vorbei am Rathaus, und von dort an den Markttagen zu den zahlreichen vielfarbigen Ständen mit karminrot und flaschengrün gestreiften Herrenhuter Äpfeln, südländischen Orangen und Bananen, staksigen, mit Bindfäden zusammengehaltenen Bündeln von Schwarzwurzeln, glänzenden weiß-lila Wasserrübchen, hohen Gläsern mit Salzgurken aus dem Spreewald und grünlich-weißen Senfgurken, leuchtenden Geranien, Petunien in ihren hauchzarten Violett-Tönen und Eimern mit teuren langstieligen Edelrosen. Ilse mit ihren blonden Riesellöckchen, dem langen, gebauschten hellrosa Kleid mit breitem, weinroten Taftgürtel und weißem Schuten-Hütchen passte in diese Farbsinfonie. Sie bat Hermine, ein hellblaues Vergissmeinnicht-Sträußchen, das sie besonders entzückte, kaufen zu dürfen und für den Vater mitzunehmen.
In einem kleinen Straßen-Cafe mit roter Pergola, umrahmt von Kästen voller rosa und weißer Hängegeranien, pausierten sie und ließen sich in kleinen mit Kissen ausgestatteten Korbsesseln nieder. Ilse, die kurzen Beine in der Luft hängend, schaukelte zufrieden mit ihren in schwarzen Lack-Schnallen-Schuhen steckenden Füßen. Hermine genoss den sonnigen und warmen Frühlingstag mit ihrem Mädchen, schlürfte ihre Tasse Bohnenkaffee, Ilse einen Gerstenkaffee. Sie bewunderten die Hausfronten mit ihren fantasievollen Giebeln, mal gestuft, dann in weichen Bögen ansteigend, in sanfter Rundung oder spitz endend, alle mit gediegenem Geschmack erdacht und ausgeführt. Dazu die vielfach unterteilten Fenster mit naturweiß gestrichenen Rahmen sowie die Pastelltöne der Häuserfronten, zart wie mit Aquarellfarben getuscht. Am nahen Rathaus bewunderten sie das dunkelrote, weinrankenartig verflochtene Muster des Hauptgiebels auf hellem Untergrund, verschlungen wie eine nach oben ansteigende Stickerei, in fünf Bögen beginnend und in einer kugeligen Spitze endend.
Ilse liebte besonders ein Handarbeitsgeschäft am Marktplatz mit gestickten Decken, gehäkelten Westen, gestrickten Pullovern im Fenster und all den herrlichen dazu gehörigen Garnen und Materialien. Hermine kaufte Ilse ein naturfarbiges Baumwoll-Deckchen mit aufgedrucktem Muster und zeigte ihr zu Hause mit feinem Garn und dünner Nadel, wie Kreuzstich gestickt wurde.
Ilse schnupperte an Stoff und Fäden und war von dem Duft des Geflechts und Garnes wie berauscht. Sie fand hier ihr Steckenpferd, eine lebenslange Quelle von Freude und auch Trost in schweren Tagen, die noch kommen sollten. Als sie stricken lernte, wurde das zu einer Leidenschaft, die alle anderen Betätigungen auszulöschen drohte. Sie musste sich Grenzen setzen.
Hermine hatte das Gefühl, in der Stadt aufzublühen. Hier konnte sie die eleganten Röcke und Blusen, die modischen Hüte und ausgefallenen Schuhe tragen, die ihr gefielen, ohne dass abfällig geflüsterte Bemerkungen der Nachbarinnen oder deren missbilligende Blicke ihr die Freude daran verdarben.
Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Äußerte sie ihrem Kaufmann ihre Wünsche, geschah es nicht selten, dass Kundinnen neben ihr unversehens die Hand vor den Mund hielten, sich abwandten, heimlich kicherten, oder sich verdutzt schmunzelnd mit hoch gezogenen Augenbrauen vielsagende Blicke zuwarfen. Zuweilen musste sie ihren Satz mehrfach wiederholen, weil die Verkäuferin sie nicht verstanden hatte. Acht Jahre einklassige Volksschule im tiefsten dörflichen Sachsen machten ihr hier zu schaffen.
Sie mühte sich zwar, Hochdeutsch zu reden, aber was war hier Hochdeutsch? Die Einheimischen sprachen ihr spezielles Schlesisch, so wie Hermine ihr heimatliches Sächsisch. Hinzu kam, die Breslauer, im Allgemeinen offen und zutraulich, konnten zu ‚Lergen‘ werden, flinkzüngigen Frechdachsen, die loszankten, wenn man ihnen vermeintlich dumm- kam. Dann wurde drauflos gewettert, eher laut als leise, mehr Rotwelsch als Hochdeutsch. Ein Wortschwall dieser Art, ungefiltert und unbereinigt, konnte eine ahnungslose sächsische Einwanderin durchaus erschüttern. Hermine hatte bald herausgefunden, wie sie solchen Biestereien am besten entkam: Mund halten statt mit zu zetern. Ein großer Lernschritt für Hermine, die Disputen – vorrangig in ihrem Großröhrsdorfer Sächsisch – bisher nicht aus dem Weg gegangen war, im Gegenteil, sie liebte leidenschaftliche streitige Debatten.
Hin und wieder brachte Gustav, der durch intensiven Kundenkontakt mit Menschen unterschiedlicher Dialekte in Verbindung kam, eine hochdeutsche Vokabel mit nach Hause. Zum Beispiel erklärte er Hermine, spitzbübisch schmunzelnd: „Es heißt nicht ‚die Sollote‘, mit Betonung auf der ersten Silbe, wie in Großröhrsdorf, auch nicht Solload, wie in Breslau, sondern ‚der Salat‘.“ Auch Sohn Arthur korrigierte mehr und mehr seine Hintersächsisch sprechenden Altvorderen. Dieses Thema war für die Familie jedoch eher eine Lachnummer. „Es gibt Wichtigeres als Hochdeutsch“, fand Gustav.
Aus der Schule bringt Arthur die Neuigkeit mit, der preußische Kriegsminister von Heeringen warne vor Verweichlichung der Jugend und empfehle vormilitärische Ausbildung. Auf Anregung von Generalfeldmarschall von der Goltz werde der halbstaatliche Jugenddeutschlandbund gegründet, der vormilitärischen Sport pflegen und die körperliche und sittliche Erziehung der Jugend im vaterländischen Geist gewährleisten solle. „Klingt doch gut, oder?“, bemerkt Arthur fragend zu seinem Vater hin. Gustav schaut seinen Sohn durchdringend mit seinen blauen Augen an, als wolle er ihn durchbohren: „Hoffentlich geht’s dabei wirklich um das Wohl der Jugend. Klingt in meinen Ohren verdammt nach politischer Säbelrasselei“, entgegnet er, skeptisch wie immer.
Paul und Arthur sind Stammgäste in der Städtischen Bücherei. Arthur entleiht nach und nach alle Bände seines sächsischen Landsmannes Karl May. Paul liebt Werke der Geschichte und Klassik. Gegenwärtig liest er den ‚Kampf um Rom‘ von Felix Dahn. Als die beiden Lieblings-Autoren 1912 sterben, Felix Dahn in Breslau, empfinden die beiden Brüder Trauer, als seien gute Freunde von ihnen gegangen.
Da Paul Musik liebt und sich insbesondere zu klassischer Musik hingezogen fühlt, meldet ihn Hermine für Geigen-Unterricht bei Selma Havel an. Die Adresse las sie in der Tageszeitung. Das Lesen der Noten ist für Paul der eingeschränkten Sehfähigkeit wegen nicht einfach. Da er sich jedoch vom ersten Unterrichtstag an stark zu Selma Havel hingezogen fühlt, gibt er sich große Mühe und kann mit den anderen fünf Kindern der Gruppe mithalten.
1913 erfüllt sich Gustav einen lang gehegten Traum: Er kauft sein erstes Auto, einen Audi von Firma Horch in Zwickau.
Die Familie steht staunend um das seltsame Gefährt. Arthur bemerkt: „Sieht aus, wie Opas Lehnsessel auf Drahträdern.“ Paul wundert sich über die Scheinwerfer, die fast frei in der Luft zu schweben scheinen, bei näherem Betrachten jedoch mit dünnen Metallröhren miteinander verbunden und mit weiteren dünnen Stäben an der Kühlerhaube befestigt sind. Hermine betrachtet das Firmen-Emblem: „Schaut mal, wie ein Reiher im Flug.“ Bei näherem Hinschauen zeigt sich lediglich ein windschnittiges Flügelpaar, rückwärtig von einem vorwärts gerichteten Pfeil durchbohrt, den Eindruck blitzartiger Schnelligkeit vermittelnd.
Andere Kinder, auch Erwachsene sind hinzugekommen und betrachten das Kraftfahrzeug bewundernd und beeindruckt. Arthur, Paul und Ilse sind stolz auf ihren Vater, der mit seinem Fahrzeug derart im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit steht.
Seine erste längere Tour unternimmt Gustav, um Arno, seinen Schulfreund aus Großröhrsdorf, zu besuchen, der sich in Allenstein im Ostpreußischen als Schreiner selbständig gemacht hat und ihn vor Monaten einlud. Ein Satz aus Arnos Brief hämmert beschwingt in Gustavs Hinterkopf: „In meiner Nachbarschaft gibt ein Baustoffunternehmer aus Altersgründen auf. Da er keinen Erben hat, sucht er einen Nachfolger.“ Noch ahnt seine Familie nichts von diesem Satz und Gustavs tief im Herzen verborgener Faszination.
Die Familie steht um den Horch und bewundert den Mut des Vaters, mit diesem fremdartigen, knatternden und seltsam stinkenden Gefährt eine so weite Reise allein aufzunehmen. Zwar ist Gustav aufgeregt, aber seine Augen strahlen, sein Kopf ist vor Freude gerötet und er lacht begeistert, als er sein erstes Auto lautstark startet und die Familie ängstlich und stolz, fröhlich und besorgt hinter ihm herwinkt.