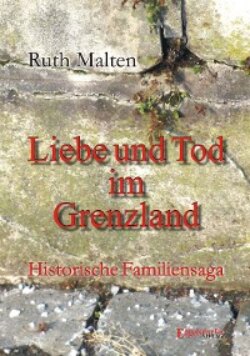Читать книгу Liebe und Tod im Grenzland - Ruth Malten - Страница 14
8. Kapitel
Der erste Weltkrieg bricht aus
ОглавлениеAm nächsten Vormittag geht es in der Klasse lebendig zu. Die Jungen drehen die Köpfe einander zu, fuchteln mit Händen und Armen, mit erhitzten geröteten Gesichtern reden sie aufeinander ein und sind lauter, als es Friedmann, ihr Geschichtslehrer, normalerweise erlaubt. Friedmann öffnet eines der hohen, vielfach unterteilten, weiß gestrichenen Fenster, um frische Luft hereinzulassen. ‚Hier stinkt’s wie in einem Raubtierzwinger‘, denkt er schmunzelnd, ‚kein Wunder, bei dreißig sich ereifernden, schwitzenden jungen Männern, die sich wie kraftstrotzende junge Löwen gebärden, gegenwärtig aber in viel zu engen, verkratzten Holzbänken, diese zu zweit miteinander verschraubt, wie eingeklemmt hocken. Das Ratschen der Schuhe auf dem Boden markiert den erhöhten Erregungspegel.‘
Krieg soll es geben, haben sie gehört. Hellwach sind sie alle geworden. Mitmachen? Na klar! Du spinnst wohl! Denk mal an die Folgen! Gedanken fliegen hin und her wie harte Tennisbälle. Das Thema hat sie entzündet. Keiner träumt heut den sanften Dämmerschlaf wie zuweilen, wenn von alten Römern oder Griechen die Rede ist.
Friedmann lässt seine Schüler frei ihre Gedanken und Gefühle benennen. Einige haben zu Hause über die Möglichkeit eines Krieges debattiert. Siegfrieds Großvater hatte gesagt: „Da gibt es nichts zu überlegen. Wenn ich nicht zu alt wäre, zöge ich sofort wieder mit wie 1870/71, als wir den Franzosen die Hucke versohlt und sie gescheucht haben wie die Hasen, und nur noch entfernt ihre roten Strümpfe von hinten blitzten. Ein Mordsspaß war das, kann ich dir sagen! Als wir heimkehrten, waren wir Helden, wurden bejubelt. Frauen hängten uns Blumenkränze um den Hals. Wie ein junger Gott hat sich jeder gefühlt! Die Menschen am Bahnhof umschwärmten ihre Helden. Auf den Händen trugen sie uns. In einer Woge von Stolz und Glück schwelgte unser Volk.“
Siegfrieds Augen strahlen, als sei er selbst dabei gewesen, er springt auf, während er gewichtig und begeistert die Worte seines Großvaters wiedergibt, sein Gesicht glüht wie im Fieber. Seine Mitschüler haben aufgehört, durcheinander zu reden und ihm stattdessen mit wachem Verstand vornübergeneigt zugehört. Manche bemerken nicht, dass sie mit offenem Mund schniefen und ihnen die Nase läuft.
„Siegfried, erzähl mal, wie es damals zur deutschen Kriegserklärung an die Franzosen kam“, fordert ihn Lehrer Friedmann auf. „Die Emser Depesche“, und was beinhaltete sie, hakt Friedmann nach? „In verkürzter Form die Forderung Frankreichs, das Haus Habsburg solle für alle Zeiten den Anspruch auf den Spanischen Thron aufgeben. Die verkürzte Form provozierte Frankreich, das daraufhin Deutschland den Krieg erklärte.“
„Und wie reagierten die Deutschen?“ Friedmann sah Arthur an: „Begeistert. Eine nationale Begeisterung lag in der Luft. Alle wollten mitmachen“, sagte Arthur. Friedmann hätte seine Schüler gern immer so geistesgegenwärtig wie an diesem Tag. Nachdenklich durchschreitet er den Mittelgang des Klassenzimmers, die Hände auf dem Rücken, den Kopf gesenkt, begleitet von den gebannten Blicken seiner Schüler. Auf seinem Rückweg sagt er bedacht, wie zu sich selbst, seine graumelierte wuchtige Haartolle in der Stirn: „Stellt euch vor, Österreich-Ungarn erklärt Serbien wegen der Todesschüsse in Sarajewo den Krieg. Was könnte passieren?“
Der lange, schlaksige, blondgewellte Hans ist der ‚Profi‘, und die unumstrittene Nummer Eins innerhalb der Klasse in Geschichte und Politik. Auch privat ein ernsthafter Wühler, lässt er nichts auf sich beruhen, was er nicht begriffen hat und liest alles, was ihm zu verstehen hilft. Durch seinen Großvater, Geschichtslehrer an einer Realschule, hat er einen vortrefflichen Gesprächspartner, was ihm zu einem Wissensvorsprung verhilft. Er meldet sich: „Nach dem Dreibund zwischen Österreich-Ungarn, Italien und Deutschland von 1882 ist Deutschland zu Waffenhilfe verpflichtet. Außerdem gibt es einen Vertrag zur Waffenhilfe zwischen Serbien und Russland aufgrund des Balkan-Bundes.“ Friedmann forscht weiter: „Deutschland beteiligt sich an dem Krieg gegen Serbien, was könnte weiter geschehen?“
„Russland könnte nach dem Eintritt Deutschlands aufgrund des nicht erneuerten Neutralitätsvertrages von 1890 in den Krieg gegen Deutschland eintreten. Da es außerdem ein deutsch-französisches Neutralitäts-Abkommen gibt, wären auch die Franzosen auf der Gegenseite dabei. Durch den Dreibund zu gegenseitiger Neutralität und Waffenhilfe verpflichtet, wären die Italiener auf der Seite der Deutschen. Über die britisch-französische Marine-Konvention sowie die Entente Cordiale die Briten auf der Gegenseite. Letztere verpflichtet beide gegenseitig zu Waffenhilfe.“ Hans hat sich in Rage geredet, und er ist außer Puste.
„Mann, Streber“, ist von Uwe zu hören, allerdings mehr anerkennend als abwertend, aber auch mit dem Unterton: ‚Wer soll sich das alles merken können?‘ Hans kennt das schon. Er zieht beide Schultern hoch, seine Stirn in Querfalten, legt seinen Kopf schief, schaut Uwe grinsend an und sagt: „Tja, Mann, nur kein Neid.“
Friedmann kann ein stillvergnügtes Schmunzeln nicht unterdrücken. Er muss bei einem Schüler wie Hans seinen Stoff sauber vorbereiten, sonst geht er unter. Guter Ansporn. Macht aber Freude. Mit halbwegs gestrenger Lehrermiene fährt er fort:
„Das sind einige wesentliche europäische Bündnisse. Das Ganze ist nicht ungefährlich. Es könnte zu einem Domino-Effekt kommen. Winfried, was ist ein Domino-Effekt?“
„Ein Stein fällt um und reißt den nächsten mit, der nächste den übernächsten und so weiter, bis keiner mehr steht. Es kommt zu einer Bewegung, die sich verselbständigt und kaum aufgehalten werden kann“, sagt Winfried, der bei seinem letzten Halbsatz zögert, weil ihm einfällt, dass man das Ganze abbremsen könnte, wenn an einer Stelle rechtzeitig etwas eingeschoben würde, was den Fortgang der Fallbewegung stoppt.
Siegfried meldet sich wieder, die Mitschüler wollen hören, was er zu sagen hat, und ihre Köpfe drehen sich zu ihm hin.
„Das mit den Abkommen ist reine Theorie. Sie werden nicht akut werden, da die Deutschen, wenn es zum Schwur kommt, an der Seite Österreich-Ungarns die Serben in wenigen Wochen weghauen werden. So wie 1870/71 die Franzosen. Ist doch völlig klar! Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier einer anders sieht, oder?“ Zunächst herrscht verunsichertes Schweigen, dann setzt ein allgemeines Gemurmel ein, das sich schnell wieder zu dem anfänglichen, lautstarken Stimmengewirr steigert.
Siegfried ist von dem, was sein Großvater ihm von 70/71 erzählt hat, für eine argumentative Diskussion gut gerüstet, fühlt sich stark und strotzt vor verbaler Kampfeslust. Mit gestraffter Brust ragt er auf und schaut in die Runde wie ein Sieger. „Das können wir sogleich klären“, sagt Friedmann, „wer von euch würde in den Krieg gehen, wenn es dazu käme?“ Alle Zeigefinger springen jetzt ohne Zögern nach oben bis auf die von Arthur und Wolfgang. „Kein Nationalgefühl!“, ist zu hören, „Feiglinge!“, ruft Siegfried leidenschaftlich. „Vaterlandslose Gesellen“, lässt sich Ortfried vernehmen, grinst aber in einer Weise, die das Gesagte als witzige Provokation, weniger als ernst zu nehmenden Diskussionsbeitrag definiert. „Na, na“, ist deshalb Friedmanns einziger Kommentar, begleitet von einem Kopfschütteln, andeutend, hier sei die Grenze des guten Geschmacks erreicht. Arthur und Wolfgang schauen sich um, sehen die große Einheitlichkeit der einen Meinung und heben nun ebenfalls widerstrebend die Hände. Ihrer beider Rücken sind tief über ihre Pulte gebeugt, die Augen selbstunsicher, mehr zweifelnd als zustimmend von unten aufwärts gerichtet, als schämten sie sich, und tauschen verstohlenen einen schnellen einvernehmlichen Blick aus.
Nach dem Unterricht diskutieren die Schüler, die Jacken über die Schulter geworfen oder um die Taille gebunden, die Büchertaschen zwischen die Beine geklemmt, auf dem Schulhof weiter. „Noch gibt es keine Kriegserklärung“, sagt einer. Ein anderer: „Aber wenn, bin ich dabei, logisch und Ehrensache!“
Arthur und Wolfgang erwägen auf dem Nachhauseweg weiter das Pro und Contra. „Ich denk’ da an meine Mutter“, sagt Arthur, „ich glaub’, sie käme nicht mehr in Schlaf, wenn ich in einen Krieg zöge.“ Wolfgang, den Kopf zwischen den hochgezogenen Schultern und bedrückter Miene hört seinem Freund zu. „Hast recht“, entgegnet er, vor sich auf den Weg schauend, seine Tasche unter einen Arm geklemmt und mit beiden Händen festhaltend, „die Mütter sitzen zu Hause und grübeln. Weil sie nicht wissen, was Sache ist, malen sie sich das Schlimmste aus und quälen sich. Vor allem, weil sie nichts tun können, außer vielleicht Socken stricken und Päckchen packen.“
„Wenn ich mir meinen jüngeren Bruder vorstelle oder meine kleine Schwester, denen ginge es auch nicht besser“, sagt Arthur. „Vielleicht haben die jungen Helden an der Front sogar Spaß, während ihre Mütter zu Hause weinen“, spinnt Wolfgang den Gedanken fort. „Spaß kann ich mir im Krieg nicht vorstellen. Hier sterben Menschen. Und wer mitmacht, muss schießen. Schießen oder erschossen werden, heißt dann die Losung. Du machst dir die Hände schmutzig, ob dir das gefällt oder nicht“, wendet Arthur grübelnd ein. Beide sind sehr nachdenklich geworden.
In den nächsten Tagen ist in den Zeitungen zu lesen, dass Kaiser Wilhelm II. in völliger Fehleinschätzung des europäischen Bündnissystems Österreich-Ungarn ermuntert, gegen Serbien vorzugehen. Daraufhin macht Serbien mobil, Österreich-Ungarn teilmobil. Russland beginnt mit Kriegsvorbereitungen und unterstützt die Serben. Beide gehören der panslawischen Bewegung an. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg.
Am 31.07.1914 hört man die Jungen mit den Extra-Blättern: „Das Deutsche Reich erklärt die allgemeine Mobilmachung und den allgemeinen Kriegszustand.“
Die Kriegsbegeisterung in Deutschland wie auch in den anderen europäischen Staaten kennt keine Grenzen , ist in den Gazetten zu lesen.
Auch in Allensteins Straßen ist etwas zu spüren von dieser Hochstimmung. Männer in Gruppen, wild mit den Armen gestikulierend, politisieren stimmgewaltig und leidenschaftlich. Frauen auf dem Marktpatz, die Einkaufstaschen zwischen den Füßen, halten auf ihrem Heimweg inne, reden wie berauscht, nachdrücklich und mit hoher Stimme, zuweilen alle gleichzeitig und lauter als üblich. Männer trotten, die Zeitung lesend, vor sich hin, eine Feiertagszigarre im Mundwinkel. Hände winken fröhlich einander zu. Das Stimmengewirr auf dem bewegten Marktplatz und in den Wirtschaften klingt wie das wirre Summen eines aufgescheuchten Bienenschwarms.
Vom Holzkohlengrill ziehen Duftwolken safttriefender und goldbraun gerösteter Würste schon am Vormittag Passanten an. Der würzige Wohlgeruch von Gebratenem mit Senf vermischt sich mit dem Bukett der Astern, Zinnien und Nelken in den Blecheimern, der Zigarren und des Kaffees eines Ausschanks, an dem eine freundliche Marktfrau in blau-weiß kariertem Dirndl mit blauer Schürze mehr knusprig-fettglänzende Krapfen als sonst aus dem blasenwerfenden, siedenden Öl fischt und dick mit Puderzucker bestäubt. Kassen klingeln. Kinder rennen munter johlend umher, kleine schwarz-rot-goldene Papierfähnchen schwenkend. Sie beteiligen sich fröhlich trällernd an der allgemein aufgekratzten Stimmung, ohne den Grund dieser Volksfeststimmung zu kennen und umlagern mit munterem Stimmengewirr den bunt mit rosa, hellblau und gelben Eistüten bemalten Wagen des Eismannes.
Rauchige Schwaden von Bratöl tauchen das Marktgeschehen in einen blauen Dunstschleier von Unwirklichkeit.
Gustav liest abends Hermine aus der Zeitung vor: „Die vor dem Berliner Schloss wartende Menschenmenge stimmt, als sie die Nachricht vom Kriegsausbruch hört, spontan den Choral an: ‚ Nun danket alle Gott …‘ Menschen fluten mit Fahnen durch Berlin. Die Wirtschaften sind voll besetzt. Patriotische Lieder werden gesungen und Ansprachen gehalten. Hochrufe auf Kaiser, Heer und Marine sind allerorten zu vernehmen. Zwei Millionen Männer werden einberufen, melden sich freiwillig, werden ausgerüstet und bewaffnet.“
Hermine hört sich das an und schüttelt wieder und wieder den Kopf. „Spinnen die denn alle!“, sagt sie schließlich viel zu laut. Ihre Stirn kraust sie in Längs- und Querfalten, ihre graugrünen Augen funkeln unheildrohend. „Ist denn in Berlin keiner mehr, der noch klar denken kann?“
Arthur kommt zur Tür herein. Er wirkt erwachsener in dieser Zeit, aber noch schweigsamer als gewohnt. In diesen wortkargen Tagen, nach zahlreichen Streitgesprächen im Geschichtsunterricht, in den Pausen, auf dem Schulhof mit Mitschülern und dem Heimweg mit seinem Freund, ist in ihm, wie auch in Wolfgang, ein Entschluss gereift. Er sieht Vater und Mutter mit Zeitung und den neuesten Nachrichten beschäftigt und fasst sich ein Herz, zu offenbaren, was er nicht mehr verschweigen kann: „Unsere Klasse hat sich geschlossen zum Kriegseinsatz gemeldet.“ Als der Satz heraus ist, rumpelt sein Herz so, dass er bangt, seine Eltern könnten den wilden Herzschlag hören. Einen Augenblick lang befällt ihn Mutlosigkeit. Die sekundenlange Beklommenheit verdrängt er jedoch standhaft, schöpft tief Luft, und sein eiliger Herzschlag ebbt ab.
Er sieht seine Mutter nach Luft schnappen, ihre Lippen öffnen und formen sich zu einer Aussage, er kommt ihr zuvor: „Wir wollen alle dabei sein. Wir wollen schneller zurück sein als unsere Großväter 1870/71. Etwas anderes kommt für uns nicht in Frage.“
Gustav schaut seinen Sohn an und überlegt, wäre ich in seinem Alter, würde ich ebenso denken und reden. In gewisser Weise ist er stolz auf seinen Großen, der in diesen Tagen erwachsen geworden ist.
„Habt ihr alles gut bedacht?“, fragt er dennoch. „Im Geschichtsunterricht haben wir das Für und Wider ausgiebig erwogen. Da wir aber siegen werden, lehnen die meisten von uns die Unkereien der ewigen Bedenkenträger ab.“
Hermine würde jetzt gern Arthurs Hand nehmen und ihn bitten, nicht zu gehen, einfach bitten. Aber da steht er, entschlossen, jung und stark, als wäre dieser angehende junge Krieger nicht ihr Sohn. Dennoch, sie ist aufgestanden, um näher bei seiner Hand zu sein, die sie sachte ergreift, und sagt, sehr leise und kaum hörbar: „Bleib.“ Arthur entzieht ihr seine Hand, behutsam aber entschieden. Entschlossenheit liegt in seinen Augen, aber auch ein Hauch von Wehmut. Er hat sich entschieden. Standfest muss er jetzt bleiben. Noch ahnt er nicht, dass er ein Leben lang nicht vergessen wird, wie er seiner Mutter in diesem Augenblick, Weh im Herzen, seine Hand entzog. Und die Ohnmacht in Mutters zusammensinkender Gestalt, ihre traurigen Augen. Er wird die Hand der Mutter vor Augen haben, wie sie wehrlos an ihrem dunklen, langen Rock niedersinkt. Und sich als elender Egoist fühlen.
Eine Woche später marschiert Arthur zusammen mit seinen Klassenkameraden unter Heil- und Freudenrufen der Bevölkerung durch die Stadt, eine kleine Militärkapelle begleitet sie und spielt: „ Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus …“ Frauen mit Blumensträußen begleiten sie und winken. Kinder laufen lebensfroh trällernd und Fähnchen schwingend nebenher. Paul drückt seinem großen Bruder ein letztes Mal die Hand. „Wenn ich gut sehen könnte und alt genug wäre, würde ich es auch als meine nationale Pflicht ansehen, für unser Vaterland zu kämpfen.“ Ernst und gefasst schaut er seinen großen Bruder durch seine kleine runde Nickelbrille an. Arthur bemerkt heut zum ersten Mal, dass Pauls Augen unterschiedlich groß sind. Das linke mit dem Kunstauge ist kleiner. Mitleid greift ihm ans Herz. Die Lippen seines kleinen Bruders zittern kaum sichtbar. „Mein Kleiner, red’ nicht so geschwollen. Pass du auf Mutter auf, das ist jetzt genauso wichtig“, sagt er und bemüht sich, stark zu wirken und nicht loszuheulen. Die Worte seines kleinen Bruders haben ihn mehr berührt, als er zugeben kann und Paul wissen soll. Die kleine Ilse kann gar nichts sagen. Sie umfasst Arthurs Hand mit ihren beiden kleinen Mädchenhänden und schmiegt ihr Gesicht in seine raue Jacke mit dem herbfremden Geruch des Uniformstoffes. Er streicht ihr über ihre blonden Rieselhaare. „Nicht flennen“, sagt Arthur leise zu Ilse. Und im Stillen energisch zu sich selbst.
Als der Zug abgefahren ist, sind Hermine, Gustav, Paul und Ilse sehr still geworden. Innerlich aufgewühlt halten sie sich an den Händen und trotten heimwärts.
Hermine fragt: „Wie kann eine solche Kriegsbegeisterung plötzlich, wie aus dem Nichts über ein ganzes Land kommen wie eine Seuche?“ Gustav, der in den zurückliegenden Tagen mit mehreren Geschäftsfreunden diese Frage erörtert hat, sagt: „So plötzlich kam das nicht. Spannungen gibt es seit längerem. Sie kommen aus Expansionsbestrebungen und unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Staaten.“
„Was heißt das konkret? Klingt mir zu abstrakt.“
Gustav erläutert: „Zwischen Deutschland und Frankreich schwelt ein alter Streit um Elsass-Lothringen. Beide erheben Besitzansprüche. Zwischen Deutschland und Großbritannien gibt es eine Rivalität um den Flottenausbau. Die Briten wollen die Nummer Eins auf den Meeren bleiben. Die Briten und Franzosen wetteifern trotz ihrer Entente cordiale, die sie äußerlich scheinbar versöhnt hat, um Ansprüche in den Kolonien.“ Hermine stellt das nicht zufrieden. „Wir leben doch aber nicht im Wilden Westen. Wofür gibt es Diplomaten, wenn alle plötzlich Lust haben, aufeinander einzuschlagen?“, sie hat sich ereifert und bekommt nur schwer Luft. Der Abschied von Arthur hat sie viel Nervenkraft gekostet: „Wir Deutschen sind überzeugt, anderen Nationen überlegen zu sein“, erläutert Gustav, „andererseits glauben wir, Objekt einer Einkreisungspolitik unserer Nachbarn zu sein, die Deutschland seine führende Rolle in der Weltpolitik verwehren will. Nationalprestige und Machtwille sind bei uns stark ausgeprägt. Wir wollen uns von den anderen nicht so ohne weiteres entthronen lassen.“
Hermine lässt nicht locker: „Also, ich hab bisher so viel verstanden: Die europäischen Staaten haben Spannungen untereinander. Es geht um Zugewinn an Land und Macht. Richtig?“ Gustav nickt. „Diplomatisch scheint nichts mehr zu gehen. Die Todesschüsse haben den ersten Domino-Stein zum Kippen gebracht. Erster Domino-Stein, das waren die Sarajewo-Schüsse auf das Kronprinzenpaar, der zweite das deutsche Ultimatum an Russland, mit der Mobilmachung aufzuhören, dem Russland nicht gefolgt ist. Deutschland erklärt den Russen den Krieg. Deutschland fordert Frankreich auf, neutral zu bleiben. Frankreich lehnt ab. Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. Die Bündnisverpflichtungen treten in Kraft und weitere Domino-Steine kippen.“ Hermine holt Luft. „Sind denn unsere Berliner Politiker, voran unser Kaiser Wilhelm, alle tollkühn geworden? Das kleine Deutschland gegen Frankreich und Russland gleichzeitig? Ein Zwei-Fronten-Krieg. Wie soll das gutgehen?“
In den nächsten Tagen ist in den Gazetten zu lesen, in Berlin sei eine große Ernüchterung eingetreten. Der Kaiser war sich offenbar über die zahlreichen Bündnisse nicht im Klaren. Er hat die vielfältigen Neutralitäts- und Waffenhilfe-Abkommen unterschätzt.
Gustav sieht nach der Zeitunglektüre ratlos aus. Das Blatt ist ihm unmerklich über die Knie auf den Boden gerutscht. Seine Brille hat er auf den Tisch gelegt. Er streicht sich mit der Hand durch sein Haar.
„Das kann ja heiter werden“, findet Hermine, zieht ihren Stuhl mit beiden Händen näher an den Tisch und legt, vornübergebeugt, ihre Ellenbogen kämpferisch auf die hölzerne Tischplatte: „Berufspolitiker, die einen Krieg anfangen, aber das Ganze nicht überschaut haben!“ Sie haut mit beiden Fäusten auf den Tisch, schüttelt verständnislos ihren Kopf. „Aber wir sollen unsere Söhne hergeben“, ihre Stimme wird lauter und schriller, „damit sie an der Front ausbaden, was die da oben mit ihrer vermeintlichen politischen Weitsicht und Erfahrung nicht überblickt haben. Haben wir dafür unseren Arthur groß gezogen?“ Sie schaut Gustav wild und böse an, als habe er sich den Krieg ausgedacht. „Gebe Gott, dass ihm nichts zustößt.“
Hermine sieht aus wie eine Furie. Ihre Haare sind in Unordnung geraten. Sie ist wiederholt mit den Händen hastig durch ihre Frisur gefahren. Ihr Körper bebt vor Zorn und Anspannung.
„Ich versteh dich ja“, sagt Gustav und will Hermine beruhigen, „denk an das, was Arthur beim Abschied gesagt hat und all die glauben, die nun jubeln und aus dem Häuschen sind: ‚In acht Wochen sind wir zurück, und ihr werdet stolz auf uns sein!‘“
Hermine schaut aus dem Küchenfenster und hat wieder ihren in die Ferne weisenden Blick, als sähe sie Dinge, die andere nicht sehen: „Hoffentlich behält er Recht zusammen mit all den anderen, die es ebenso sehen. Hoffentlich.“ Ilse sieht ihre Mutter ängstlich an, Paul blickt ratlos zu ihr auf, als könne sie ihnen die aufkeimende Angst nehmen. Gustav grübelt: ‚Meine eigene uneingestandene Euphorie‘, stellt er fest, ‚hielt so lange, wie wir unter den vielen Begeisterten am Bahnhof waren. Hier, allein mit den Meinen, hat klares Denken wieder eingesetzt. Mir schwant nichts Gutes. Und Hermine hat ihren ahnungsvollen Ausdruck in den Augen, als erblickte sie bereits kommendes Unglück.‘ Ihn fröstelt, obgleich draußen eine milde Augustsonne die Landschaft in ein warmes, goldenes Licht taucht. Am 04.08.1914 erklärt Kaiser Wilhelm vor dem Reichstag in Berlin: „… uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den uns Gott gestellt hat … Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche …“
Da schon kurz nach Kriegsausbruch Lebensmittel nur noch auf Marken zu haben sind, gräbt Gustav den größten Teil des Gartens um. Nur die Bleiche, für die Wäsche benötigt, bleibt stehen und ein Stück Wiese für Ilse, Paul und Ronja. Zwei der alten Apfelbäume haben im ersten Jahr gut getragen und sie den Winter über mit frischem Obst versorgt. Er pflanzt drei Sträucher rote, zwei für schwarze Johannisbeeren, zwei Reihen Himbeeren am Zaun entlang und eine lange Reihe Brombeeren. Das umgegrabene Land dient für Kartoffeln, Gemüse und Erdbeeren. Gustav und Hermine wollen sich so weit wie möglich selbst versorgen können.
Nach und nach erweisen sich die Rationen auf Marken als völlig unzureichend, besonders für die körperlich schwer arbeitenden Menschen. Das geringe Warenangebot, bedingt durch die britische Seeblockade, die den Außenhandel erheblich beschränkt und die Einfuhr dringend benötigter Lebens- und Futtermittel anfangs erschwert, später unmöglich macht, führt schnell zu Preisanstiegen. „Der Garten ist ein großer Segen für uns“, stellt Gustav fest. Die selbst erzeugten Kartoffeln reichen zwar nicht für den ganzen Winter, aber der findige Gustav hat eine andere Möglichkeit erschlossen.
Bestimmte Baustoffe zu bekommen, wird immer schwieriger. Da die Italiener 1915 die Fronten wechseln und den Deutschen den Krieg erklären, fällt Marmor aus Italien, insbesondere der edle Carrara-Marmor, weg. Züge und Lastwagen werden immer stärker für die Kriegswirtschaft genutzt, pünktliche Warenlieferungen mehr und mehr erschwerend. Längerfristige Zahlungstermine sind wegen der steigenden Preise nicht mehr zu vertreten. Zugeständnisse an Kunden, in Raten zu zahlen, würden seinen wirtschaftlichen Ruin bedeuten. Gustav versucht, erst nach Zahlung zu liefern, auch wenn ihm diese Konsequenz innerlich widerstrebt. Das auf seinem Konto eingehende Geld wird seinerseits noch am selben Tag zur Abzahlung seines Kredits in der Sparkasse verbucht. Er behält nur bar, was die Familie für die laufenden Ausgaben sofort benötigt. Bei Lieferungen an seinen Betrieb wird der Preis aufgrund des Tages-Dollar-Kurses vor 12 Uhr mittags ermittelt und ebenfalls sofort überwiesen, da der Dollar-Kurs fast täglich steigt. Gustav ermöglicht Kunden inoffiziell, einen Teil der Ware in Naturalien zu bezahlen, wenn das dem Kunden möglich und lieber ist. Einen Sack Kartoffeln oder ein paar Eier, ein Kaninchen oder ein Huhn als anteilige Bezahlung. Das ist verboten und wird nach und nach schwieriger, da die staatlichen Lebensmittel-Kontrolleure die Bestände an Vieh und die Ernteerträge ebenso kontrollieren wie die rationierten Lebensmittelvorräte in den Geschäften.
Kunden werden durch die Lebensmittelkarten an ihre Geschäfte gebunden und können so leichter überprüft werden. Da die Mengen, die abgegeben werden dürfen, immer kleiner werden und dadurch immer häufiger eingekauft werden muss, beansprucht das viel Zeit. Das erledigt weitestgehend Paul.
Er entlastet seine Eltern, soweit ihm das neben der Schule möglich ist. Er hilft dem Vater im Lager, Garten und Büro und schleppt auch die Wassermengen, die sonst Arthur getragen hätte. Er versucht Arthurs fehlende Arbeitsleistung voll auszugleichen. Er sieht diese zusätzliche Arbeit als einen Teil seiner Pflicht als Patriot. Arthur an der Kriegsfront, er an der Heimatfront. Oft ist er so müde und erschöpft, dass er fürchtet, im Unterricht einzuschlafen, redet aber mit niemandem darüber. Stark und belastbar, pflichtbewusst und zuverlässig will er sein, seinen Eltern Ehre machen und sich vor seinem Bruder nicht schämen müssen.
Die jungen und älteren Soldaten sind nicht nach acht Wochen als stolze und glückliche Sieger aus dem Krieg heimgekehrt. Im Gegenteil, der Krieg zeigt von Monat zu Monat beängstigendere Züge. Es braucht Mut und Kraft, Zeitung zu lesen.
1916 schreibt Arthur seinem Bruder einen Brief, den er unbedingt für sich behalten soll.
Die deutschen Soldaten hatten den Auftrag, Verdun anzugreifen. Es gelang nicht, Verdun im Sturm zu erobern. „… Mein Kleiner, diese Stadt, dieser Name werden in die Geschichte eingehen. Kein Mensch, der in seinem Dorf, in seiner Stadt im Frieden lebt, kann sich vorstellen, was hier los ist. Wir leben im Dreck wie die Ratten. Am Tag ist hier die Hölle. Geschütze krachen, Maschinengewehre knattern. Kugeln sirren um die Köpfe. Granaten knallen explodierend in den Boden. Menschenleiber fliegen durch hoch aufspritzenden Dreck. Teile von Menschen prasseln auf die Erde zurück. Was einst Felder, Wiesen, Äcker mit Bäumen, Sträuchern waren, ist umgepflügte, zerwühlte Mondlandschaft mit Kratern, Stacheldraht, Toten. Es stinkt nach Fäkalien, nach Blut, nach dem Inhalt zerplatzter Därme, einem blutenden Schädel, der neben dir aufschlägt, ohne Körper, nach Sprengstoffen und Pulverdampf. Kameraden schreien vor Schmerzen, getroffen von einer Granate oder Kugel, ein Arm abgerissen, nur noch mit Hautfetzen an blutigem Jackenärmel herunterhängend. Sie schreien nach ihrer Mutter, während sie im Dreck sterben und die Hosen vollgeschissen haben in entsetzlicher Todesangst. Paul, wenn ich an euch denke, erscheint es mir, als seien eine normale Zeit, ein normales Leben nur ein wundervoller Traum gewesen, als könne es für mich, für uns, niemals mehr Wirklichkeit sein. Wir leben hier ein Schweineleben, was sage ich, jedes Schwein in einem verdreckten Stall lebt humaner als wir. Wir schlafen in Bunkern unter der Erde. Auch hier stinkt es nach Urin, Blut, Fäkalien. Je nach Wetter waten wir in den Schützengräben durch Morast oder schlammiges, blutiges Wasser. Das schlimmste ist der Höllenlärm, die nicht endende Belastung der Nerven. Du findest keine Ruhe, keine Sekunde Erholung. Es geht immer so weiter, auch wenn du ganz und gar am Ende bist und nur noch wünschst, eine Granate möge dich treffen, damit dieses Hundeleben endlich aufhört. Wir beglückwünschen Verletzte, auch wenn sie Arme und Beine oder ihr Augenlicht verloren haben, weil sie hier rauskönnen, raus in ein Lazarett. Ich weiß, das klingt bestialisch und brutal. Unser Leben hier ist bestialisch und brutal! Wir sind hier keine Menschen mehr. Wir sind Material. Menschenmaterial, das verheizt wird.
Sag den Eltern, dass es mir gut geht. Nichts wird besser, wenn sie vor Kummer krank werden oder sterben. Dir sag ich: bete für mich und kämpfe brav an der Heimatfront. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Dein Bruder Arthur.“
Nach dem Krieg wird in den Zeitungen zu lesen sein, dass vor Verdun 335.000 deutsche Soldaten und 360.000 französische Soldaten gestorben sind. Mit vielen weißen Holzkreuzen auf riesigen Helden-Friedhöfen wird man ihrer nach dem Krieg an den Helden-Gedenktagen mit pathetischen Reden gedenken. An den Denkmälern werden teure, schöne Kränze niedergelegt werden.
Paul bewahrte den Brief auf dem Boden seiner Büchertasche, damit er nicht doch eines Tages seiner Mutter in die Hände fallen könnte. Vor diesem Brief hatte er keine Vorstellung vom Kriegsgeschehen. Ab und zu waren Zeitungsausschnitte in einem Kasten zu sehen, in dem Verschiedenes öffentlich bekannt gemacht wurde, überwiegend Fotos von Siegen, von lachenden Soldaten, von den tapferen deutschen Helden. Paul hatten diese Bilder stolz gemacht. Er dachte, auch mein Bruder ist einer von diesen lachenden, siegenden, tapferen Helden.
Der Brief hat ihn im tiefsten Inneren aufgewühlt. Nur seinem Freund Johannes hat er davon erzählt, ihn aber auch vergattert, beiden Elternpaaren gegenüber nicht darüber zu reden. „Das bleibt unter uns. Nichts wird besser, wenn wir unsere Eltern damit belasten“, hatte Paul gesagt.
Sie bekamen durch ihr tägliches Leben mit, dass es schlecht stand um Deutschland, zu wenig Nahrung, zu wenig Heizmaterial. Gustav hatte Mühe, seine Kunden zu beliefern. Die Kunden waren in der Klemme, das Geld für die weiter und weiter steigenden Preise aufzutreiben. Gustav blieb eisern, wenn es um pünktliche Bezahlung der von ihm gelieferten Ware ging und bezahlte seinerseits pünktlich. Am nächsten Tag wäre der Preis meist höher.
Hermine kochte ein, was sich einkochen ließ. Möhren wurden in einem großen Tonkrug in Sand gelegt, wo sie sich lange hielten, Weißkohl geraffelt und in einem noch größeren Tongefäß mit Salz und Gewürzen zu Sauerkraut geschichtet. Eier vom Kunden, statt Bargeld erhalten, legte sie in einem weiteren Tongefäß in Wasserglas, wo sie monatelang frisch blieben. Kartoffeln lagerten auf einem mit Säcken verdunkelten Holzgestell. Die Regale waren gefüllt mit eingeweckten Früchten, die meisten ohne Zucker, der Mangelware war. Hin und wieder erhielt Gustav Zucker als Bezahlung von einem Kunden, der Beziehungen zu einem Zuckerlieferanten hatte. Es wurde getauscht, versteckt, schwarz gehandelt. Wer keine Beziehungen oder Waren zum Tauschen hatte, hungerte.
Paul, der auf einem Heimweg von der Schule mit Johannes darüber sprach, sagte: „Traurig, dass Moral und Anstand auf der Strecke bleiben, wenn es ums Essen und Trinken geht. Wer seinen Vorteil sucht, betrügt ja eigentlich die anderen, die solche Vorteile nicht haben. Wenn die vorhandenen Lebensmittel gerecht auf alle verteilt werden müssen, sind eigentlich die, die mogeln, unsozial.“ Johannes überlegt eine Weile, dann sagt er: „Diese edlen Prinzipien sind wohl außer Kraft, wenn du als Vater eine Familie ernähren musst. Du hast dann die Wahl, entweder deine Kinder erkranken oder verhungern oder du lässt ‚Fünfe gerade sein‘, wie meine Mutter sagen würde, um zusammen mit deinen Kindern zu überleben.“ Johannes schätzte diese Geradlinigkeit seines Freundes, spürte aber auch, wie oft er damit gegenüber der unbarmherzigen Kriegswirklichkeit in Gewissensnot geriet.
In der Nacht des 23. August 1918 erleidet Hermine einen Erstickungsanfall. Gustav ruft den Arzt. Hermine erhält eine Spritze und ein Atem-Spray. Am Morgen erzählt sie Gustav, sie habe im Schlaf Arthur erbärmlich um Hilfe schreien gehört und sei von diesen Hilfeschreien aufgewacht.
In der gleichen Nacht, kurz vor Ende des Krieges während der großen Westoffensive, wird Arthur durch einen Artillerie-Einschlag verschüttet. Er schreit nach seiner Mutter, wieder und wieder, und wird von seinen Kameraden ausgegraben. Wegen eines Lungenrisses kann er kaum noch atmen. Sanitäter bringen ihn ins Lazarett nach G., eine ehemalige Schule. Er ist hochgradig traumatisiert, zittert ständig am ganzen Körper und hat grauenvolle Angstzustände. Eine erneute Kriegsverwendung kommt nicht in Betracht. Für Arthur ist der Krieg zu Ende.
Hermine bricht bei der Nachricht über die Verletzungen ihres Sohnes zusammen. Sie ist tagelang nicht ansprechbar. Bei Eintreffen der Nachricht liegt Arthurs Kriegsverletzung bereits eine Woche zurück. Sie und Gustav erkennen bestürzt, dass Hermines Asthma-Anfall und Arthurs Kriegsverletzung in der gleichen Nacht geschahen.
Sie sind vom Lazarett gebeten worden, Arthur vorläufig nicht zu besuchen, er brauche absolute Ruhe.
Im November 1918 dankt der Kaiser ab und geht ins Exil. Der Krieg ist zu Ende.
„Hör dir das an“, sagt Gustav zu Hermine, hält die Zeitung in der Hand und beginnt vorzulesen:
„Der Krieg hat 1.300 Milliarden Goldmark gekostet.
8,5 Millionen Soldaten verloren ihr Leben auf den Schlachtfeldern.
7,7 Millionen Soldaten werden vermisst.
Ganze Landstriche sind verwüstet.
Die meisten europäischen Volkswirtschaften sind ruiniert.“
Gustav lässt die Zeitung sinken. „Man möchte vor Zorn und Wut schreien“, zischt er durch die Zähne, springt auf, läuft zum Fenster und stiert ins Leere. Seine zitternden Hände hat er in beiden Hosentaschen vergraben.
Tiefhängende graue Wolken ziehen in Schwaden eilend über das Land. Der Regen trieft in schräg verlaufenden Bindfäden über die Fensterscheibe. An der Wäscheleine zwischen den beiden Klopfstangen hängen Regentropfen wie an einer Perlenschnur. Ronja hat sich in die Hundehütte verkrochen. Nur die Spitzen ihrer Vorderpfoten lugen aus der dunklen Höhle.
„Die heimkehrenden deutschen Soldaten wurden nicht als Helden mit Blumenkränzen geschmückt“, sagt Hermine leise hinter seinem Rücken, hält sich beide Hände vor das Gesicht und weint. Sie weint endlos, als könne sie niemals mehr damit aufhören. Als sie die Hände vom Gesicht nimmt, ist ihr Antlitz gerötet und nass. Jeder Hauch von Hoffnung und Lebensfreude ist aus ihrer Miene gewichen.
Die Heimkehrer waren unwillkommen. Ihre übermenschlichen Leistungen in schlammigen, dreckigen Erdlöchern, ihre Verletzungen, ihre Invalidität und der Tod der Vielen wurden nicht honoriert. Die Daheimgebliebenen waren mit Überleben beschäftigt.
Wohin mit den kranken, kriegsverletzten oder auch gesund gebliebenen Kriegsheimkehrern? Deren Not und Ungewissheit erforderten eine Lösung. Das Problem ließ sich auf Dauer nicht verdrängen.
Deutschland war kein Kaiserreich mehr. Die Republik sah sich vor der Mammut-Aufgabe, die Scherben aufzukehren und etwas Neues aufzubauen.
Die Bedingungen des Versailler Vertrages waren so hart und einengend, dass die Zeit nach dem Krieg zu wenig Hoffnung Anlass bot.
Gustavs Betrieb hatte überlebt. Sein Warenangebot hatte er erheblich verkleinern müssen, da er von den Bezugsquellen abgeschnitten war.
Durch den im Versailler Vertrag neu entstandenen Polnischen Korridor, der Ostpreußen von Westpreußen und dem übrigen Deutschland abschnitt, ergaben sich weitere Schwierigkeiten. Ostpreußen war nun rundherum von Polen umgeben. Ware aus dem westlichen Deutschland musste auf dem Landweg zweimal die polnische Grenze passieren. Das Gleiche galt, wenn er Ware aus Ostpreußen nach Deutschland liefern wollte. Kleinere und größere Grenzschikanen, Verzögerungen, unausgesprochene Schmiergeldwünsche verzögerten und verteuerten Lieferungen. Die britische Seeblockade war nach dem Krieg weiterhin in Kraft.
Das Problem der ins Irreale gestiegenen und steigenden Preise bestand nach wie vor. Die Errechnung eines Preises fand täglich aufgrund des veränderten Dollarkurses statt. Lebensmittel kaufte Hermine vor 12 Uhr. Nach 12 Uhr konnten die Preise schon wieder gestiegen sein.
Im Sommer 1919 wurde Arthur als geheilt aus dem Lazarett in G. entlassen. Er hatte nach wie vor erhebliche Beschwerden beim Atmen. Sie blieben bis an das Ende seiner Tage, nur wenig abgemildert, bestehen. Das Zittern und die Angstzustände wurden mit Medikamenten behandelt. Die Medikamente dämpften seine noch fünf Jahre zuvor große Arbeitsfreude. Er war müde, schlapp und kraftlos. Innerhalb der nächsten drei Jahre kehrte ein Teil seiner früheren Energie zurück. Der Vater ermöglichte ihm, sofort nach seiner Rückkehr wieder im Betrieb mitzuarbeiten, soweit er wollte und konnte. ‚Arbeit ist vielleicht die beste Medizin‘, hoffte Gustav. Anfangs reichte die Kraft nur für kurze Zeiträume im Büro, später auch wieder für leichtere Verrichtungen am Lager. Er erholte sich niemals mehr ganz, wurde nie mehr der alte.
Sein Klassenkamerad Siegfried, der Patriot, starb im August 1918 bei der Westoffensive in Frankreich. Sein Großvater fiel bei dieser Nachricht in tiefe Schwermut und war nicht mehr arbeitsfähig. Er fühlte sich schuldig am Tode seines Enkels. „Ich habe ihn ja erst richtig heiß gemacht“, sagte er. Seine Gedanken kreisten nur noch um Siegfrieds Tod und seine, des Großvaters, Schuld.
Wolfgang, Arthurs Freund und Klassenkamerad, hatte den Krieg überlebt, war aber zum Leidwesen seiner Eltern völlig verschlossen zurückgekehrt. Seine frühere heitere Lebensfreude war dahin.
Arthur hatte erlebt, wie die Schreckensbilder des Krieges einen Menschen veränderten. War er mit Wolfgang zusammen, sprachen sie von nichts anderem. Sie waren froh, ihre Freundschaft und einander zu haben. Beide erlebten, dass sie nur verstehen konnte, wer in der Hölle dabei war. Sie verübelten den anderen nicht, wenn sie nur staunend zuhörten, aber das Gesagte nicht einmal ansatzweise nachvollziehen konnten. Was geschehen war, konnte sich auch die lebhafteste Phantasie nicht ausmalen. Sie brauchten einander, um immer und immer wieder darüber zu reden. Es war eine Möglichkeit, einer Heilung näher zu kommen und einer Rückkehr in ein normales Leben. Aber was war im Nachkriegs-Deutschland ein normales Leben? Für sich fanden sie die Antwort: Zunächst nicht verrückt zu werden von der Wucht der unmenschlichen Bilder in ihrer Seele. Überleben als kurzfristiges Lebensziel, die nächsten Stunden, den nächsten Tag überleben ohne zu schreien, zu toben, irgendwas kaputtzuschlagen, auszurasten. Sie lebten ganz nahe an all diesen Möglichkeiten.
Sie sprachen oft darüber, wie Siegfried von seinem Großvater erzählt hatte, dessen Kriegserlebnisse von 70/71 das wichtigste, größte Ereignis seines Lebens und des Lebens seiner Kriegskameraden gewesen war. Wer diesen Veteranen zuhörte, konnte meinen, sie hätten jahrelang einen wunderbaren Krieg heldenhaft durchlebt und am Ende ohne Verluste zum verdienten und unumstrittenen Sieg geführt. Von diesen im Verlaufe der Jahre immer phantastischer blühenden Erinnerungen mit ihren großartigen Heldentaten hatten sie gezehrt, sie, die Kämpfer aus einem Achtwochenkrieg. Ihre immer währende Kriegsbegeisterung war ein kleines, kaum sichtbares Körnchen Dünger auf dem Kriegs-Euphorie-Bazillus, sein Wachstum befördernd, der 25 Jahre später ihre Söhne, Enkel und einen ganzen Kontinent befallen sollte.
„Es darf nie wieder Krieg geben“, sagten die, die verstanden und ihre Lehren gezogen hatten. Gustav, Hermine und ihre Kinder gehörten zu ihnen.