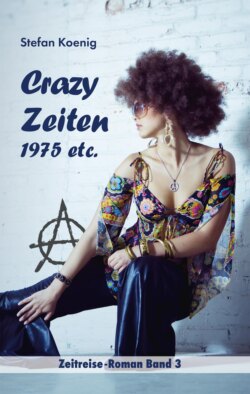Читать книгу Crazy Zeiten - 1975 etc. - Stefan Koenig - Страница 5
1974 - Zurück nach Berlin & Geld regiert die Welt
ОглавлениеIch war erschöpft. Das plötzliche Verschwinden von Svea hatte mich geschafft. Normalerweise säße sie jetzt hier, um mit uns nach Berlin zu fliegen. Dort wartete eine Suchttherapie auf sie. Wir, ihre vier Freunde, hatten alles mühsam vorbereitet. Aber dann war sie in letzter Minute ausgebüxt. Und nun hatte sich auch noch unsere Abflugzeit verschoben. Pünktlich um 12:45 Uhr sollte unsere Maschine nach Berlin abfliegen. Morgen könnten wir meinen 24. Geburtstag im Berliner »Zwiebelfisch« feiern. Das war der Plan.
Wie jetzt die Anzeigetafel und die Ansage in der Halle des Flughafens von Marrakesch verkündeten, würde Lufthansa-Flug 3342 erst in den späten Abendstunden fliegen. Uhrzeit ungewiss. Abflug nach Ansage. Wir waren schon eingecheckt und konnten nicht zurück in die Stadt, um uns dort die Zeit zu vertreiben oder um Stella und ihren beiden Liebhabern bei der Suche nach Svea behilflich zu sein. Unsere ganze Hoffnung lag bei Stella, der blonden Schwedin, und bei den beiden Dänen Jan-Stellan und Leif. Vielleicht würden sie Svea finden und in den nächsten Flieger setzen. Es ging um Leben oder Tod. Svea spritzte sich Heroin. Ich hatte sie dabei ertappt.
Jetzt saßen wir hier bei brütender Hitze fest.
Heute vor einem Jahr, am 11. September 1973, hatte die CIA mithilfe von vierzehn chilenischen Generälen den Präsidenten und die Demokratie dieses Landes ermordet. Ich hatte hierzu noch einen Rückblick für »die tat«, eine Zeitschrift der Verfolgten des Naziregimes, zu schreiben. Daran musste ich jetzt denken. Ich würde das in Berlin ruckzuck erledigen. Erstmal nachhause kommen.
Meine Liebste hatte bei Reisen immer ein Kartenspiel bei sich. „Doro“, sagte ich, „lass uns Doppelkopf spielen.“ Ich schaute zu Quiny und Wolle, und beide nickten zustimmend.
So saßen wir vier Freunde stundenlang auf dem Boden auf einem schattigen Plätzchen, neben uns immer ein Glas marokkanischen Tees. Eigentlich hasse ich Doppelkopf, Schafkopf und Skat, doch in der größten Not, wenn kein Buch zur Verfügung steht, lasse ich mich auch darauf ein.
Im Schatten des Betongebäudes ließ es sich aushalten. Aber in der Nähe der benachbarten Fenster, wo die Sitzreihen für die Fluggäste standen, brannten sich die einfallenden Sonnenstrahlen durch die Haut und versuchten Grillfleisch aus den Wartenden zu machen. Mein Körper schrie nach eisgekühltem Cola oder Wasser.
„Die Marokkaner trinken alle warmen Tee und selten kalte Cola bei dieser Affenhitze“, sagte Doro. „Das wird schon seinen Grund haben.“
Es war ein äußerst quälender Nachmittag. Dem folgte ein äußerst quälender Abend. Wolle kam am späten Abend als Erster auf die Idee, jetzt endlich ein kühles Bier zu bestellen. Quiny und Doro stimmten freudig zu, und selbst ich, der ich in jenen Jahren dem Bier noch nichts abgewinnen konnte, lechzte förmlich nach einem kühlen Blonden. Vielleicht lag das, was jetzt kam, genau daran.
Um 21:15 Uhr ertönte endlich die erlösende Durchsage. Unser Flug würde um 0:10 Uhr starten. Die Wartezeit war nun absehbar. Wir könnten beim Abflug mit einer Dose Bordbier auf meinen Geburtstag anstoßen, meinte Doro.
Eine viertel Stunde vor Mitternacht machte ich es mir auf Fensterplatz Nr. 7A von Lufthansa-Flug 3342, Marrakesch – Berlin, bequem. In der Dreier-Reihe neben mir saßen Doro und Quiny, und genau im Gang vor mir saß Wolle.
Ich gähnte. Ein leichter Anflug von Kopfschmerz kletterte, bewaffnet mit Steigeisen und Pickel, meinen Nacken empor. Ich hatte so gut wie nie Kopfschmerzen. Ich erinnerte mich an diesen ziehenden Schmerz nur in Verbindung mit frühen Kindheitszeiten, als ich nach der Schule gelegentlich mit den Hausaufgaben nicht zurechtkam. Migräne kannte ich bis dahin nicht einmal vom Hörensagen.
Genau jetzt, als die nervliche Anstrengung nachließ, kam etwas angekrochen, was mir unbekannt war. Ich befürchtete, wenn ich nicht bald einschliefe, sauste es wie ein Schmiedehammer auf mich herab. Ich erinnerte mich an Quinys Worte von vorhin, als unser Gepäck zur Verladung kam. „Wenn ich heute bei dieser Hitze und der Anstrengung keine Migräne bekomme, wäre das ein Wunder.“
„Rede es nicht herbei“, hatte Wolle geraten.
Aber Quiny hatte entrüstet geantwortet: „Das hat nichts mit herbeireden zu tun. Es kommt bei nervlicher und körperlicher Anspannung manchmal über mich wie ein Schmiedehammer! Da kann ich nichts dagegen tun!“
Jetzt also traf vielleicht mich der Schmiedehammer. „Wahrscheinlich mache ich heute Bekanntschaft mit Madame Migraine“, sagte ich halblaut und betonte das französische „Migraine“, wie es mein Vater betont hätte, womit er gelegentlich an unsere hugenottische Abstammung erinnerte.
Meine Augen fielen zu.
In zwanzig Minuten würde die Boeing 757-300 abheben. Ich wollte mich entspannen. Wolle beugte sich jetzt über die Sessellehne nach hinten, um mich nach meinem Wohlbefinden zu fragen.
„Kara?“
Nett, dass du mich bei meinem alten Spitznamen nennst. Aber: Verdammte Kacke, lass mich in Frieden! Nicht mehr reden, bitte!
„Ach, du schlummerst schon ein wenig?“
„Hm, hm.“ Bleib bloß still! Kein weiteres Wort!
„Möchtest du mein Kissen?“ fragte er mit kuscheligen Worten.
Ich schüttelte den Kopf. „Mhm, mhm.“ Lass mich einfach in Ruhe, du musst doch sehen, dass ich an der Grenze bin, dachte ich und stöhnte noch einmal. „Mhm, mhm.“
„Wenn es dir nicht gut geht, sag es mir, ich besorge eine Migräne-Tablette bei der Stewardess.“
Wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, rede ich morgen kein Wort mehr mit dir. Mein Kopf begann heftig zu brummen.
»Na, dann gute Nacht, erhol dich vom Stress der vergangenen Tage. Und von der Enttäuschung in Sachen Svea. Ab jetzt beginnt eine neue Ära.“ Halt verdammt nochmal den Mund, altes Quatschmaul!, schwirrte es durch das Stockfinster meines Kopfes.
Plötzlich sah ich Svea, wie sie sich das Heroin direkt in die Vene der Armbeuge spritzte. Ich kam ins Schwitzen. Als ich sie 1970, vor etwas mehr als vier Jahren, kennen gelernt hatte, war sie gerade siebzehn Jahre alt und erwies sich als eine der vitalsten Menschen, denen ich je begegnet war. Sie nahm Anteil an allem, was in der Welt vorging. Ihre Sinne waren wach und schienen stets auf Hochtouren zu laufen. Aber jetzt, nach all den persönlichen Niederlagen und der schleichenden Drogenabhängigkeit, hinterfragte sie nichts mehr.
Aus dem unbeschwerten, weltoffenen Hippiemädchen war eine sich nur mit sich selbst beschäftigende Drogenabhängige geworden. Keine glänzende Karriere in diesen jungen Jahren. Mir schien, sie beobachtete nur noch ihr eigenes Inneres, saugte kein neues Wissen in sich auf, wog nicht mehr ab und hatte kein Interesse mehr, sich ausgewogene Urteile über dies und das zu erlauben. Ihre Welt war sehr einfach geworden. Sie war verflacht.
„Du bist so schön und klug …“, hatte mein erstes Kompliment an sie gelautet. Aber von der Klugheit war viel verweht, vielleicht auch nur verschüttet, und ich musste ihr beim Wiederfinden behilflich sein.
Mir schoss unsere damalige Diskussion im Alamo durch den Kopf. Wir hatten uns über ihre hoffnungsvolle Lebensperspektive unterhalten:
„Ich meine, es wäre schade, wenn du dein Leben nur als Bardame oder Bedienung verbringst.“
„Diese Berufe sind auch nötig. Ohne die könnten wir hier nicht gemütlich sitzen und plauschen“, hatte sie mein Argument zurechtgestutzt. Dann war sie nachdenklich geworden. „Kara, wenn ich wirklich so schlau wäre, wie du vermutest, glaubst du, ich hätte dann mit sechzehn meine Schulausbildung abgebrochen? Ich hätte weitergemacht, um Tierärztin zu werden oder Theologin.“
Und nun, vier Jahre danach, das Drama: Heroin.
Vor mir hörte ich jetzt ein Räuspern.
Wird doch nicht schwer sein, einmal die Klappe zu halten! Sei anständig und lass mich schlafen, guter Freund!, dachte ich; dann nickte ich wieder ein. Doch der Moment währte kurz.
„Nimm ruhig meine Decke“, sagte Wolle und warf den Stoff auf meinen Schoß. „Mir ist warm genug, ich brauche sie nicht.“
War es draußen im Flughafengebäude selbst am Abend noch unerträglich heiß gewesen, so war der Kälteschock hier im Flieger das andere Extrem.
„Ich brauche die Decke wirklich nicht!“, hörte ich unseren guten Freund Wolle sagen.
Ich auch nicht, altes Arschloch. Merkst Du nicht, dass ich schlafen will? In Gedanken ging ich noch einmal die Versprechen dieses unhöflichen Freundes durch. Wenn sie ebenso löchrig waren wie seine Höflichkeit, dann Gnade ihm Gott. Er hatte mir etwas zugesagt. Schon in wenigen Wochen würde er mit mir nach Marrakesch zurückkehren und Svea suchen gehen, um sie aus den Händen der marokkanischen Zuhälter zu befreien.
Ich schlug die Augen kurz auf, und da sah ich sie.
Svea – in ihrer prachtvollen Schönheit – betrat das Flugzeug in Begleitung eines dunkelhäutigen Arabers. Nein, das kann nicht sein!, wollte ich schreien, aber ich stammelte nur: „Nicht doch, nicht doch.“
„Schon gut, du brauchst die Decke nicht zu nehmen“, hörte ich vor mir Wolles Stimme.
Der Marokkaner ging Svea voran und hielt sie an der Hand. Eben drehte er sich zu ihr um und machte merkwürdige Handzeichen, die sie in gleicher Art beantwortete.
Oh mein Gott, Gebärdensprache – sie haben ihr die Zunge ausgerissen. Das Flugzeug rumpelte.
Doro!, zuckte es plötzlich durch meine Vorderstube. Wenn sie die beiden sieht, ist es aus. Sie wird hier einen Aufstand machen. Die Umbuchungs- und Stornierungskosten für Sveas Flug, die wir hatten leisten müssen! Und dann die Aufregung, als wir feststellen mussten, dass sie spurlos verschwunden war! Ich griff hinüber und fasste Doro am Arm. Offensichtlich schlief sie schon und hatte die beiden nicht gesehen. Jetzt nur kein Wirbel an Bord. In Berlin, nach der Landung, werde ich den Araber und Svea zur Rede stellen. Er sieht aus wie ein Zuhälter, aber das macht mir keine Angst.
Ich räkelte mich nervös in meinem bequemen Sitz der Economy Class. Mein übermüdeter Verstand versuchte, das Vergangene zur Seite zu schieben – und mit ihm Svea, ihren dänischen Verführer Sören, und jetzt diesen unbekannten arabischen Begleiter und ... die Drogen und ... den Tod.
Da hörte ich es flüstern. Doro und Quiny! Gut, dass ihr da seid; ihr seid so liebe Freunde! Mechanisch suchten meine Füße nach Doros Füßen. Erneutes Flüstern. Beruhigt legte sich mein Gefühl in die Nähe von Doros Kopf. Schlafen, ich will schlafen.
Das Flugzeug setzte sich langsam in Bewegung. Wahrscheinlich rollte es zur Startbahn. Jetzt konnte ich endgültig abschalten.
In diesem Moment erscholl die auffordernde Stimme der Stewardess gleich neben meinem Ohr: „Angeschnallt?“
„Hm, hm, ja“, murmelte ich.
Wahrscheinlich werden sie jahrelang darauf gedrillt, Passagiere aus ihrem Schlaf zu reißen, etwa nach dem Motto: „Dürfen wir Sie wecken, wenn Sie am Einschlafen sind? Nein? Oh, das tut uns aber leid.“
Ich hasste Aufdringlichkeiten. Meistens gut gemeinte.
Doch ich fegte die schlechten Gedanken hinfort. Passagiere quälende Stewardessen sind vom gleichen Kaliber, sie meinen, dass sie es gut meinen, flüsterte mir die Großhirnrinde zu.
„Möchten Sie einen Schluck …?“
Ich schlug für einen winzigen Moment die Augen auf, sagte „Bin angeschnallt“ und schloss die Augen wieder. Aber ich spürte, dass die Passagiere-Quälerin im Gang neben unserer Sitzreihe stehenblieb.
„Ob Sie einen Champagner möchten. Sie haben Geburtstag!“
„Ja“, entfuhr es mir automatisch. Danach lasst ihr mich verdammt nochmal in Ruhe. Ich bin saumüde! Bitte!
Noch einmal öffnete ich mit letzter Willensanstrengung die Augen, um den Champagner zum Mund zu führen. Doro und Quiny schienen das Spiel mitzumachen.
Das Prickeln im Hals war ein Anschlag auf den guten Geschmack; fast hätte ich mich übergeben. Ich verkippte das Glas.
Doro tupfte mich ab – vielleicht war es auch die Stewardess – und man reichte mir ein feuchtes Tuch und ein neues Glas.
„Ehrlich gesagt, trink ich lieber Karamalz. Der Champagner schmeckt wie Sprudel, das bekommt mir irgendwie nicht. Und dann lasst mich bitte schlafen.“
Wie um meinen Wunsch zu unterstreichen, drehten die Turbinen auf und erzeugten ein angsteinflößendes Dröhnen. Die Flugbegleiterin brachte mir noch schnell ein Glas Wasser, das genau wie dieser Champagner schmeckte, und eine Tablette, kurz bevor der Pilot die Startbeschleunigung freigab. Ich stürzte das Glas Wasser und die Pille sofort hinunter, und meine Hände umspannten krampfhaft die Lehnen.
Langsam sammelten sich kleine Schweißperlen an meinem Haaransatz und tropften gemächlich meine Schläfen hinunter. Widerwillig blieb ich einen kurzen Moment wach. Die Boeing schoss an den erleuchteten Hangars vorbei, und die Lichter und hellen Punkte seitlich der Startbahn wurden kleiner und kleiner, bis sie sich schließlich zu einem lang ausgestreckten Lichtstrich vereinten.
Ich warf keinen Blick hinunter. Meine Augen waren zugefallen. Als das Dröhnen und Vibrieren nachließen, drückte ich mich noch fester, aber beruhigt in meinen Sitz. Nun endlich konnte ich schlafen.
„Also, gute Nacht, Schatz“, murmelte ich.
„Gute Nacht“, hörte ich die Stimme meiner geliebten Doro.
Flug Nr. 3342 der Lufthansa-Flotte verlief bis zu diesem Zeitpunkt planmäßig. Ich schlief tief und fest und traumlos, wie ich zunächst dachte. Aber dann hatte ich einen schlimmen Albtraum. Darin war ich von der Uni geflogen und somit durch das Begabtenabitur gefallen, weil mein prüfender Professor entdeckt hatte, dass ich ihn um den Finger wickeln wollte. Und Svea war eine bloße Schauspielerin, um mich im Namen Gottes zu prüfen.
Ich stritt mich mit Gott, dem ich vorwarf, dass er all das Übel in der Welt zuließ. Gott sprach von der Eigenverantwortlichkeit der Menschen und von der Vertreibung aus dem Paradies. Es war ein rein theologisch-unlogisches Geschwätz. Wie nicht anders zu erwarten, begann er bei Adam und Eva. Ich hingegen sprach vom sozialistischen Paradies und von Gottes eigener Verantwortlichkeit, wenn er denn allmächtig sei und fragte ihn, warum er die Erfindung der schändlichen Sklaverei zugelassen habe? Hatten die Sklaven daran selbst Schuld oder wie? Schon freute ich mich, weil Gottes Antwort ausblieb und er anscheinend ins Grübeln kam.
Ich war kampfesmutig und warf ihm allerhand vor, was in der Menschheitsgeschichte schiefgegangen war. Ich begann mit der unmenschlichen Sklaverei bei den alten Ägyptern, warf ihm die Sklavenhalterordnung der Römer und Griechen vor und natürlich die moderne Lohnsklaverei, Ausbeutung, Kinderarbeit, Armut, Umweltzerstörung.
Ich holte kaum Luft, und schon warf ich Gott den unmenschlichen Faschismus mit seinen verheerenden Folgen für Deutschland und die Welt an den Kopf. Natürlich warf ich ihm auch den immer noch existierenden Rassismus, Chauvinismus und Faschismus in westlich orientierten Ländern wie Spanien, Portugal, Griechenland und jetzt auch noch in Chile vor. Die Krönung meiner Vorwürfe bestand in der Aufzählung aller mir bekannten großen Kriege, die Gottes geliebte gottesfürchtige Menschlein je geführt hatten. War er vielleicht ein unbarmherziger Kriegsgott, hatte er uns nicht als sein Ebenbild erschaffen?
Sogar die Hunnen warf ich ihm an den Kopf. Dann kam ich zu all den unnötigen Naturkatastrophen, angefangen bei Blitz und Donner, Regenfluten, Überschwemmungen, Erdrutschen, Erdbeben, Kometeneinschlägen, Dürren, Missernten, Eiszeiten und allem, was dem Blauen Planeten schaden konnte. Und das sei Gottes Lieblingsball im Spielfeld des Universums?
Ich hatte gerade alles aufgezählt, als ich glaubte zu erwachen. Ich erinnere mich dunkel, dass ich mir jedenfalls vornahm, schneller zu erwachen, als Gott mich für meine wenig ehrfürchtige Rede zur Hölle schicken konnte.
Ich musste meine Augen erst an die Umgebung gewöhnen. Ich befand mich nicht in dem Hotel „Marseille“, jenem kleinen heruntergekommenen Etablissement in Marrakesch, wo wir noch vor weniger als vierundzwanzig Stunden untergekommen waren. Ich befand mich auch nicht in der Berliner Lützen- oder Clausewitzstraße. Ich befand mich ganz eindeutig in Lufthansa-Flug 3342 eines großen Vogels namens Boeing 757.
Ich nahm mein Taschentuch und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Puhhh, noch mal Glück gehabt. Gott hatte mich nicht aus dem Flieger geworfen.
Ich wollte nun aufspringen, denn ich witterte Gefahr. Doch der Gurt hielt mich fest.
Fasten Seat Belt. Ich löste benommen die Schnalle.
Jetzt hielt mich noch kurz der Krallengriff des Albtraums gefangen, dann ließ auch er mich los und gab mir scheinbar die volle Orientierung zurück.
Ich befand mich auf dem Luftweg nach Berlin, und mit mir 299 andere Passagiere. Darunter meine Freundin Doro und das mit uns eng befreundete Pärchen Quiny und Wolle, der nette Dreckskerl, der es beim Start irgendwie geschafft hatte, mich am zügigen Einschlafen zu hindern.
Als Erstes warf ich einen Blick auf die Uhr. 1:12 Uhr.
Dann sah ich auf den Sitz rechts neben mir, wo Doro saß. Doch sie war nicht da. Stattdessen lag dort ein Taschentuch.
Dann sah ich weiter in der Reihe – doch die Sitzreihe war leer, völlig leer.
Dann schaute ich vor mich und schaute den Gang entlang, und voller Schrecken stellte ich fest, dass ich niemanden sah. Nirgends ein Kopf über der Lehne eines Sitzes. Nirgends ein Bein quer im Gang. Weit und breit keine Stewardess in der Economy Class.
Ich betätigte den Ruf-Knopf für das Bordpersonal, aber nichts rührte sich – auch nicht, als ich mehrmals und lange klingelte.
Über den Service werde ich mich beschweren, schrie es in mir. Ich werde Schadensersatz fordern. Doro und ich hatten eine Rechtsschutzversicherung, wie jeder kluge Deutsche. Rechtsstreitigkeiten kostenfrei!
Ich strich mir über die verschwitzten, fettigen langen Haare, über die sich das vornehme Damenkränzchen meiner Mutter jetzt zu Recht belustigt hätte. Aha, schoss es mir durch den Kopf. Man schaut Video in der First Class. Die Stewardess legt bestimmt gerade ein neues Band ein. Vielleicht sehen sie „Angst essen Seele auf“, meinen Lieblingsfilm von Rainer Werner Fassbinder.
Ich stand benommen auf. Vielleicht sehen sie auch „Jeder für sich und Gott gegen alle“, ein Film von Werner Herzog über das Leben Kaspar Hausers, der seine ersten achtzehn Lebensjahre in einem engen Kellerverlies verbringen musste, isoliert von jeglichem menschlichen Kontakt, außer zu einem Fremden, der ihm sein Essen brachte. Ich ging nach vorne und schob den Vorhang, der die Abteile trennte, zur Seite. Den Kaspar-Hauser-Film wollte ich schon lange mal sehen. Die Rezensionen waren vielversprechend.
Was ich sah, rebellierte gegen meinen Verstand:
Kein Video! Kein Mensch! Keine Stewardess! Die erste Klasse war völlig leer, ebenso wie die Economy Class.
War das Gottes Rache – die Vernichtung der Ersten Klasse? Hatte er gar auf mich gehört, hatte er den Klassenkampf zugunsten der Benachteiligten entschieden? Oder hatte er eigentlich die Zweite Klasse, in der ich saß, aufs Korn genommen und der Einfachheit halber das menschliche Leben von allen Klassen erlöst? Hatte er sich bei der Klassenwahl getäuscht, war es ein Versehen? Er hatte sich schon so oft getäuscht. Jahrtausende lange Täuschungen.
In diesem Moment ertönte der überlaute Ruf.
Es war Doro, sie rief nach der Stewardess.