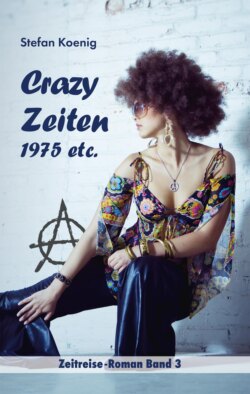Читать книгу Crazy Zeiten - 1975 etc. - Stefan Koenig - Страница 8
1975 - Marokko & Love & Peace & Tod
ОглавлениеEndlich hatte ich Gelegenheit, mit Quiny, ihrem Freund Wolle und dessen Freund Gerd über Svea zu sprechen. Sie hatten von Stella, der Hippie-Schwedin mit den beiden dänischen Hippie-Liebhabern, einen Brief erhalten, in dem davon berichtet wurde, dass Svea inzwischen zwar kurz auf-, dann aber wieder für Wochen abgetaucht und immer mehr den Drogen verfallen sei. Wahrscheinlich ginge sie der Prostitution nach. Ich hatte es ja geahnt! Wir befürchteten das Schlimmste.
Verabredungsgemäß brachen Wolle, Gerd und ich Anfang Februar mit Wolles Bulli zu unserem Marokko-Trail auf – auf der Suche nach Svea. Ich konnte es mir zeitlich leisten. Es waren Semesterferien. Ich hatte im Moment keinen festen Job angenommen, um mich mehr im journalistischen Bereich zu engagieren. Bei der Komparserie des Schiller-Theaters hatte ich mich für Februar und März ausgeklinkt. Doro musste bleiben, denn sie arbeitete in der neuen Anwaltskanzlei als Fremdsprachensekretärin. Und das, ohne dass sie die erforderlichen Fremdsprachen wirklich beherrschte, was zweifellos eine hohe Kunst und bisher noch nicht aufgefallen war. Ihre ansehnliche Vergütung floss also weiterhin Monat für Monat in unsere gemeinsame Studenten-Kasse.
Wolle, mit einem halben Jahr Alters-Vorsprung vor meinen vierundzwanzig Jahren, konnte sich von seinem Montage-Job jederzeit abseilen. Er würde allemal eine neue Arbeit als Messemonteur und Raumausstatter finden. Gerd war ein Vollbluthippie, von dem niemals durchsickerte, wovon er lebte. Aber er lebte offenbar gut und nur von Luft und Liebe und gehörte inzwischen mit seinen sechsundzwanzig Jahren zu den Althippies.
Im winterlichen Basel übernachteten wir bei Romano, einem Freund von Elke, die sich als ehemalige Schulfreundin von Doro seit Anfang des neuen Jahres bei uns in der Lützenstraße einquartiert hatte. So hatte Doro Gesellschaft, während ich nicht wusste, wie lange die Suche in Sachen „Rettungsaktion Svea“ dauern würde. Marrakesch war groß und Marokko weit.
Elke hatte mit Romano telefoniert und alles für uns drei Reisende klargemacht. Er war ein echt cooler Gastgeber, war hippiemäßig drauf und rauchte abends gerne einen Joint. Mit seinen neunundzwanzig Jahren war er als gebürtiger Schweizer bereits als Architekt tätig, sprach fließend Englisch, Italienisch und ein niedliches Schwiizerdütsch. Seine australische Frau Judith und das gemeinsame zweijährige Töchterlein Natascha waren gerade auf Besuch bei den Schweizer Großeltern, sodass wir drei Jungs uns in Romanos Wohnung ausbreiten und übernachten konnten. Ich ahnte damals nicht, in welcher Weise mich das Schicksal von Romanos Familie noch verfolgen würde – bis über den großen Teich nach San Francisco.
Romano kannte sich im marokkanischen Milieu aus; ich erfuhr nie, woher das kam. Er gab uns wichtige Tipps, wie wir uns gegenüber den marokkanischen Dealern und Zuhältern verhalten sollten – man solle sich bis zur Entdeckung von Svea wie ihresgleichen geben, aber danach sofort die Polizei einschalten. „Ohne Bullen machen die euch kalt!“
Ich versprach ihm, einen lebendig warmen Beweis aus Marrakesch auf der Rückreise mitzubringen. Ich dachte dabei an Svea. Wie Gerd auf der Weiterfahrt gestand, dachte er an irgendeinen Straßenköder, weil er Romana als tierlieb einschätzte, weil Romano vier Katzen hatte. Hätte dazu ausgerechnet ein marokkanischer Straßenhund gepasst? Mensch Gerd! Hirn einschalten!
Ansonsten verstanden wir drei uns auf der Fahrt problemlos, ohne große Worte. Wir hatten ein einheitliches Ziel, und wir würden zu Dritt bis zum Ende gemeinsam um dieses Ziel kämpfen. Einigkeit macht stark. Wir fühlten uns stark.
In Torremolinos war das Klima schon wesentlich angenehmer als in Basel; man konnte bereits den Frühling erahnen. Wir suchten das niedliche Hotel „Isabel“ auf, in dem ich nun das dritte Mal übernachtete. Wir wollten nur eine Nacht bleiben, in der wir auch »The Alamo« besuchten. Wir wollten schnell weiter. Aber es sollte anders kommen. Das »Alamo« war immer noch die schnuckelige kleine Bar, aus der internationales Geplapper und die Songs der Saison tönten. Gerade schallte die schwedische Popgruppe ABBA mit Waterloo aus den Boxen.
Die Atmosphäre war nicht mehr ganz so, wie ich sie noch aus meinem ersten Besuch im Jahr 1970 in Erinnerung hatte, obwohl die Ausstattung fast gleich geblieben war. Aber soziale Orte leben hauptsächlich von ihren sozialen Trägern, den Besuchern, den Menschen, und nicht allein von den Objekten. Die Bar bestand unverändert aus dem Raum mit den vier Holztischen und jener immer noch nicht ganz aus dem Leim gegangenen Polsterbank an der Stirnseite. Hinter der Theke stand sogar noch der alte Plattenspieler. Allerdings zierten neue Plakate die Wand: ABBA, The Hollies, Eric Clapton, Barbara Streisand – und immer noch hing dort Janis Joplin vom letzten Jahr, als ich schon einmal hier auf Durchreise gewesen war.
Die Barbesucher waren älter geworden, oder es kam uns nur so vor. Jedenfalls sagte Wolle: „Alles Alt-Hippies!“
„Da sind aber auch Nachwuchshippies“, sagte Gerd lachend. „Nicht älter als achtzehn oder neunzehn.“
„Und immer noch einige US-Soldaten“, ergänzte ich, weil ich extra darauf achtete. Denn das Schicksal von John, dem eingeknasteten Deserteur der US-Army, war mir sehr gegenwärtig, obwohl es nun schon fast fünf Jahre her war, dass man ihm hier durch Denunziation auf die Spur gekommen war und ihn die MP aus seinem Barkeeper-Dasein von gleich auf jetzt wegverhaftet hatte.
Bis heute hatten wir nichts mehr von ihm gehört. Gewiss ließ man ihn in irgendeinem fernen Militärgefängnis dahinschmoren, fernab seiner Verwandten, damit er schön isoliert war, ohne dass man es juristisch je als Isolierhaft hätte angreifen können. Mit Deserteuren ging die rachsüchtige amerikanische Militärmaschine nicht gerade zimperlich um.
John war mir damals sofort sympathisch gewesen. Svea und er waren ein Pärchen gewesen; sie liebten sich und waren füreinander da. Obgleich Svea mir beiläufig erklärt hatte, dass sie auch gut ohne ihn auskommen könne. Aber damals war sie siebzehn und hatte vielleicht noch andere Ideen im Kopf. Jedenfalls hatte sie die Verhaftung ihres Geliebten und sein Verschwinden von einem Tag auf den anderen so arg mitgenommen, dass sie in eine akute psychische Krise geraten war. Ein Jahr lang hatte sie einmal pro Woche die beschwerliche Busfahrt nach Malaga unternommen, um sich therapieren zu lassen.
Sie konnte John nicht besuchen. Das Konsulat verweigerte jegliche Auskunft über seinen Verbleib. Svea blieb in dieser brutalen Realität hilflos zurück. Wir hatten damals von John ausführlich erfahren, wie brutal es auch an der amerikanischen Heimatfront aussah. Er hatte uns über die Totschlag-Orgien der Nationalgarde gegenüber den Schwarzen und den Studenten berichtet. Er war dem Einberufungsbefehl nicht gefolgt, war über Kanada geflüchtet und war von den US-Behörden seitdem über alle amerikanischen Konsulate und über alle Kontinente hinweg gesucht worden.
Er war einer von Hunderttausenden auf einer jener langen Desertionslisten. Deshalb hatten ihm seine amerikanischen Freunde aus der Friedensbewegung einen falschen Pass besorgt und er musste ein Leben im Untergrund führen, was im Barkeeper-Dasein im Alamo geendet hatte. Keiner der Soldaten, die damals dort verkehrten, kannte seine wahre Identität. Aber einer musste ihn schließlich doch erkannt und verraten haben.
Ich weiß nicht, was mich bewog, aber als jetzt die spanische Bedienung, beladen mit Hippie-Schmuck, freundlich blinzelnd an unseren Tisch tänzelte, fragte ich sie, ob sie einen Amerikaner namens John kenne, der hier einmal gearbeitet habe. Die junge Frau sprach ein ausgezeichnetes Englisch; sie war höchstens neunzehn Jahre alt und konnte John eigentlich nicht kennen. Doch zu meinem Erstaunen bejahte sie freudig und sagte, dass John hier neu hinzugekommen sei. Er habe allerdings noch nie zuvor hier gearbeitet. Mir stand die Enttäuschung wohl ins Gesicht geschrieben, denn sie meinte: „Er arbeitet heute Abend hier und unterhält sich gerne mit deutschen und skandinavischen Gästen. Lernt ihn doch einfach kennen!“
Als er schließlich kam, war es mein John.
Er war groß und schlank, nur nicht mehr ganz so athletisch, eher etwas dürr; er trug wie damals Gibran-Masche, das heißt, er trug sein Haar im Jesusstil, dazu seine, ihn wohl nie verlassen wollenden, Jesuslatschen. Der wallende Bart von früher war einem gepflegten und gestutzten Bart gewichen, der sein längliches Gesicht jetzt umrahmte. Als mich seine blauen Augen entdeckten, begannen sie sofort zu funkeln und er stürzte auf mich zu.
„Kara!“, rief er aus. „Gott hat dich geschickt!“ Freudentränen strömten bei ihm wie bei mir, wobei sich meine Tränen der Wiedersehensfreude mit der Traurigkeit und der insgeheimen Sorge um Svea mischten.
„Es ist eher Svea, die uns hier zusammenführt“, sagte ich.
Ich stellte ihm Wolle und Gerd vor. Der Abend wurde lang. John machte seinen Job hinter dem Tresen, kam aber jede freie Sekunde zu uns und ließ sich alles erzählen. Noch wusste er nicht, was mit Svea geschehen war. Als das Alamo gegen ein Uhr morgens schloss, stand sein Entschluss fest.
„Ich suche mit euch nach Svea. Einverstanden?“
„Und wie!“, antwortete ich, und John ging zu der Spanierin und erklärte ihr die Situation. Ich sah, wie sie ihn anschmachtete und ihm dann mit einem traurigen Blick einen Kuss auf den Mund gab.
Irgendwie passte Johns abgewetzte Jeans immer noch zu ihm, obwohl er sichtlich älter geworden war, wie auch das Farmerhemd, wobei er keine jener beliebten Hippie-Westen mehr trug, die einmal sein Wahrzeichen waren. John musste am nächsten Tag noch einige Dinge erledigen, und so wir schliefen noch eine Nacht im Isabel. Wir wollten ausgeruht die Weiterfahrt antreten.
Einen Tag später setzten wir mit der Fähre nach Tanger über. Das Klima hier war mit einem Mal wesentlich milder. Wir trugen jetzt nur noch T-Shirts. Ohne Pause ging es Richtung Marrakesch, wo wir uns von unterwegs telefonisch im Hotel Marseille angemeldet hatten, mit der Bitte, unsere Ankunft Stella, Leif und Jan-Stellan zu avisieren.
Während der Fahrt hatte John natürlich tausend Fragen zu Svea. Besonders das Missbrauchsereignis, das ihr durch den damaligen spanischen Geschäftsführer des Alamo widerfahren war, interessierte ihn und machte ihn wütend. Aber es war geschehen. Und geschehen war auch Sveas tiefer Absturz in die Höllenwelt der Drogen. Alle seine besorgten Fragen zeigten mir, dass er sie immer noch liebte. Auch als er über seine isolierte Haftzeit in einer Zelle des amerikanischen Militärgefängnisses bei Malaga berichtete, erwähnte er, wie oft er an Svea gedacht hatte, wie er sie vermisste und davon träumte, sie wohlbehalten wiederzusehen.
Die Fahrt in Wolles Bulli ging zügig voran, ohne dass uns der Bus seine treuen Dienste versagte. Auf dem Dachgepäckträger hatten wir Johns große Metallbox mit all seiner persönlichen Habe festgezurrt. Mehr als hundertzehn Stundenkilometer konnten wir sowieso nicht fahren.
Marrakesch liegt im Süd-Westen Marokkos und wird von den Einheimischen mit Stolz als die „Perle des Südens“ bezeichnet. Wir spürten jetzt äußerst angenehm „den Atem des Südens“, die afrikanische Sphäre. Doch unsere Gedanken drehten sich in aller Kühle um die vor uns liegende Befreiung von Svea – aus wessen Armen auch immer.
Während der Fahrt las ich John, Wolle und Gerd aus einer Touristenzeitung vor. Aber nach einer Weile winkte Gerd ab: „Das kennen wir doch alles schon, dass Marrakeschs Stadtgeschichte bis ins 12. Jh. zurückgeht, und dass sie als ehemalige Königsstadt einen prächtigen Palast aus dem 17. Jahrhundert hat, den sich jeder Tourist unbedingt anschauen muss, ebenso wie das Herz der Altstadt, die Medina, und so weiter.“
Uns hatte damals als Teenies, als wir das erste Mal den Hippie-Trail ins außereuropäische Ausland unternahmen, stets die Altstadt mit den unzähligen Souks und seinem Pulsgeber, dem Djemaa el Fna-Platz, fasziniert. Dort hatten wir junge Araber, wie Nine, getroffen, den marokkanischen Jungen mit den neun Fingern. Er war für Alles zu gebrauchen, aber zu nichts wirklich Gutem in der Lage. Er war ein Opfer der Umstände, wie wir es so schön, vermeintlich wertneutral, beurteilten.
Die Umstände, das waren die verführerischen Hippie-Mädchen in ihren kurzen Röcken und freizügigen Blusen, wir Hippie-Jungs mit unserem lockeren Gehabe und den wilden Wuschelhaaren und den vielen Kettchen um Hals und Handgelenke. Die öffentliche Knutscherei. Die vielen Fremdwährungen und überhaupt das viele Geld, das plötzlich die mittelalterlichen Gassen flutete. Das viele Geld kam mit dem Rauschgift, und das Rauschgift kam zum Geld.
Hier also, auf dem Djemaa el Fna erreichten wir nun unser erstes Ziel, hier, wo im Mittelalter die abgeschlagenen Köpfe aufgespießt und zur Schau gestellt worden waren.
Köpfe rollten heute nicht mehr, dafür ging es aber – wollte man den Überlieferungen glauben – wie in uralten Zeiten zu: vor allem laut, bunt und schrill. Nachmittags füllte sich der Platz mit Gauklern, Vorlesern, Feuerschluckern, seltsamen Verkaufsständen, Akrobaten und Schlangenbeschwörern. Es wirkte wie eine Szene aus einer anderen Zeit.
Als wir um sieben Uhr abends im Hotel Marseille eintrafen, kam Stella auf uns zu, umarmte uns und schluchzte: „Svea ist hier vor drei Tagen aufgetaucht, aber sie hat uns zum Narren gehalten und ist wieder spurlos verschwunden, als sie erfuhr, dass du kommst.“
„Es war nicht besonders klug, ihr von unserer Ankunft zu berichten“, sagte ich. „Hattest du etwas von John zu ihr gesagt?“
„Ich dachte, sie wäre froh, dich wiederzusehen. Du hast ihr immer etwas bedeutet. Von John wusste ich ja noch nichts.“ Dann fügte sie hinzu: „Sie war in Begleitung von zwei jungen Marokkanern in westlicher Kleidung. Die verschwanden dann aber wieder.“
„Und Sören?“, fragte ich. Sören – ebenso dänischer Herkunft wie Svea – war Sveas bisheriger ständiger Begleiter gewesen, kein Partner im sexuellen Sinn, mehr ein Beschaffungsfreund, einer, der alle Drogen für Svea kritiklos beschaffte, egal was sie wollte. Ich war mir sicher, dass er ein Dealer war, der an Svea mitverdiente. Ob er sie wirklich nicht bumste, wenn sie berauscht war, konnte ich natürlich nicht ausschließen. Jedenfalls war Svea im Spätsommer des letzten Jahres vor der geplanten gemeinsamen Abreise mit Sören getürmt, oder er mit ihr. Wir wussten es nicht. Gegenüber John hielt ich in dieser Hinsicht meinen Mund und sagte nur, dass Sören ein guter Landsmann von Svea sei.
„Sören ist hier geblieben und hat Svea bei sich übernachten lassen.“ Stella sah mich bedeutungsvoll an. „Du wirst diesen Feigling gleich erleben.“
Sobald wir das Hotel betraten, konnten wir Stellas Freunde Jan-Stellan und Leif im obersten Stockwerk mit ihrem Landsmann Sören schimpfen hören.
Gerd, Wolle, John und ich rannten hinauf. Leif gab Sören eben den Auftrag, Nine zu suchen. Als ich Sören erblickte, ging der Gaul mit mir durch und ich schrie: „Was zum Teufel hast du mit Svea gemacht? Wie konntest du dieses todkranke Kind hier wieder weglaufen lassen?“
Jan-Stellan und Leif begrüßten uns kurz und herzlich, während Sören herumdruckste.
„Sie ist erwachsen. Was habe ich mit ihr zu tun? Ich bin mit ihr nur locker befreundet. Sie führt ihr eigenes Leben.“
„Wo ist Svea?“, brüllte ich.
Und Wolle fuhr ihn an: „Warum hast du nicht auf sie aufgepasst, wenn du dich doch als Freund von ihr ausgibst?“
„Was hat Nine mit der Sache zu tun?“, fragte Gerd. Die Frage richtete sich an alle drei, an Leif, Jan-Stellan wie an Sören.
„Das kann euch der Idiot hier sagen!“ Leif, der Größte von uns allen, zeigte auf Sören, ging dicht an ihn heran und stach ihm mit dem Zeigfinger gegen die Brust. Sören torkelte etwas zurück und sagte fast unter Tränen: „Dieser dreckige kleine Araber hat sie völlig umgedreht.“
„Umgedreht?“ Ich sah ihn scharf an.
„Ja, Nine ist ein Zuhälter und hat ihr seit Monaten Anträge gemacht und ihr schon vor langem zahlungskräftige arabische und europäische Freier zugeführt. Ich könnt‘ ihn erwürgen!“
„Aber nur, weil du selbst sie nicht mehr ausbeuten kannst“, sagte Wolle.
„Ich habe Nine hier rausgeworfen, als er vor drei Tagen Svea besuchte, die sich mir gerade wieder anvertrauen wollte.“ Sören schaute mich Verständnis heischend an. Aber ich hatte kein Verständnis. Ich schaute zu John und hoffte, dass zumindest er sich zurückhielt.
„Und weiter?“, fragte ich.
„Als er vor dem Hotel stand, pfiff er.“
„Den Pfiff habe ich gehört und dachte natürlich nicht an Svea!“, sagte Leif und schlug sich an die Stirn.
„Svea griff ihren Koffer, der immer abreisebereit an der Tür stand, und stürzte die Treppe hinunter“, warf Sören ein. „Ich konnte sie nicht aufhalten. Vom Balkon aus sah ich, dass Nine sie in Richtung Djemaa begleitete.“
„Und du warst zu feige, sie aufzuhalten?“ Ich sah Sören herausfordernd an und rechnete mit einer albernen Entschuldigung. Doch er schüttelte entschieden den Kopf.
„Ich folgte ihnen unauffällig, um zu sehen, was nun geschehen würde. Nine führte sie zu einer Limousine, in dem zwei junge Männer saßen. Und weg waren sie.“
„Wir werden Nine finden und ihm den Hals umdrehen“, sagte Jan-Stellan. Er war von kräftiger Natur und durchtrainiert. Man konnte sich gut vorstellen, dass er mit ihm kurzen Prozess gemacht hätte. In diesem Moment hätte sich gewiss auch John ihm angeschlossen, wie ich seiner Körpersprache entnahm.
„Lasst uns gehen und Nine suchen!“, meinte Leif. „Du kommst mit!“, rief er an Sören gewandt.
„Wartet noch einen Moment“, bat ich. „Ich möchte erst noch Doro anrufen und sagen, dass wir gut angekommen sind.“
Es war höchste Zeit, sonst wäre sie beunruhigt gewesen; sie neigte zu übertriebener Sorge, wenn ich mich nicht zeitig meldete. Es war bereits zwanzig Uhr.
*
Am 4. Januar 1975 vertraute der sich als „links“ bezeichnende Vorsitzende der SPD-Programm-Kommission „Orientierungsrahmen ‘85“, Peter von Oertzen, der Frankfurter Rundschau an. Ihm zufolge solle die Grundtendenz des neuen SPD-Programms „die Abkehr vom Gedanken des Versorgungsstaats und die Hinwendung zum Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe sein.“ Dazu hatte ich einen Leserbrief geschrieben, da man mir einen redaktionellen Kommentar verweigert hatte.
Wie mir nun Doro am Telefon berichtete, war zuhause alles in Ordnung und die FR hatte meinen Leserbrief sogar in großer Aufmachung abgedruckt. „Das kommt wahrscheinlich besser noch als ein redaktioneller Kommentar“, sagte Doro.
„Na ja, die Leser sind sehr autoritätsgläubig und denken, dass ein Kommentar ‚mehr Wert‘ und ‚öffentlich wichtiger‘ sei, als irgendein Leserbrief“, antwortete ich.
Meine Einschätzung zu von Oertzens „linker Abkehr vom Sozialstaat“ hatte ich zwei Wochen vor unserer Abreise bei der mir freundschaftlich verbundenen Redaktion eingereicht. Den Text konnte ich dann übrigens genauso gut noch zwei Jahre später verwenden: „Die sozialdemokratische Partei begibt sich hier auf einen Weg, vor dem nicht eindringlich genug gewarnt werden kann. Die Durchsetzung einer solchen Abkehr vom Prinzip Solidarität könnte nicht nur, sondern müsste die Spaltung der Sozialdemokratie bedeuten.
Nicht nur der sozialistische, auch der radikaldemokratische Flügel müsste die Partei verlassen und eine neue Formation bilden. Dass nicht nur konservativ-reaktionäre Kräfte der bundesdeutschen Gesellschaft auf eine weitere Spaltung der Arbeiterbewegung setzen, sondern dass es auch innerhalb der SPD Personen und Kreise gibt, denen ein offenes Bündnis mit den ‚gemäßigten Konservativen‘ gegen die Linke vorschwebt, ist bekannt. Die Sozialisten und Radikaldemokraten in der SPD müssen daher die Verwandlung der SPD zur ideologischen Wegwerfpartei verhindern, um die Spaltung zu vermeiden, die sie sonst unweigerlich vollziehen müssten.“
Auf unserer viertägigen Tour von Westberlin über Basel, Torremolinos und Tanger bis nach Marrakesch hatte es viel Zeit zum Diskutieren.
Die Politik der SPD gab stets Anlass zu hitzigen Diskussionen. John konnte da zwar nicht mitdiskutieren, hörte sich aber alles interessiert an und zog jedes Mal Parallelen zu den korrupten Strukturen der amerikanischen Gewerkschaften, in deren Führungsetagen allesamt von den Unternehmern gekaufte Bonzen das Sagen hätten, wie er meinte.
Ich wiederum hatte mich noch über etwas anderes entrüstet, weil nicht ein einziges Wort in den Medien unseres Landes über die Enthüllungen in Italien verlautete. Elke, meine Italien-Enthusiastin und gute Kennerin des Landes, hatte mir darüber berichtet. Ihre Quellen waren verschiedene italienische Zeitungen aus unterschiedlichen politischen Lagern – von den katholisch dominierten Christdemokraten über die NATO-freundlichen und US-untergebenen italienischen Sozialdemokraten bis hin zu den Kommunisten, die sich jetzt neuerdings Eurokommunisten nannten, weil sie sich von Moskau absetzen und einen eigenständigen westeuropäischen Weg des Sozialismus einschlagen wollten.
Was also war geschehen?
Im bevorzugten Urlaubsland der Deutschen hatte der US-Geheimdienst CIA seit Jahren die italienischen Neofaschisten finanziert. Neofaschisten! Wie er zuvor die griechischen Obristen mit Geld und Strategieentwürfen zum Putsch gegen Verfassung und Volk getrieben hatte. Eigentlich eine unverschämte Einmischung in die Politik souveräner und zudem befreundeter Länder. Auch an Chile musste ich wieder denken. Nun also direkt vor unserer Haustür, mitten in Westeuropa.
„Es müsste eine Welle der Empörung auslösen!“, sagte ich. Aber es wurde in unserer Presse totgeschwiegen.
„Wieder einmal Schweigen im Walde. Aus falsch verstandener Loyalität“, meinte Wolle.
„Ja, ja, die Amis. Immer wieder die Amis“, sagte Gerd. „Was wollen die nur so fern der Heimat?“
„Sie wollen, was alle Imperien wollen: die Rohstoffe anderer Länder, ihre Absatzmärkte – und ihre politisch-militärische Unterstützung, einfach nur bedingungslose Gefolgschaft!“, antwortete ich.
„Und deshalb unterstützen sie Neofaschisten?“
„Italien hat die in Europa stärkste und bestorganisierte Arbeiterbewegung. Das stört die US-Strategen, weil sich die italienische Politik nicht so folgsam unterordnet wie zum Beispiel die deutsche. Deshalb heißt die Devise: Destabilisieren und Teilen!“
„Heißt es nicht auf Lateinisch ‚divide et impera‘, also ‚teile und herrsche‘?“, fragte John.
„Ja, das schon“, antwortete ich. „Aber es kommt noch etwas hinzu: das Destabilisieren, also einem Land an allen Fronten Schwierigkeiten bereiten – und schon ist es mit sich selbst beschäftigt und kann keine den USA widersprechende Außenpolitik betreiben. In der Politikwissenschaft nennt man das ‚Neutralisation der Kräfte‘. Die Kraft der italienischen Arbeiterbewegung soll durch den Aufwind der Rechtsradikalen geschwächt und in einer Art paralysierender Beschäftigungstherapie neutralisiert werden. Wenn sich die fortschrittlichen Kräfte nicht um die Zukunft, sondern um die Abwehr rückwärtsgewandter Ideologien kümmern müssen, dann ist das gut für die herrschende Klasse und für den ungestörten Weiterfluss ihrer Profite und schlecht für die sozialen Perspektiven.“
„Danke für deinen Mammutvortrag“, sagte Wolle. „Lernt ihr sowas in euren Politikseminaren?“
„Unter anderem.“ Ich musste lachen. „Tut mir leid, wollte euch nicht vollschwätzen.“
„Ist schon gut“, sagte Gerd. „Es ist so offensichtlich, und doch verstehen es die Massen nicht. Allein die weltweiten Militärstützpunkte der USA bedeuten in der Sprache der Herrschaft: „Wir beanspruchen alles, bedingungslos; die Macht gehört uns!“
Jetzt, mitten in Marrakesch, fühlten wir uns fast ohnmächtig und sehnten uns nach ein klein wenig mehr Macht, nach ausreichender Macht und Kraft, um Svea aus dem arabischen Dschungel von Tausendundeiner Nacht zu befreien.
Wir gingen zum Djemaa und fragten alle Vorübergehenden, ob sie Nine, den dreckigen Kerl, gesehen hätten. Auf dem großen Platz tummelten sich etliche Jungs aus seiner Bande, und Jan-Stellan bekam einen zu fassen und fragte, wo sich Nine versteckt hielt. Der Junge rief seinen Kumpanen etwas auf Arabisch zu, und innerhalb von drei Minuten kam Nine über den Djemaa stolziert, eine Falafel in der rechten Hand.
„Ihr sucht mich?“, fragte er unschuldig. Er ging direkt auf Sören zu, der ihn wutentbrannt anstierte.
„Was hast du mit Svea gemacht?“, brüllte Sören, wohl um uns zu beweisen, dass er sich wie wir größte Sorgen um sie machte.
„Svea ist weg“, stellte Nine in einem Ton fest, wie ein Gesandter, der mit einem feindlichen Herrscher verhandelt.
„An wen hast du sie verkauft?“, fragte Jan-Stellan und ging einige Schritte auf Nine zu.
„Ich weiß nicht, was du meinst.“
„Wo sie ist, will ich wissen!“
„Im Augenblick wahrscheinlich mit zwei sauberen jungen Männern im Bett.“
„Wo? Wo, hab ich gefragt!“ Jan-Stellan versuchte, den kleinen Kerl zu packen, der sich jedoch mit drei schnellen Schritten rückwärts bewegte, ohne sein Gegenüber aus den Augen zu lassen.
„Warum sollte ich es euch sagen?“, fragte Nine, dem sich nun auch Leif von der Seite näherte.
„Weil ich in einer Minute die Polizei rufe.“ Leif schaute auf seine Armbanduhr, betätigte die Stoppuhrtaste. Das Klacken war deutlich zu hören. Er begann die Sekunden zu zählen. „Die Zeit läuft!“
Nine erkannte, dass der Däne seine Drohung ernst meinte. „Ich nichts Schlechtes getan.“
Nine wechselte auf eine gespielt hilflose Sprachvariante, um uns zu verarschen.
„Ich ihr sagen, dass zwei nette Herren wollen mit ihr schlafen gegen gutes Geld. Sie will. Die Herren wollen. Ich habe nix damit zu tun. Was kümmert das die Polizei?“
Er hatte Recht.
„Wohin sind sie mit ihr gefahren?“, fragte ich zitternd vor Wut. Nine verweigerte die Antwort, und ich erwischte ihn wutentbrannt an der Jacke. „Rede!“, sagte ich im Befehlston. John verfolgte alles und ich ahnte, dass er drauf und dran war, einzuschreiten. Mit einer Armbewegung signalisierte ich ihm, es uns zu überlassen. Ich wollte ihn nicht in eventuelle Unannehmlichkeiten mit der spanischen Polizei bringen, denn damit mussten wir rechnen – und John als „vorbestrafter“ Ausländer? Ich wollte nichts riskieren.
In diesem Moment griff der starke Arm von Jan-Stellan nach dem Jungen, und Nine kreischte: „Halt ihn weg von mir!“
Ich riss das kleine Ekel zurück und gab dem Dänen mit den Augen zu verstehen, ihn mir zu überlassen. Während ich ihn schüttelte, grinste Nine plötzlich und fragte: „Wieviel zahlst du?“
Ich war so angeekelt, dass ich ihn nun doch Jan-Stellan überließ, der ihm kaltblütig den Arm verrenkte, bis Nine brüllend vor Schmerz die Augen verdrehte, woraufhin ich ihn wieder an mich riss. „Halt, Jan!“, rief ich. „Erst müssen wir herausfinden, wohin die beiden mit Svea gefahren sind.“
„Was ist es euch wert?“, beharrte Nine nun wieder keck, weil schmerzfrei.
„Weißt du, wo sie ist?“, fragte ich zurück.
„Ich weiß es.“
„Wo?“
„Wieviel?“, wiederholte der Junge, woraufhin Jan-Stellan zu meiner Überraschung begann, den Zwanzigjährigen wirklich fest auf den Kopf zu schlagen.
„Du Sauhund“, flüsterte er. „Sag endlich, wo sie ist, oder ich schlage dich tot.“
Nine entwand sich ihm halb, drehte sich schnell wie ein Windhund ihm zu und rotzte ihm direkt ins Gesicht. Jan war so überrascht, dass er seinen Griff lockerte und Nine sich losreißen konnte. Aus sicherer Entfernung beschimpfte er uns auf Englisch. John wollte ihm nachstellen, aber ich hielt ihn zurück.
Die Passanten, die sich als Touristen hier aufhielten, schauten uns böse nach. Er bezeichnete uns als europäische Großdealer, die ihn, den kleinen Marokkaner, betrogen hätten. Wir wären Neokolonialisten, die ihn und seine armen Brüder ausbeuteten. Einige Touristen blieben verwundert stehen, wohl im Zweifel, ob sie uns stellen und die Leviten lesen sollten.
Es bestand keinerlei Hoffnung, den kleinen Drecksack in dieser Nacht noch einmal zu erwischen. Aus der Ferne sahen wir ihn noch inmitten seiner Bande, vor der er offensichtlich damit prahlte, wie er das Hippie-Mädchen aus dem Hotel geholt und sich aus Jans kräftigem Griff befreit hatte.
Wir waren nicht in Jubellaune und gingen wie begossene Pudel zurück ins »Marseille«. Nach unergiebigem Hin- und Her-Diskutieren, was wir nun als nächstes unternehmen sollten, machten Stella, Gerd, Wolle und ich uns auf den Weg zum Casino-Hotel »Mamounia«, um uns für einen Augenblick auf neue Gedanken zu bringen. Aber in meinem Kopf kreisten sämtliche Gedanken selbstredend nur um Svea.
In der Nacht hatte ich wüste Albträume, in denen Jan-Stellan den arabischen Jungen schlug und daraufhin eine Horde kleiner Kinder und Jugendlicher wie ein Schwarm über uns herfielen. Der nächste Morgen war schrecklich. Bei Tageslicht war der Schmutz in diesem etwas heruntergekommenen Hotel nicht zu übersehen, eben ein typisches Hippiequartier. Wir wussten nicht, was zu tun sei. Am Frühstückstisch saßen wir schweigend da und hörten auf die Gespräche an den Nachbartischen. John machte einen sehr bedrückten Eindruck.
Gott sei Dank erwähnte niemand von unseren Frühstücksnachbarn die weitverbreiteten Geschichten über schöne, hellhäutige Hippiemädchen, die mit Haschischplätzchen gefügig gemacht und dann in ein Leben der Prostitution und Sklaverei entführt wurden. Mit solchen Geschichten konnte man Neulinge verschrecken. Mehr aber noch John wehtun.
Stella meinte, Svea sei wahrscheinlich freiwillig mit den Marokkanern – wenn es denn welche gewesen seien – durchgebrannt, würde sich aber erst wieder in Marrakesch blicken lassen, wenn sie sicher sein konnte, dass ich sie nicht mehr suche.
„Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie in höchster Gefahr schwebt. Sie kann ihr Handeln doch wohl kaum mehr selbst einschätzen. Und wir können nicht hier sitzen und so tun, als sei nichts geschehen.“ Ich war verbittert ob unserer gestrigen Niederlage.
„Keiner tut so, als sei nichts geschehen“, sagte Wolle. „Nur müssen wir jetzt die Nerven behalten. Wir finden sie!“
Zwei Tage vergingen, ohne dass wir von Svea etwas gehört hatten. Am Morgen des dritten Tages kreuzte zu unserer Überraschung Nine im Hotel auf, vergnügt und locker wie immer. „Ich will euch noch eine Chance geben“, sagte er. „Ich rede aber nicht mit dem Dicken!“ Er deutete auf Jan-Stellan, der nicht dick, sondern sehr muskulös war. Ich sah Jan Luft holen, trat ihm aber unter dem Tisch rechtzeitig gegen das Bein. Und er verstand und schwieg.
„Wenn ihr euer Mädchen finden wollt“, sagte Nine zu Sören, „dann lass uns miteinander reden.“
Sören sah mich fragend an, und ich nickte. John wollte auch mit, aber Nine lehnte entschieden ab, und ich fand es auch besser so.
Sie gingen hinaus auf die Gasse, und nach einer Weile kam Sören zurück. „Für zwanzig Dollar wird er uns sagen, wo sie ist. Ich glaube, wir sollten zahlen.“
„Ist seine Story glaubhaft? Hat er dir einen Hinweis gegeben?“
„Das nicht, aber ich habe den Eindruck, er weiß wirklich, wo sie ist. Sie ist nicht hier in der Stadt.“
„Nicht einen Cent für diesen Verbrecher!“, protestierte Jan-Stellan so laut, dass Nine ihn hören konnte. Zugegebenermaßen hörte sich das nach Angriff an. Daraufhin stellte sich Nine in den Hoteleingang, fluchtbereit, und warnte uns: „Das fette Schwein macht nur eine Bewegung und ihr erfahrt für immer nichts von mir.“
Wir kamen zu einer gespaltenen Entscheidung. Einerseits waren wir uns einig, dass wir diesem miesen Erpresser seine zwanzig Dollar geben sollten. Andererseits mussten wir sicherstellen, dass er uns nicht linkte. Vielleicht gelang es uns auch, ihn hereinzulegen – aber all das konnten wir nicht groß und breit diskutieren, sondern wir flüsterten es uns in Stichworten zu und ließen dazu unsere Augen sprechen.
Das Ergebnis war, dass Nine und ich den Geldschein vor dem Hoteleingang gemeinsam festhalten sollten, bis er uns gesagt hatte, wo Svea war. Er verlangte von mir, dass ihm niemand Gewalt antat oder ihm nachstellte. Wir dürften ihm erst nachlaufen, wenn er um die Ecke gebogen war. Also eine typische Piratenverhandlung.
Während wir nun den Geldschein hielten und er sich bereits in Hau-ab-Stellung brachte, lächelte er mich süffisant an und sagte: „Deine beiden Freunde aus Frankfurt, die Banker, die ihr in Casablanca getroffen habt … nur kurzes Treffen mit Svea und denen, Visitenkarten und so ... sie trafen sich später mit ihr in Marrakeschs First Class Hotel. Sveas Idee, nicht ihre … Ich sollte für sie arrangieren neues Treffen in Casablancas Miramar. Dort jetzt!“ Er riss mir den Schein aus der Hand und rannte wie ein Windhund davon.
Ich war platt. Meine zwei Freunde aus Frankfurt? Das war Quatsch mit Soße. Wir hatten auf unserem zweiwöchigen Trip durch die marokkanische Wüste auch Casablanca besucht und die Filmstätten aufgesucht. Wir hatten tatsächlich zwei Frankfurter in unserem Hotel getroffen, mit denen wir uns freundschaftlich unterhalten hatten. Sie hatten uns großzügig zum Abendessen eingeladen. Von einem hatte ich sogar eine Visitenkarte ins Portemonnaie gesteckt.
Ich hatte damals kurz den Eindruck gewonnen, dass sich beide für Svea interessierten – dass eine heimliche Verabredung stattgefunden hatte, war mir völlig entgangen. Ich war sprachlos.
Wir gingen zurück ins Hotel, ich kramte die Visitenkarte hervor: Dieter Hofmann, Prokurist, Deutsche Bank, Casablanca, Büro, Rufnummer – so lag das Kärtchen vor mir auf dem Tisch.
Gerd und Wolle ergriffen die Initiative. „Wir buchen einen Flug nach Casablanca.“ Sie sahen mich an: „Wer soll mit?“
Natürlich John. „Ich zahle dir den Flug“, sagte ich zu ihm und man sah ihm die Erleichterung an. Ich legte Wert darauf, dass auch Gerd und Wolle mit uns flogen. Die beiden hatten genug Knete, um ihr Ticket zu zahlen; der Flug kostete uns Westeuropäer nicht die Welt, pro Person hin- und zurück nur 36 Dollar. Ich drehte mich nach Stella, ihren beiden Liebhabern und nach Sören um. „Was haltet ihr davon?“
„Ich komme auf alle Fälle mit“, sagte Stella und die drei Männer nickten zustimmend. „Aber wir sollten in Wolles Bulli fahren – wer weiß, wofür wir dort vielleicht einen Wagen brauchen.“ Wolle war einverstanden.
„Zuerst rufe ich den Typen von der Bank an“, sagte ich und ging zur Rezeption. Der Anruf war für mich blanker Horror. Ich erreichte den Banker in seinem Büro, und als er hörte, was ich zu sagen hatte, vernahm ich lautes, fast höhnisches Lachen. „Guter Mann, nun machen Sie sich keine Sorgen, oder sind Sie gar ihr Vater? Sie ist doch nur eine Nutte. Wir nahmen sie über Nacht mit ins Hotel und hatten viel Spaß zu dritt. Natürlich bezahlten wir sie für ihren Job und schickten sie mit zwei anderen Männern weiter nach Tanger. Sie wollte das so. Es war ihr eigener Wille, wirklich! Sie war völlig okay … Grand Hotel, Tanger.“
Der Flug nach Tanger war fast doppelt so teuer, aber immerhin bezahlbar. Die Autostrecke betrug für Stella und die drei Jungs mindestens sechs Stunden. Wir verabredeten uns dort für den nächsten Tag zwischen 14 und 15 Uhr. In der Zwischenzeit würden wir versuchen, Svea ausfindig zu machen. Gerd, Wolle, John, Svea und ich würden anschließend – so war der Plan – mit Wolles VW-Bus zurück nach Deutschland fahren. Die vier Hippie-Freunde konnten per Bus zurück nach Marrakesch. Doch alles sollte völlig anders kommen.
Gerade wollten wir uns trennen und zum Flughafen fahren, als ich einen Gedanken hatte: „Wer von euch kennt sich in Tanger aus und hat dort vielleicht sogar irgendwelche Bekannten?“
Der einzige, der sich meldete, war Sören. Also bat ich Wolle, seinen eigenen Bus zu fahren und Stella sowie ihre zwei Liebhaber mitzunehmen, und wir nahmen dafür Sören im Flieger mit; vielleicht konnte er uns in der Zwischenzeit behilflich sein, zumal er angab, dort einen Bekannten bei den Bullen zu haben, den er mal geschmiert hatte.
Stella hatte wenig Hoffnung, Svea in Tanger zu finden, schließlich hatte sie selbst sich bei der Einreise nur kurz in dieser unübersichtlichen Stadt aufgehalten. „Da kann so Vieles geschehen; da sind so viele schräge Typen unterwegs.“ Dann telefonierte sie mit dem Grand Hotel und gab sich als eine Freundin von Svea aus.
„Ja, zwei Männer haben hier mit einer Svea Lindström vor drei Tagen gebucht; aber heute früh sind sie ausgecheckt … Nein, keine Deutsche, keine Nadelstreifen, keine Banker aus Casablanca – zwei ziemlich üble stadtbekannte Typen aus Tanger. Aber wir konnten sie nicht hindern, in unserem Hotel zu übernachten. Finden? Ich glaube schon, dass man sie hier finden kann.“ Stella sagte, sie würde am nächsten Mittag dort sein, zuvor aber kämen europäische Freunde von Svea, die sie im Auftrag ihrer Familie suchten. Sie sagte ihm unsere Namen.
Ich überlegte. Der Mann von der Hotelrezeption konnte uns vielleicht mit viel Glück Anhaltspunkte geben, mehr aber nicht. Suchen konnte er nicht.
„Sören“, sagte ich, „vielleicht ist es besser, wenn du deinen Bekannten bei den Bullen anrufst, damit er schon heute weiß, was Sache ist. Ich habe das Gefühl, dass jede Minute zählt.“
Bis Sören den verantwortlichen Beamten ausfindig gemacht hatte, dauerte es geschlagene vierzig Minuten und kostete ein Telefonvermögen von rund 30 Dollar – die Hälfte des Flugtickets.
„Hassan, wir haben ein Problem. Der Name ist Svea Lindström, Dänin, zweiundzwanzig Jahre alt ...“
„Einundzwanzig“, korrigierte Stella.
„Okay, dann eben einundzwanzig, sehr schöne attraktive Erscheinung, schlank, blond, langes Haar. War mit zwei polizeibekannten Typen …“
„Stadtbekannten!“, korrigierte Stella erneut.
„Wie der Rezeptionist vom Grand Hotel sagt: Sie war mit zwei stadtbekannten Typen dort für drei Tage. Haben heute früh das Hotel verlassen. Wir müssen sie dringend finden, Hassan. Die Dänin schwebt in Lebensgefahr.“
Wir wussten das zwar nicht sicher, aber ich hielt Sörens Begründung für absolut angebracht und klopfte ihm nach dem Telefonat auf die Schulter. Inzwischen glaubte ich, dass er sich an Sveas Schicksal mitschuldig fühlte. Gut so, dachte ich.