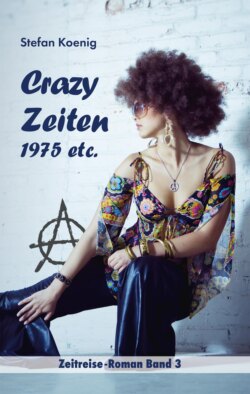Читать книгу Crazy Zeiten - 1975 etc. - Stefan Koenig - Страница 7
Ich komm‘ aus der Wüste aus Stahl & Glas
ОглавлениеMein neu begonnenes Studium der Politikwissenschaften am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin brachte es mit sich, dass ich mich ab dem Wintersemester neben meinem zukünftigen Prüfer für das sogenannte Begabtenabitur, Prof. Wagner, auch für die anderen Professoren und ihre Lehrschwerpunkte interessierte.
Die Vorlesungen von Prof. Elmar Altvater am OSI waren immer überlaufen, schließlich ging es bei ihm um konkrete Kapitalismuskritik, wissenschaftlich ausgedrückt: um die „Kritik der Politischen Ökonomie“. Das fanden alle „OSIaner“ interessant und revolutionär. Er untersuchte die kapitalistische Waren- und Geldzirkulation, staatliche Interventionsmechanismen, die Akkumulation des Kapitals, also seine Zusammenballung zu Monopolen. Das war für uns junge Studenten Neuland, wenngleich zu diesen Themen bereits früher das eine oder andere Buch gelesen worden war. Aber so im Detail wie bei Elmar, wie wir ihn nennen durften, hatten wir das nie betrachtet.
Professor Peter Grottian lehrte in Sachen „Staats- und Verwaltungsforschung“, „Neue soziale Bewegungen“ und „Wirkungsmechanismen der Berufsverbote“. An Kampagnen gegen die Berufsverbote nahmen fast alle Institutsstudenten teil, natürlich auch ich; da wollte ich nicht unbedingt noch eine Wissenschaft draus machen. Mehr interessierte ich mich für Staatstheorien – wie, wann und unter welchen Umständen war der erste Staat entstanden, ab wann ist ein Staat ein Staat, wie war der historisch ewig lange Schritt von der Stammesgesellschaft zur staatlich organisierten Gesellschaft und was waren die Folgen für das Individuum wie für die Gemeinschaft?
Prof. Johannes Agnoli war ein bunter Vogel und bot uns seine plausiblen Theorien über die Heimtücke des Parlamentarismus an. Wir fraßen die Theorie gern, die er uns vorwarf, denn die Praxis sprach für sie. Seine Vorlesungen stützten sich in der einen oder anderen Form auf sein Hauptwerk, das die Studentenbewegung maßgeblich beeinflusst hatte: Die Transformation der Demokratie.
Er vertrat die These, dass sich das Parlament zu vor- oder antidemokratischen Formen zurückgebildet habe. Statt den Volkswillen zu repräsentieren, seien die Parteien durch Lobbyismus zu reinen Befehlsempfängern degeneriert – oder wissenschaftlich ausgedrückt: Die zum Teil des Staates gewordenen Parteien transformierten die Direktiven des von einer Wirtschaftsoligarchie dominierten Staatsapparats in öffentliche Meinung.
Bei so viel Theorie mussten Doro, die oft mit mir die gleichen Vorlesungen besuchte, und ich durchschnaufen. Wir brauchten Abwechslung. Wir fuhren mit Tommi und Rosi zu der mit Rolf befreundeten Rio Reiser Band ans Tempelhofer Ufer. Es war seit einigen Wochen das erste Mal, dass wir sie wiedersahen. Die häusliche Situation am T-Ufer hatte sich ein Jahr zuvor zugespitzt. Rios Liebling, der durchgeknallte Andy, arbeitslos und nahe am Stricher-Strich, wurde immer unberechenbarer. Er ließ die Streitpunkte mit Rio derart eskalieren, dass es für Rio und seine kreative Arbeit unerträglich wurde. Rio trennte sich von ihm und warf ihn raus.
Für die ganze Band war es ein Trennungsabschnitt, alle waren damals mit ihren Nerven am Ende gewesen. Jetzt saßen wir zusammen in ihrer Mischmasch-WG aus Tonstudio und Kommune und hörten sie mit neuer Schlagzeugbesetzung – es war Werner Götz – den Song Durch die Wüste neu einüben:
Ich komm aus der Wüste aus Stahl und GlasIch komm aus der Wüste aus Angst und HassWo die Menschen verdursten auf der Suche nach LiebeKrank vor Verzweiflung und vom Warten müde
Ich komm aus dem Land der vergifteten StraßenWo man den Tag verkaufen muss, um sorglos zu schlafenWo das Leben schneller ist als ein Herz schlagen kannUnd tausend Lügner sprechen bevor einer die Wahrheit sagen kann
Ich komm vom Planeten der verzweifelten GötterIch komm vom Planeten der reichen BettlerWo die Liebe verkauft wird und der Hass verschenktWo man die Mörder belohnt und die Heiligen henkt
Hilf mir, hilf mir!Zeig mir den Weg hier rausLass mich nicht hängen, gib mir 'ne AntwortZeig mir den Weg hier rausHilf mir!
Die Jungs machten eine Pause, bevor sie den Song noch einmal probten.
„Weshalb habt ihr euch damals getrennt?“, wurde Rio von Rosi gefragt. Ich hatte darüber bereits schon einmal mit ihm gesprochen, wollte Rosi aber nicht in ihrem Fragebedürfnis bremsen.
„Wegen der vielen politischen Anforderungen.“
Nikel ergänzte: „Wegen der vielen unbezahlten Auftritte.“
„Und wegen der enormen Kraft, die die Auftritte kosteten“, sagte Lanrue.
„Aber auch wegen der hohen Erwartungen unserer Fans. Das ist nämlich ein enormer Druck.“ Schlotterer hatte sich ein Sixpack aus dem Kühlschrank geholt und bot uns etwas an.
„Auch wegen des Verpflichtungsgefühls, weitere Songs für die Befreiung der Welt von all den Beschwernissen komponieren zu müssen“, sagte Rio. „Weshalb getrennt? Kurze Antwort: Wegen allem also.“
Rio war nach Irland gegangen, auch Lanrue verließ Berlin. Als jedoch nach einiger Zeit die anderen Bandmitglieder, Schlotterer und Nikel, aus Marokko und Ibiza nach Westberlin zurückkehrten, hatten sie im Sommer 1974 die Wiedervereinigung der Scherben beschlossen. Alle Vier wollten ein Zeichen gegen die politische Perspektivlosigkeit setzen, denn das allgemein vorhandene Gefühl der rebellierenden Generation widerspiegelte etwas sehr Unbefriedigendes: Die zunehmende Zersplitterung in Grüppchen und Untergruppen, von denen sich jede und jeder vom anderen abgrenzte.
Auf dem Rückweg sangen Doro und Rosi im Auto den Song mit den Zeilen: »Ich komm aus der Wüste aus Stahl und Glas/Ich komm aus der Wüste aus Angst und Hass«.Da erzählte uns Tommi im Auto noch eine weitere seiner posttraumatischen Storys über einen seiner ihm vorgesetzten Post-Tyrannen. Zur Beerdigung seiner Großmutter war Tommi nach Frankfurt gefahren. Den Termin hatte er total kurzfristig erfahren und hatte sich kurz entschlossen mit Rosi auf die Socken gemacht.
Als Tommi zwei Tage später zurückkam, brachten sie ihn zum Büro des gewerkschaftlichen Personalrats namens Schöll in eines der hinteren Zimmer neben dem Personalbüro.
„Lassen Sie sich mal ansehen, Lettau.“
Er sah Tommi an.
„Ohje ohje, Sie sehen übel aus. Am besten nehme ich gleich einen Schluck Klosterfrau Melissengeist.“
Das Gesöff grassierte damals unter den kleinen Gewerkschaftsbossen, wenn sie in den Betrieben nicht allzu offen als Alkoholiker erkannt werden wollten. Die Typen waren allesamt weiter rechts als die rechten Sozialdemokraten, die ihren Rechtsdrall mit dem aus ihrer Sicht nötigen Antikommunismus begründeten.
Und tatsächlich, er machte ein Fläschchen auf und nahm einen kräftigen Schluck. Es roch allerdings nach billigem Weinbrand.
„Also gut, Herr Lettau, wir hätten gerne gewusst, wo Sie die letzten beiden Tage gewesen sind.“
„Ich habe getrauert.“
„Getrauert? Worüber getrauert? Dass man sie nicht zum Oberamtmann befördert?“
„Beerdigung. Meine Großmutter. Einen Tag hinfahren zur Trauerfeier. Einen Tag Rückfahrt mit Nachtrauer.“
„Aber Sie haben hier nicht einmal angerufen, mein Wertester!“
„Stimmt.“
„Und ich will Ihnen mal was sagen, Lettau, und das bleibt unter uns.“
„Bitte.“
„Wenn Sie nicht anrufen, dann wissen Sie, was Sie damit ausdrücken?“
„Hm. Weiß nicht.“
„Damit sagen Sie: »Ich scheiße auf den Kollegen Beckstein und auf die Deutsche Post!« Tja!“
„Glauben Sie?“
„Und, Herr Lettau, Sie wissen auch, was das heißt?“
„Nein, was heißt das denn?“
Er beugte sich über seinen schweren Schreibtisch, wobei einige Gewerkschaftszeitungen zu Boden flatterten, und kam Tommi ganz nahe: „Das bedeutet, dass die Post auf Sie scheißen wird!“
Dann lehnte er sich genüsslich zurück und schaute Tommi an.
„Herr Schöll“, sagte Tommi zu ihm, „Sie und Ihr Herr Beckstein können mich mal.“
„Typisch linksradikal!“, sagte Schöll und erhob seine Stimme.
„Typisch rechtsradikal, und das als Gewerkschaftsfunktionär! Arbeiterverräter!“
„Werden Sie jetzt nur nicht frech, Tommi! Ich kann Ihnen das Leben hier zur Hölle machen.“
„Nennen Sie mich bitte nicht Tommi. Das ist meinen Freunden vorbehalten. Wenn Sie sich an meinen Nachnamen erinnern, den Sie vor kurzem noch wussten, dann wäre es jenes Maß an Respekt, das ich von einem Gewerkschaftskollegen erwarte. Dass Sie mich mit Genosse anreden, erwarte ich dagegen nicht im Geringsten!“
„Sie wollen, dass ich Sie respektiere, aber …“
„So ist es. Wir wissen, wo Ihr Auto steht, Herr Schöll.“
„Wir? Wer ist ‚wir‘? Soll das eine Drohung sein?“
„Die Hausbesetzer lieben mich. Ich bringe ihnen gelegentlich Essen aus meiner WG.“
„Die Hausbesetzer lieben Sie?“
„Sie würden für mich alles besetzen, wenn ich Ihnen nur den dazugehörigen Parkplatz zeige. Genau neben Ihrem Wagen, verehrter Herr Schöll, habe ich übrigens meine Freundin vor einer Woche gepimpert.“
„Schon gut, schon gut. Wir kommen vom Thema ab. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit zurück.“
Er gab Tommi eine Bescheinigung, dass er bei ihm gewesen war und dass alles seine Ordnung hatte. Er machte sich tatsächlich Sorgen, der arme Suffkopp. Es war verständlich. Einem dieser Oberaufpasser hatte man kürzlich Sekundenkleber in die Türschlösser seines PKW gespritzt. Einem anderen hatten sie von Neckermann irgendwelche unnützen Versanddinge zuschicken lassen, und einem völlig unausstehlichen Menschenschinder hatten sie nachts eine übergezogen.
„Mensch Tommi, das hätte ich dir als bekennendem Christ nicht zugetraut“, sagte Doro, während Tommi aufs Gas drückte, denn es war schon zwei Uhr morgens.
„Auge um Glasauge, Zahn um Gebiss!“ antwortete Tommi und lachte. Eine Viertelstunde später setzte er uns in der Lützenstraße ab. Kurz darauf lag ich mit Doro in unserem kuscheligen Bett. Ich war mir sicher, dass auch er schon bald mit seiner Rosi auf ihrem Matratzenlager liegen würde. Wahrscheinlich hielten sie es wie wir mit dieser Nacht – und füllten sie mit Liebe. Denn der Herr sprach: „Liebet euch!“
Der Herr schien aber auch zu sagen: „Die Kapitalistenklasse liebt die Diktatur des Kapitals und verachtet die Liebe!“ Zu dieser Überzeugung konnte man kommen, wenn man die tat las, deren Chefredakteur noch immer Emil Carlebach war, der ehemalige Vizepräsident des Internationalen Buchenwald-Komitees.
In ihrer aktuellsten Ausgabe erschien – quasi als Ergänzung zu meinem Rückblick auf den Putsch in Chile – eine vertrauliche Studie des Frankfurter Hoechst-Konzerns, der als führendes deutsches Chemieunternehmen in Chile mehrere Niederlassungen betrieb: „Der lang erwartete Eingriff des Militärs hat endlich stattgefunden.“ Und: „Die Regierung Allende hat das Ende gefunden, das sie verdiente.“
Das waren Kernsätze, die mich wütend machten. Nicht tausende, nein zigtausend Tote, die brutale Vergewaltigung der Demokratie, die Errichtung einer Militärdiktatur, die unverschämt offene Einflussnahme einer fremden nordamerikanischen Macht auf ein freies südamerikanisches Land, der Triumph illegitimer roher Gewalt – und das auch noch im Namen von „Recht und Freiheit“ – das brachte das Fass zum Überlaufen. Was ich las, ließ auch meinen Freunden die Haare zu Berge stehen: Am 17. September, gleich nach dem Putsch, hatte der Repräsentant von Chemica Hoechst Chile in Santiago an die wirtschaftspolitische Abteilung des deutschen Vorzeige-Konzerns einen achtseitigen Bericht „Betr.: Regierungswechsel in Chile“ geschickt.
Darin wird der blutige Putsch ausdrücklich begrüßt und geschildert: „Am 13. abends stand bereits einwandfrei fest, dass der Staatsstreich mit relativ geringen Verlusten an Material und Menschenleben – wir schätzen 2.000 bis 3.000 Tote – gelungen war. Wir sind überzeugt davon, dass sich Chile unter einer energischen, autoritären, intelligenten, nicht von Politikern, die nur ihren Parteiinteressen dienen, beeinflussten Führung, sehr bald erholen wird. Die Substanz des Volkes ist eine der besten Lateinamerikas, das hat auch der wirklich heroische Widerstand der Zivilbevölkerung – und ganz besonders der chilenischen Frau – gegen das marxistische Regime bewiesen.“
Gemeint waren die Töpfe schlagenden Frauen der Oberschicht, die es sich nicht nehmen ließen, wochenlang täglich mit ihrem Kochschlagzeug durch die wichtigsten Städte zu ziehen, um auf ihren angeblichen Hunger aufmerksam zu machen. Tatsächlich versuchten die Falken im Weißen Haus, das Wirtschaftsleben Chiles unter Allende zu erdrosseln, plumper Wirtschaftskrieg. Aber wenn eine Klasse darunter litt, dann gewiss nicht die Oberschicht, die mit Schwarzhandel dem Land zusätzlichen Schaden zufügte.
„Chile wird in Zukunft ein für Hoechster Standorte und Produkte noch interessanterer Markt sein“, schloss das vertrauliche Papier.
„Geld regiert die Welt“, sagte Doro. „Und deshalb müssen wir uns über das Geldsystem schlau machen.“
Der Herbst ging mit vielen politischen Vorlesungen, ökonomischen Seminaren und philosophischen Arbeitsgruppen ins Land. Doro und ich waren in diesen Dingen eins, eine unzertrennliche Einheit. Nur ihre Germanistik-Vorlesungen und Seminare ließ ich aus, während sie sich weigerte, die langweiligen Vorlesungen meines zukünftigen Abitur-Prüfers zu besuchen. Prof. Wagner hatte ich absichtlich nicht darüber aufgeklärt, dass ich lediglich so etwas wie ein Gasthörer war, denn ich studierte lediglich mit sogenannter »Kleiner Matrikel«. Meine Studienscheine würden mir nur anerkannt werden, wenn ich mich nach bestandener Begabtenprüfung mit »Großer Matrikel« einschreiben könnte.
Ich fühlte mich gelegentlich unwohl in dieser scheinbar unehrlichen Haut. Wie ein Spion. Aber das genau war ja meine Absicht gewesen: mich auf undercover-Art vertraut zu machen mit jenen Bedingungen, unter denen ich nach vier Semestern meine Abi-Prüfung ablegen musste. Ich verdrängte mein ungutes Gefühl mit der Tatsachenfeststellung, dass dieses Begabten-Abi nichts anderes war als ein willkürliches Verfahren im Stil des Russischen Roulettes – und ich war nun mal kein Spieler-Typ.
Ich war und blieb Sternzeichen Jungfrau, fernab jeglicher Zockermentalität. Doro hatte mir ein süßes kleines Horoskop-Büchlein, dunkelblau eingebunden, zum Geburtstag geschenkt: „Die gründliche und verlässliche Jungfrau ist das solideste aller Sternzeichen. Sie steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Wer so berechenbar ist, der ist Gold wert. Herzlichen Glückwunsch!“
Na ja, wenn ich mir so anschaute, wer noch alles Jungfrau war, schmolz mein insgeheimer Stolz doch etwas zusammen. Auf der Haben-Seite standen auf alle Fälle Sean Connery, Bruce Springsteen, Romy Schneider, Oskar Lafontaine, Freddy Mercury und Johann Wolfgang von Goethe – er unter anderem wegen der Frankfurter Grünen Soße, die Lollo so lecker zubereiten konnte. Auch ein neuer Jungfrauen-Schriftsteller tauchte am Horizont auf und veröffentlichte im Doubleday-Verlag seinen ersten Knüller. Der Knüller, den ich auf Englisch verschlungen hatte, hieß „Carrie“. Und der Autor hieß Stephen King. Wie stolz ich da war, dass ich Stefan Koenig hieß.
Auf der Soll-Seite stand der fußballernde Emporkömmling Franz Beckenbauer, der sich aus meiner Sicht wie ein neureicher Karrierist aufführte. Er war mir einfach nicht sympathisch. In meinem persönlichen Jungfrauen-Soll standen aber auch Sophia Loren, Richard Gere und Reinhold Messner, mit denen ich partout nichts anzufangen wusste.
Doro und ich hasteten voller neuer Ideen und sozialistischer Perspektiven durch die beschauliche Adventszeit, die wir als solche kaum wahrnahmen. Überall – das heißt überall in unserem Westberliner und dem uns bekannten Frankfurter Umfeld – war Eigeninitiative angesagt, nicht abwarten bis Väterchen Staat irgendetwas verordnete, gleich selbst anpacken und machen, organisieren, kollektiv arbeiten, mitbestimmen, mitgestalten. Rundum – sogar im Kreise der alten, eher unpolitischen Bekanntschaften – bewegte sich einiges, was wir so nicht erwartet hätten.
Wir bekamen Anrufe und Besuche von ehemaligen Mitschülern, die vor sechs Jahren bei der 68er-Bewegung – es war für uns Jungen eine Ewigkeit her – noch äußerst zurückhaltend gewesen waren. Und jetzt schwangen sie äußerst revolutionäre Töne. Oft schienen uns diese tönenden Thesen auf tönernen Füßen zu stehen, erschienen überzogen und unrealistisch. Doch wir selbst schwebten zu großen Teilen noch im siebten Himmel der gesellschaftlichen Umgestaltung, und so war uns jede irrwitzige Diskussion lieber als das Schweigen der Lämmer.
Zuhause veränderte sich in diesen Monaten Tante Anneliese, die wir auch Dada nannten. Die Schwester meiner Mutter musste sich ins Zeug legen, um ihre Familie geordnet über den Tag zu bringen. Onkel Karl, der alte, einst quickfiedele Nazi, saß nach einer missglückten Bandscheiben-Operation nun schon das fünfte Jahr querschnittsgelähmt im Rollstuhl und machte seiner Frau das Leben zur Hölle. Lollo, die oftmals nach Wiesbaden fuhr, um ihrer Schwester zu helfen, hatte von dort nichts Angenehmes zu berichten.
Zum ersten Mal in ihrem Leben übernahm Dada materielle Angelegenheiten, ohne jede Hilfe außer der meiner Mutter. Mit ihrem Mann konnte sie nicht mehr rechnen. Sie erwachte nun aus einer langen finanziellen Geborgenheit, in der sie bislang frei von Verpflichtungen und Sorgen, immer wohlbehütet und umhegt, in der größten Behaglichkeit hatte leben können.
Onkel Karl verfiel auf den Trick, dass ihm nichts, was er aß, bekam, außer wenn Dada es gekocht hatte. So verbrachte sie einen guten Teil des Tages in der Küche. Zwar waren sie über Karls ehemaligen Direktorenposten bei der Allianz gut abgesichert, doch die laufenden Kosten ihrer Wiesbadener Sonnenberg-Villa waren hoch. Zudem waren neuerdings ganztägige Haushaltshilfen sozialversicherungspflichtig und somit überraschend teuer geworden. Meine Tante wurde die Krankenpflegerin ihres Mannes. Sie musste ihn waschen, seine Verbände wechseln, wenn er sich wundgesessen hatte und musste ihn auf die Bettpfanne setzen.
Er wurde von Tag zu Tag jähzorniger und despotischer. „Steck mir ein Kissen dahin“, verlangte er, „nein, weiter oben hab‘ ich gesagt, bring‘ mir Wein, nein, Weißwein hab‘ ich gesagt, mach‘ das Fenster zu, mach‘ es auf, hier tut es mir weh, ich habe Hunger, mir ist heiß, kratz‘ mich am Rücken, weiter oben, nicht so fest, viel zu weich, mach’s mal richtig, warum muss ich immer alles sagen!“
Wenn Dada rund um die Villa den herbstlichen Garten pflegte, ließ er sich zuvor von seinem Sohn Gerd, wenn dieser zufällig zuhause war, an ein Fenster bringen. Von dort aus konnte er seine Frau beobachten und – kochend vor Wut über seine erzwungene Unbeweglichkeit – seine Befehle hinaus schreien. Als Lollo mir davon berichtete, drängte sich mir die Frage auf, ob das, was jetzt aus ihm herausbrach, seiner damaligen Rolle als SS-Standartenführer zuzuschreiben war. Ich blieb mit dieser Frage für immer und ewig alleine.
Tante Anneliese fürchtete ihn schließlich weit mehr als früher den gesunden und herrischen Mann, der sie mit seinem Macho-Geruch, seiner unterschwelligen Gewittersturmstimme, seinem erbarmungslosen inneren und äußeren Krieg gegen alles, was ihm links schien, seiner Überheblichkeit als großer Allianzmanager, der immer seinen Willen durchsetzte, erst fasziniert und zuletzt genervt hatte. Schließlich hatte er in ihren persönlichen Neuaufbruch nach der „unnötigen schändlichen Niederlage“, wie sie als Ex-BDM betonte, eine Falle eingebaut, wie ihr schien. Meine Mutter war der Ansicht, dass Dada die Krankheit ihres Mannes als Bestrafung durch eine höhere Macht betrachtete.
Als wir unter uns waren, meinte Doro: „Deine Tante ist zweigeteilt. Sie teilt einerseits Onkel Karls reaktionären Ansichten, ist allerdings in der Realität der faschistischen Niederlage angekommen. Nach dem Krieg bewunderte sie seine neue Funktion und den neuen sozialen Rang und war ihm zugleich als herrischem Aufsteiger ausgeliefert. Nun sieht sie, wie sich andere Frauen aus der Vormundschaft der Männerwelt befreien. Eine ziemlich vertrackte Sache für diese Frau.“
„Ich glaube, sie ist im tiefsten Inneren sehr verzweifelt. Sie wird ihn hassen, was sie aber nicht zugeben wird, noch nicht einmal vor sich selbst. Es widerspricht ihrer eingefleischten Führer-wir-folgen-dir-Mentalität. Einen Mann im Rollstuhl sitzen lassen – das macht man nicht, auch wenn er noch so ekelig ist. Der arme Gerd!“
Ich bedauerte meinen Cousin, der immer schon ein unterwürfiges Kerlchen war, geduckt und schleimend. Er musste das alles mitansehen, das eheliche Drama live erleben. Vielleicht würde er selbst bald heiraten und von seiner Ursprungsfamilie den Absprung schaffen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass konservative Familienstrukturen die eher zurückhaltend veranlagten Familienmitglieder in unsichtbare Fesseln zwangen. Da lobte ich mir meine kleine sozialistische Freiheit.
Doro und ich streiften jetzt die negativen Eindrücke über „die Alten“ ab, denn es weihnachtete sehr; lieber nahmen wir an den üblichen christ-kindlichen Ritualen unserer Eltern teil. Als Kinder fanden wir das toll, aber jetzt schien es uns wirklich ein wenig infantil. Da gab es das umständlich-stilvolle Verpacken der Geschenke und das Geschenke-Versteckspiel vor Heilig Abend. Dann gab es das auf der Treppe verstreute Lametta als Beweis für die Existenz der dahergeflogenen Engelchen, die ihr Silberhaar verloren hatten.
Da war das von den Eltern handgeschüttelte Glockengeläut, gefolgt vom Plattenspieler, der Rille für Rille „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Ihr Kinderlein kommet“ abspielte. Beide Lieder, wie auch die darauffolgenden, wurden von einigen familiären Gesangsgrößen mitgesungen. Otto, mein Vater, war der treibende Bariton; in Doros Familie war es die Mutter, sie übernahm die Rolle der Vorsängerin, während Doros Vater Helmut sich mehr im Sprechgesang übte, ein früher Rapper.
Schließlich kam zu guter Letzt der Fotoapparat mit den teils defekten, teils funktionierenden Blitzlichtern zum Einsatz, gefolgt vom Streit um die richtige Hintergrund- und Motivzusammenstellung. Dann kam der von den unfreiwilligen Fotomodellen halb aus dem Christbaumständer gedrückte Weihnachtsbaum ins Spiel, der hart am Kippen war und schnell wieder ins rechte Lot gebracht werden musste, bevor die Wachskerzen den Baum zum Brennen brachten und das erste Foto geschossen wurde. Dann musste nur noch der Selbstauslöser funktionieren, was selten geschah, sodass die ersten Kerzen am Baum erloschen und das Spiel von vorne begann.
Da wir nun schon in Frankfurt zu Gast waren, besuchten Doro und ich an Silvester den Club Voltaire, wo wir auf gute alte Frankfurter Freunde trafen – Hörbi und Chrissi, die nun auch in Berlin studierten; Pit und Gaby, die sich auf ihren Lehrer- und Erzieherberuf vorbereiteten; Kurt Trautmann, unser Buchhändler mit den Zauberbeziehungen, der uns alle Bücher dieser weiten neuen Welt besorgen konnte; und da saßen auch Günter Amendt und Meise, meine ehemaligen Helfer in der Not, als ich damals aus meinem Elternhaus geflüchtet war.
Zwei SPD-Politiker, Heiner Halberstadt und mein ehemaliger Mitschüler Diether Dehm, standen im Vorraum und unterhielten sich über irgendwelche Musiklabels und neue Songs für den sozialdemokratischen Kommunalwahlkampf. Ich hörte etwas von Westend-Hausbesetzungen und dass man das Feld nicht den ultralinken Kleinbürgern um Joschka Fischer überlassen dürfe.
Im Club, hinter dessen Tresen immer noch Else das Kommando mit Liebe und Bestimmtheit führte, ging es inzwischen etwas weniger exotisch zu, als noch zu meinen Gammler-, Provo- und Hippiezeiten. Zwar gab es einen Weihnachtsbaum, doch er war nicht mehr ganz so revolutionär geschmückt wie Ende der 60er-Jahre. Keine Märtyrerbilder von Che, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Patrice Lumumba und anderen Revolutionären und Pazifisten schmückten die Fichte, sondern brave Kugeln in mattem Rot und elektrische Kerzen.
Wir hörten einen interessanten, Gott sei Dank recht kurzen Vortrag zur Rolle des Jesus von Nazareth als einem Sozialrevolutionär seiner Zeit. Sein Leben und seine wesentliche Thesen wurden in Beziehung zu Sozialrevolutionären der Neuzeit gestellt. Der Referent war Pfarrer irgendeiner Friedenskirche; die Diskussion war etwas lahm. Danach wurde Rockmusik aufgelegt und wild getanzt und gefeiert. Kurz vor Mitternacht stellte Else auf Radio um und die Sekunden wurden gezählt.
Dann brach das Jahr 1975 an, und Doro und ich verabschiedeten uns von den Freunden und verließen den Club etwas früher als gewohnt, denn wir wollten schon am nächsten Tag fahren.
Bevor Dodo und ich uns in unsere revolutionäre Westberliner Enklave verabschiedeten, fragte ich meine Eltern, ob im abgelaufenen Jahr die Bundeswehr wieder einmal die pfiffigen Militärpolizisten bei ihnen vorbeigeschickt hatte, um pünktlich im Rahmen meiner heimatlichen Besuche nach mir zu fahnden.
„Zuletzt waren sie anlässlich deines Osterbesuchs aufgekreuzt“, sagte Mutter. „Danach nie wieder.“ Die Feldjäger hatten es offensichtlich aufgegeben, mich ihren Blutsbrüdern, den Gebirgsjägern, ausliefern zu wollen. Dabei hätte mich das rein sportlich gereizt, denn ich war ein begeisterter Skifahrer. Den enttäuschten Sesselfurzer im Kreiswehrersatzamt, der jahrelang – wohl mit zunehmend depressiver Verstimmung – die armen Militärpolizisten ergebnislos nach mir hatte suchen lassen, hätte ich ja gerne mal kennen gelernt.