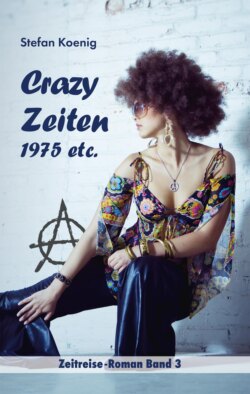Читать книгу Crazy Zeiten - 1975 etc. - Stefan Koenig - Страница 9
Airport Marrakesch
ОглавлениеAm Airport Marrakesch-Menara gab es internationale Zeitschriften und sogar einige Tageszeitungen. Es war jetzt schon Ende Februar und zuhause in deutschen Landen, wie in der übrigen Welt, hatte sich das „Hamster-Rad der Geschichte“ unerschütterlich weitergedreht. Die RAF-Häftlinge hatten ihren Hungerstreik nach fünf langen Monaten endlich abgebrochen, obwohl das Ziel der Aktion, die Aufhebung der Isolationshaft, nicht erreicht worden war. John konnte verstehen, dass manche lieber sterben wollten, als einer ewig langen Isolationsfolter ausgesetzt zu sein.
Ich konnte es nicht verstehen, aber vielleicht ist es etwas ganz und gar anderes, wenn man wie John bereits in einer ähnlichen Situation war.
In diesen Tagen wurde Nordzypern von der Türkei besetzt. Fast wäre die schöne Insel Ziel einer Hippie-Tour meiner ehemaligen Frankfurter Freundesclique geworden. Pit und Gaby, Veit und Eva, Nobbi und Nelli, Hajo und Geli – sie alle hatten eine Zeitlang von einem gemeinsamen Leben in einem Hippiedorf auf Zypern geträumt. Doch die Träume waren schon vor Zyperns Teilung dahingeschmolzen. Bis auf Pit und Gaby waren alle ins farbenprächtige wilde Westberlin gezogen.
Die Proklamation eines Türkischen Föderationsstaates Zypern durch die Besatzungsmacht und die damit vollzogene Teilung der schönen Insel verhieß für den Frieden auf diesem Eiland nichts Gutes.
Ich freute mich langsam wieder auf zuhause.
Dort empörten sich gerade die selbstbewussten Frauen in Westdeutschland und Westberlin. Das Bundesverfassungsgericht galt in vielen Fällen als Garant unserer demokratischen Verfassungsordnung. Aber ausgerechnet bei diesem Reizthema stellte es sich jetzt gegen den Bundestag, gegen den Souverän des Volkes, der eine tiefgreifende progressive Reform des Abtreibungs-Paragraphen beschlossen hatte. Das Gericht verwarf die Fristenlösung. So blieb die alte Fassung des berüchtigten § 218 bestehen, was die Empörung der Frauen nicht gerade besänftigte. Ein neues Besänftigungsgesetz musste her; weiterhin waren also Abtreibungen verboten, aber immerhin aus medizinischen, ethischen und sozialen Gründen zulässig; ein „Kaugummiparagraph“.
Gegen Ende des Monats – es war die neueste Nachricht, die ich am Zeitungskiosk des Airports lesen konnte, bevor wir nach Tanger abflogen – wurde der Vorsitzende der Westberliner CDU, Peter Lorenz, von Terroristen der „Bewegung 2. Juni“ entführt. Man wollte inhaftierte Gesinnungsgenossen damit freipressen. Die Bundesregierung ließ fünf inhaftierte Mitglieder dieser Gruppe in die Volksrepublik Jemen ausfliegen. Die BILD war dagegen. Der SPIEGEL war dafür. Die Terrorangst griff um sich.
Der Flug nach Casablanca dauerte eine dreiviertel Stunde. Ich bangte um Svea. Johns Nervosität zeigte mir, dass auch er bangte. Es heißt ja, dass Menschen in höchster Not plötzlich an eine höhere Macht glauben, auch wenn sie zuvor völlig ungläubig waren. Vielleicht ging es mir so ähnlich, denn im dahinfliegenden Dämmerzustand zwischen Marrakesch und Casablanca musste ich urplötzlich an meinen Konfirmationsspruch denken:
»Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.«
Bei all der Finsternis in der Welt musste der überwiegende Teil der angeblichen Ebenbilder Gottes offensichtlich aus Ungläubigen bestehen. Zumindest wenn man der Logik – und nicht einem nebulösen Wesen – Glauben schenkte. Beim Konfirmationskaffee hatte mir mein Vater zusätzlich einen weisen Spruch mit auf den Weg gegeben. Genau der fiel mir jetzt wieder ein, obwohl ich Jahre lang – mindestens zehn Jahre lang – nicht mehr an diesen Spruch gedacht hatte:
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr
Kommt von irgendwo ein Lichtlein her:
Dass du es noch einmal zwingst
Und von Sonnenschein und Freude singst
Leichter trägst des Alltags harte Last
Und wieder Kraft und Mut und Glauben hast
Nun gut, dachte ich, ich habe große Hoffnung, dass wir Svea unversehrt finden. Mag uns ein Lichtlein scheinen, mit Kraft und Mut werden wir sie suchen. Ich glaubte an unseren Sucherfolg.
Polizeikommissar Hassan war ein Typ von Polizist, den wir so aus Deutschland nicht kannten. Einem Bakschisch war er nicht abgeneigt; diesbezüglich waren wir von Sören gut informiert. Er hatte einen dunklen Teint, war kräftig gebaut und machte einen verschmitzten Eindruck. Wichtig war mir, dass er unser Anliegen ernst nahm.
„Für Ihre entstandenen Auslagen“, sagte ich und legte ihm ein Briefkuvert mit 50 Dollar auf den Tisch. „Wenn Ihnen weitere Ausgaben entstehen, lassen Sie es mich bitte wissen.“ Er steckte das Kuvert dankend weg.
„Ich werde mein Möglichstes tun.“ Er erzählte uns, dass er bereits bei der Stadtpolizei gedient hatte, als Tanger noch eine Freie Stadt gewesen war.
„Das war einer der schlimmsten Orte der Welt!“, sagte er.
Rauschgift, alle Sorten von Eigentumsdelikten, Körperverletzung, Fälschungen, Morde, Erpressung, erzwungene Prostitution, Menschenhandel, das Drucken von Pässen und Blüten waren offen zugegebene Spezialitäten, und Kommissar Hassan war in diesem Kampf ein ganzes Jahrzehnt lang standhaft gegenüber jeglichem Korruptionsversuch geblieben. Er erzählte uns, wie jedoch einige vorgesetzte Kollegen plötzlich mit großen Limousinen fuhren, sich Eigenheime und Urlaube in Westeuropa leisten konnten. Die Konsequenz, die er daraus zog, sprach er uns gegenüber nicht aus, aber wir kannten sie ja bereits von Sören.
Ich kannte das historische Tanger aus der Literatur. Hier hatte Marokkos berühmtester Schriftsteller, Mohamed Choukri, gelebt und seine Erfahrungen als armer Heranwachsender im Tanger der 1950er Jahre in seinem Roman „Das nackte Brot“ verarbeitet. In den 1960er Jahren und jetzt, Mitte der Siebziger, erlebte die Stadt eine zweite literarische Blüte als „Mekka“ von europäischen und US-amerikanischen Schriftstellern der neu entstandenen Popliteratur. Paul Bowles, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Truman Capote und William S. Burroughs waren nur einige von ihnen.
Nun also gehörte Tanger zu Marokko. Hassans Aufgaben wurden damit zwar leichter, aber nicht um vieles leichter. „Damals“, so sagte er uns in seinem Büro, „wäre Svea wahrscheinlich in eines der besser geführten Bordelle jenseits der Stadtgrenze geschmuggelt worden. Heute gibt es Edelbordelle auch innerhalb der Stadtgrenzen.“
„Konnten Sie schon Ihren Aufenthalt ermitteln?“, fragte ich.
„Jedenfalls hat sie Tanger weder mit dem Flugzeug noch per Fähre verlassen. Ich habe alle jeweiligen Außenposten informiert und wenn sie eines dieser Verkehrsmittel nehmen würde, hätten wir sie. Sie muss irgendwo hier sein. Wir werden sie finden, glauben Sie mir.“
Er machte uns keineswegs falsche Hoffnungen, aber er konnte uns überzeugen, dass er und sein Team sie finden würden, wenn sie überhaupt gefunden werden konnte.
Am nächsten Tag trafen Stella, ihre beiden Liebhaber und Wolle im Hotel ein; den Bulli parkten sie im bewachten Hof, was kostenfrei war. Wir gingen zum Polizeirevier und Stella überreichte dem Kommissar die Kopie eines Passfotos, was sie noch gefunden hatte. Svea hatte es ihr damals am ersten Tag ihrer Bekanntschaft aus Sicherheitsgründen gegeben. „Falls du mich mal suchen musst“, hatte sie damals zu Stella gesagt und dabei gelacht.
„Dich suchen?“, hatte Stella zurück gefragt.
Und Svea hatte geantwortet: „Falls ich mal so zugekifft bin, dass ich nicht mehr nachhause finde und zwei oder mehr Tage verschollen bin.“
Hassan kam mit seinen Ermittlungen am ersten Tag nicht voran. Mit einer weiteren Kopie von Sveas Passfoto unternahmen wir nun zu viert eine Suchaktion. Sören, John, Stella und ich klapperten Bar für Bar ab, in der sich Araber und Touristen aus aller Herren Länder befanden. Sören kannte sich hier erstaunlich gut aus. Endlich räumte er ein, dass er bereits vor zwei Jahren in Tanger in Sachen Rauschgift unterwegs gewesen war. Daher kannte er den einen oder anderen Barbesitzer. Das war uns jetzt eine große Hilfe. Wieder hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass er etwas gutmachen wollte – für Svea.
John fragte mich zwischendurch immer wieder, ob ich an ein glückliches Ende glaubte. Regelmäßig antwortete ich mit dem Allerwelt-Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Das war zwar nicht besonders klug, aber auch nicht besonders dumm, jedenfalls diplomatischer als ein bloßes Achselzucken.
Wir zeigten sämtlichen Barbesucher das Passfoto und fragten, ob sie die Dänin gesehen hätten. Wir stellten fest, dass sie die erste Nacht wohl mit einem Araber die Bars abgegrast hatte. Anscheinend hatte sie ihn erst hier kennen gelernt. Aber niemand konnte etwas zu ihm sagen.
Was für Marrakesch der Djemaa el Fna, war für Tanger der Zoco Grande, den wir nun nach Svea absuchten. Wir fanden keine Spur von ihr. Auf dem Platz saßen viele Weltenbummler und sogenannte Spätgammler, viele Alt-Hippies neben ein paar Junghippies. Sie hatten es sich auf dem Boden bequem gemacht. Dazu reichten ein paar Zeitungen als Sitzunterlage. Superkomfortabel hatten es jene, die ihren Schlafsack als Unterlage nutzten. Vor sich hatten sie Tücher ausgebreitet, auf denen sie handgefertigten Schmuck und selbstgeschriebene Reisebeschreibungen mit Adressen-Hinweisen für günstige Übernachtungen und allerlei Krimskrams verkauften.
Man spielte auf der Klampfe oder trommelte auf Bongos, sang lyrische Songs oder Protestsongs der längst vergangenen Sechziger. Wir fragten die jungen Leute, ob jemand Svea gesehen habe. Drei Holländerinnen, die gewiss seit einigen Wochen keine Dusche genossen hatten, versicherten uns, sie hätten sie in einer Art Jugendherberge namens »Jardins des Tanger« getroffen und auch ein paar belanglose Worte mit ihr gewechselt. Das gab uns Hoffnung.
Für einen Dollar machten sie sich in der Mittagssonne mit uns auf und führten uns durch vor Schmutz starrende Gassen zu einem ziemlich maroden Gebäude. Es gab keinen Portier und eine unbesetzte Rezeption. So gingen wir erfolglos von Zimmer zu Zimmer. Oben angekommen, hatten wir einen wunderbaren Überblick über die Stadt. Während wir unsere nächste Suchaktion besprachen, kam ein arabischer Mitdreißiger die Treppe heraufgeschnaubt. Stella zeigte ihm das Foto. „Ja, hier war eine Frau mit diesem Aussehen“, räumte er ein. „Nur eine Nacht. Ja, sie war in Begleitung mehrerer junger Marokkaner. Nach dem Morgenmokka gingen sie wieder.“
Mehr konnte er nicht sagen. Unsere Hoffnung schwand dahin. So gingen wir zurück zur Polizeistation. Wir wollten mit Hassan und unseren Freunden Wolle, Gerd, Leif und Jan-Stellan, die ihrerseits auch nach Svea gesucht hatten, besprechen, was nun zu tun sei.
Unser Herz schlug höher, als Hassan auf uns zukam und sagte: „Wir haben sie gefunden. Doch sie ist nicht in bester Verfassung.“
„Was ist mit ihr?“, fragte John erregt.
„Sie ist unterernährt, dazu das Rauschgift, Drogen, Heroin, was immer. Nichts Ungewöhnliches. Sie ist im Krankenhaus.“
Wir fuhren allesamt mit seinem Polizeiwagen und mit Wolles Bulli zum Stadtrand in die Klinik. Sie wurde von katholischen Schwestern geführt. Eine der liebenswürdigen Nonnen stellte sich als Oberschwester vor, warnte uns jedoch sogleich vor zu großem Optimismus. In diesem Moment musste ich daran denken, wie schwer es dieses muslimische Land den christlich motivierten Ordensschwestern einst gemacht hatte.
Aber eine Münze hat immer zwei Seiten. Aus Sicht der Moslems war die Aktivität der christlichen Gemeinschaft in ihrem Land eine Art ideologischen Untergrundkampfes – oder im platten weltlichen Geheimdienstjargon ausgedrückt: Zersetzungsarbeit. Katholisch ausgedrückt: einfach nur Missionierung. Das konnte mir jetzt zwar völlig egal sein, aber wie unser Gehirn so spielt – es lässt sich nicht immer den strikten Tagesbefehlen unterordnen. Spätestens in einer der ruhigeren Momente setzt es sich mit seinen Erinnerungswünschen durch.
So auch jetzt, während wir noch eine halbe Stunde im schattigen Innenhof der Krankenhausanlage warten sollten. Mir ging die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken in Westberlin durch den Kopf. Meine redaktionelle Mitarbeit an Dr. Duwes Streitzeitschrift »bundesdeutsche tabus« hatte viele informelle Kontakte zur Folge. So erhielt ich eines Tages eine völlig neu entstandene Zeitung auf den Schreibtisch. Sie hieß DIALOGIKUS – Christliche Monatszeitung.
In dieser christlichen Schrift gab es etwas revolutionär Neues: Eine mit der Chefredaktion gleichberechtigte Redaktion, die obendrein auch noch unabhängig von den Auflagen der Kirchenleitung arbeiten durfte. Es gab – Revolution! Revolution! – eine Leserversammlung, die mitbestimmen durfte, welche Themen bearbeitet wurden und – welch ein frevelhafter Bruch mit der Vergangenheit! – die aktive Mitarbeit des einfachen katholischen Fußvolkes jeglicher politischer Couleur war ausdrücklich erwünscht. Führten bislang nur äußerst CDU-treue, konservativ-etablierte Kreise das Wort in Kirchenzeitungen, so kamen nun auch andere Positionen – insbesondere sozialethische – zu Wort.
Das passte naturgemäß nicht ins festgezurrte Weltbild der beamteten Pfarrer und ihrer kirchlichen Vorgesetzten. So kam es zu Boykottaufrufen des Kirchen-Establishments gegenüber dem DIALOGIKUS. Doch steter Tropfen höhlt den Stein: Im Laufe der Auseinandersetzung und mit dem Wechsel des gesellschaftlichen Klimas konnten sich die progressiven Kräfte schließlich auch in kirchlichen Publikationen einen Standort – und damit zumindest Gehör – verschaffen. Die religiös verbrämte Maulkorbpolitik des Vatikans fand ein zaghaftes Ende.
Mit diesen Gedanken im Kopf sah ich die Oberschwester aus der Krankenstation auf uns zukommen und dachte noch: Wenn die hier wüssten, mit welchem kleinkarierten Mist sich ihre Glaubensbrüder und Ordensschwestern gerade in der Heimat rumschlagen!
„Die junge Frau ist schwer krank“, warnte sie uns auf dem Weg zur Station. „Es wäre besser, wenn nur einer von Ihnen hineingeht.“
Stella schaute zu mir und ich zu John. Ich zögerte. Da sagte Sören: „John sollte gehen, er hat das innigste Verhältnis zu Svea.“ John sah ihn dankbar an. Kommissar Hassan zog einen dänischen Pass hervor. „Das ist die junge Frau, nehme ich an.“
John nahm den Pass und schlug die Seite mit dem Foto auf, wobei ihm ein Stöhnen entfuhr. „Sorry“, sagte er, „aber sie sieht so schön aus, ihre feinen Gesichtszüge. Hoffentlich …“, er brach ab. Wahrscheinlich dachte er, wie wir alle in diesem Moment, an die bekannten Zeitungsfotos mit den hageren ausgemergelten Gesichtern von Drogenkranken. „Ja, das ist sie“, sagte er schließlich.
Die Oberschwester führte ihn in das Krankenzimmer, aber innerhalb von einigen Sekunden stürzte er mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck zurück in den Flur: „Das ist nicht Svea!“
Stella, Sören und ich drängten uns an der Nonne vorbei ins Zimmer, wo eine brünette junge Frau von etwa Mitte Zwanzig auf dem Bett lag. Sie sah Svea überhaupt nicht ähnlich. Wir hielten sie für eine Engländerin. Aber es war zweifellos so, dass wir sie in diesem Zustand nicht fragen konnten, woher sie den Pass hatte. Nach einem Blick auf ihre fahle Haut und ihren herabhängenden Unterkiefer, der die untere Zahnreihe freigab, hatte ich meine Zweifel, ob wir sie überhaupt je würden befragen können.
Wir stiegen wieder in unsere Autos, wobei John und ich in der klapprigen Bullenkiste von Kommissar Hassan mitfuhren. Der Kommissar wollte uns das neue Signalhorn vorstellen, und so fuhren wir bei fast menschenleeren Straßen mit großem Tatütata – es klang in meinen Ohren wie arabische Schlangenbeschwörer-Musik – zum Jardins des Tanger zurück, wo wir wieder auf den bekannten Araber trafen, der diese Anlage offenbar leitete.
„In den vergangenen Wochen haben viele europäische Jugendliche bei mir gewohnt“, sagte er in bestem Französisch. Hassan übersetzte. „Darunter, wie ich meine, Schwedinnen, Dänen, Britten, Deutsche und Norweger sowie einige Franzosen. Jemand von ihnen könnte sicherlich Sveas Pass gestohlen haben. Aber es ist auch möglich, dass Svea den Pass gegen gutes Geld verkauft hat.“
Hassan bestätigte diese Einschätzung mit einem Nicken. Wir waren so schlau wie zuvor.
*
In der Berliner Clausewitzstraße 2 lag ein unscheinbares Büchlein, versteckt hinter hunderten von Büchern in einem Wandregal. Ein Tagebuch, das ich bald schon finden würde. Es war mit schwer lesbarer Krixel-Handschrift geschrieben. Verfasst von meinem guten Kumpel und Mitgründer unserer ersten Wohngemeinschaft, Rolf, konnte ich folgende Zeilen entziffern:
29. Januar: Schlimm oder nicht schlimm. Ich merke, dass ich so richtig zu saufen angefangen habe. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus und bin meistens so besoffen wie alle Funktionäre der KPdSU zusammengenommen. Eines Nachts hatte ich sogar schon das Brotmesser mit ins Bad genommen und mich in die Badewanne gelegt, als gerade niemand in der WG war außer mir. Und dann dachte ich, Moment, alter Junge, vielleicht möchte deine Liebste auch noch mal mit dir sprechen. Und dann kam sie tatsächlich.
Peggy war noch gerade rechtzeitig von einer Kneipentour heimgekommen und hatte mich gefragt, was das soll. Ich sei betrunken, sagte ich entschuldigend.
30. Januar: Am Morgen, als ich zu mir kam, schlief Peggy noch, und als erstes rotzte ich auf den Teppich im Gemeinschaftsraum, weil – ich weiß nicht warum. Alle schliefen noch, und ich rauchte drei Zigaretten hintereinander und drückte sie auf meinem Handrücken aus. Schmerz fühlte ich dabei nicht. Irgendwie war alles verrückt. Ich sah auf, und da saß plötzlich jener vietnamesische Medizinstudent, der dabei war, als ich in der Botschaft in Ostberlin die gespendete Medizintechnik überbrachte.
Es war eine kuriose Situation, denn der Typ war manchmal durchsichtig. Ich konnte durch ihn hindurchsehen. Dann sah ich hinter ihm ein Einmachglas stehen, in dem ein Embryo lag. Der Student lachte und sagte: Ich habe das Baby vor den GI’s gerettet.
Ich sah eine Whiskyflasche und begann wieder zu trinken. Dann legte ich mich noch einmal neben Peggy und schlief.
2. Februar: Peggy ist ausgezogen.
Rolf hatte den stern abonniert. Vielleicht hatte Peggy die erste Januar-Ausgabe des stern als Aufforderung an sich selbst verstanden. Die Titelgeschichte lautete: »Frauen machen mobil – Kinderzimmer, Heim und Herd sind kein ganzes Leben wert«. Statt „Kinderzimmer“, für das es noch keinen Anlass gab, hatte Peggy wahrscheinlich „Alkohol“ eingesetzt.
Von Rolfs Drama – eigentlich war es auch Peggys Drama – ahnte ich auf dem Weg zum Zoco Chico nichts. Auch nichts von Tommis Drama bei seiner Poststelle. Es war völlig anderer Natur. Es war ein permanentes Nervendrama, bei dem sich Tommi zu behaupten wusste. Ein Vorgesetzter war bei der morgendlichen Sortierarbeit an ihn herangetreten.
„Lettau, ich habe eben mitgestoppt. Sie haben dazu 36 Minuten gebraucht.“
Tommi gab ihm keine Antwort.
„Ist Ihnen bekannt, welche Zeitvorgabe hierfür eingeplant ist?“
„Nein.“
„Sind Sie schon lange hier?“
„Etliche Jahre.“
„Und Sie kennen die Norm nicht?“
„Nein.“
„Sie verteilen die Post in die Verteilerkästen, als sei sie Ihnen völlig gleichgültig.“
Tommi schaute sich um; er war mit seiner Verteilung fertig und die anderen waren noch am Einsortieren der Briefe. Der Antreiber stand vor den Blechkästen und zeigte mit dem Finger auf sie. „Sehen Sie die Zahl hier vorne am Kasten?“
„Klar doch.“
„Was sagt Ihnen diese Zahl?“
Tommi zuckte mit den Schultern.
„Diese Zahl sagt Ihnen, wie viele Briefe Sie pro Minute einzusortieren haben. Ein 75-cm-Behälter muss in 29 Minuten geleert sein. Sie haben sieben Minuten länger gebraucht, als die Norm vorschreibt.“
Er zeigte auf die 29.
„Für mich hat die 29 nichts zu bedeuten.“
„Was meinen Sie damit?“
„Das soll heißen, dass irgendein Bürokrat auf eigene Faust oder auf Geheiß irgendeines anderen Sesselfurzers hier vorbeikam und nach dem Zufallsprinzip eine 29 anklebte.“
„Das sehen Sie völlig falsch. Die 29 ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und Durchschnittsberechnungen.“
Wozu wurde hier ein Aufstand geprobt, fragte sich Tommi und gab ihm keine Antwort.
„Ich werde das protokollieren müssen für Ihre Personalakte, Lettau. Sie müssen dann zu einer Belehrung.“
Ein paar Tage später betrat Tommi das Büro, um sich belehren zu lassen. Da saß ihm wieder einmal der Gewerkschaftskollege Schöll gegenüber, diesmal als Vertreter der Arbeitgeberseite. Er hatte einen breiten Kopf, eine breite Boxernase, ein breites Kinn. Der ganze Kerl sah aus wie ein breitschnauziger Boston Terrier.
„Setzen Sie sich, Kollege Lettau.“
„Lassen Sie das am Besten!“
„Was lassen?“
„Das mit dem Kollegen!“, sagte Tommi.
Schöll hatte eine Menge Papiere in der Hand, die er nun mit wichtigtuerischer Mine überflog.
„Lettau, Sie brauchen 36 Minuten, um einen 29-Minuten-Behälter zu leeren. Das ist entschieden zu lang!“
„Mensch Meier, bleiben Sie mir mit dem Scheißdreck vom Hals. Ich könnte kotzen.“
„Wie?“
„Ich habe gesagt, Sie sollen mir mit diesem Scheißdreck vom Hals bleiben! Ich unterschreibe Ihren komischen Belehrungswisch und damit basta. Sie sparen Zeit. Ich spare Zeit.“
„Meine Amtspflicht im Interesse unseres freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates und der Allgemeinheit, insbesondere aber im Interesse der Deutschen Bundespost ist es, Sie hier und heute zu belehren!“
Tommi stöhnte auf, wie ein Mann nach einem Orgasmus. Den Orgasmus bekam wahrscheinlich jedoch Schöll.
„Wegen mir. Schießen Sie los. Was haben Sie so Großartiges zu sagen?“
„Jeder Ihrer Kollegen muss hier für die Allgemeinheit der Steuer- und Gebührenzahler, von denen Sie Ihren Lohn beziehen, eine Mindestleistung bringen, Lettau.“
„Gewiss.“
„Wenn Sie also nicht die Leistung bringen, muss jemand anderes Ihre Post erledigen. Das bedeutet Überstunden.“
„Wollen Sie andeuten, dass ausgerechnet ich für die zwei Überstunden, die Sie sich fast jeden Tag unberechtigt aufschreiben, verantwortlich bin?“
„Lassen Sie sich gesagt sein: Sieben Minuten machen bei vier Leerungsarbeiten pro Tag schon eine halbe Stunde aus. Was glauben Sie, wer die ableistet?“
Tommi schaute, nein stierte ihn an und legte los: „Sie machen es sich zu einfach. Und Sie wissen, dass es eine Milchmädchenrechnung ist. Jeder Behälter ist fünfundsiebzig Zentimeter lang. In manchen sind viele Briefe, in anderen weniger, in manchen sogar dreimal so viel wie in anderen. Das macht etwas aus! Die Kollegen schnappen sich die Behälter mit der günstigsten Befüllung. Das Wettrennen am Morgen spare ich mir. Irgendjemand muss ja letztendlich doch die übervollen Behälter abarbeiten. Doch ihr Aufpasser wisst immer nur, dass jeder Behälter fünfundsiebzig Zentimeter misst und in neunundzwanzig Minuten geleert sein muss. Wir stecken aber nicht die Behälter in die Sortierfächer, sondern die einzelnen Briefe. Und jeder einzelne Brief kommt jeweils in das dazugehörige Straßenfach. Können Sie mir folgen?“
„Sie sind ja ein ganz Schlauer. Aber nein, nein, man hat alles genau über Jahre hinweg berechnet.“
„Wer immer das berechnet hat, hat noch nie etwas von Adam Riese gehört. Man kann bei einer Stoppuhraktion nicht nur EINEN Behälter überprüfen. Man muss nach zehn oder zwanzig oder noch mehr Behältern die Leistung eines ganzen Morgens oder gar Tages beurteilen. Nur dann erhält man einen mathematisch relativ sauberen Durchschnitt. Alles andere ist statistischer Dünnschiss. Ihr supertreuen Hofhunde eurer Spitzenbeamten klammert euch doch nur an diese Zahl 29, um so unliebsame Mitarbeiter wie mich fertigzumachen. Weil Leute wie ich euch an die echten gewerkschaftlichen Ziele erinnern und ihr ein schlechtes Gewissen habt.“
„Nun gut, Lettau, Sie hatten Ihre Chance und haben ihre bekannten Sprüche brav aufgesagt. Aber jetzt rede ich, und ich sage Ihnen: Sie brauchen sieben Minuten zu lange, um einen Behälter einzusortieren. Das, und NUR das zählt für uns. Wenn Sie noch einmal bei diesem Zeitbetrug erwischt werden, wird man Sie zu einer erweiterten Belehrung laden!“
„Es bleibt noch eine wichtige Frage zu klären.“
„Bitte.“
„Wenn ich einen Behälter mit wenigen Briefe bekomme, was gelegentlich der Fall ist, und wenn ich ihn in zehn statt in neunundzwanzig Minuten sortiere, kann ich dann die überschüssigen neunzehn Minuten in die Kantine gehen und bei einem Kaffee Zeitung lesen, um danach wieder an die Arbeit zu gehen?“
Jetzt stierte Schöll Tommi an und brüllte: „Nein, Sie müssen dann sofort mit einem neuen Behälter beginnen und ihre Kollegen entlasten!“
Tommi unterschrieb den mit Kaffeeflecken verkleckerten Wisch, den Schöll ihm über den Tisch zuschob. Darin stand, dass Schöll ordnungsgemäß die Belehrung vorgenommen und Tommi alles verstanden habe.
Das alles hatte Tommi Doro berichtet, die ihn damit tröstete, dass es Wichtigeres gebe, als sich über solche rechtslastigen Steigbügelhalter des Kapitalismus zu ärgern, und sie erzählte ihm von unserem Kampf um die Rettung Sveas.
*
John hatte vorgeschlagen, wir sollten auf den Zoco Chico zurück, um nach den drei Holländerinnen zu suchen, die uns zum Jardins des Tanger geführt hatten. Immerhin waren sie außer dem Jugendherbergswirt die einzigen, die bisher unmittelbar mit Svea zu tun hatten. Wir fanden die drei prompt vor genau der Bar, wo wir sie bereits zuvor angetroffen hatten.
„Fehlt jemand aus eurer Gruppe?“, fragte Sören. „Ich meine, fehlt eine Frau?“
Die drei Mädels begannen ihre Freundinnen aufzuzählen, konnten sich aber weder darauf konzentrieren, noch auf eine Erkenntnis einigen. Es lag wohl an dem Stoff, den sie gerade geraucht oder in Form von Plätzchen gegessen hatten. Sören schob sie kurzentschlossen in Wolles Bulli und wir fuhren mit ihnen zurück zum Krankenhaus. Gerade als wir hineingingen kam uns die Oberschwester entgegen. „Sie ist tot.“
Sie führte uns in das Kellergeschoss mit dem Kühlraum, wo die junge Frau bedeckt mit einem weißen Laken dalag und ihr frei gelassenes Gesicht das Elend offenbarte: eingefallene Wangen, hervorstehende Backenknochen, verbraucht, Endzustand eines Drogenlebens. Die Holländerinnen sagten sofort, dass dies Olivia sei.
Kommissar Hassan zog das Laken beiseite und fragte: Olivia wer?“
„Sie ist aus Stockholm.“
„Und ihr Nachname?“
„Olivia, aus Stockholm.“
Hassan schaute auf die Armvenen der Toten, deckte sie wieder zu, sah uns irgendwie ausdruckslos an und sagte dann nur ein Wort: „Heroin“.
Auf der Rückfahrt ins Zentrum saß ich im Polizeiauto hinten, neben John und bemerkte, wie er zitterte. Ich wollte ihn trösten und ihm meine Hand auf den Arm legen, aber er drehte sich zur Seite und ich hörte ihn schluchzen. Im Hotelzimmer ließ er sich aufs Bett fallen, vergrub sein Gesicht im Kissen, drehte sich dann langsam zu mir und fragte wieder einmal: „Können wir sie noch finden?“
Diesmal konnte ich nicht mit „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ antworten. Ich zuckte mit den Schultern und sagte: „Wir können sie suchen und finden, egal was mit ihr ist, aber wir MÜSSEN sie finden – und wir WERDEN sie finden!“
„Hast du eine Idee, what to do now, Sören?“, fragte Stella.
„Eine Idee hab‘ ich noch“, antwortete er.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nur noch in ihm, der sich zweifellos an Sveas Zustand – jedenfalls in den letzten Monaten – mitschuldig gemacht hatte, eine Hoffnung sah.
„Und die wäre?“, fragte ich.
„Ich kenne einen Kellner in einer anrüchigen Bar nahe am Zentrum. Er ist zwar der korrupteste Bursche in ganz Marokko. Aber was soll’s! Lasst uns jetzt ausruhen. Die Bar öffnet erst gegen 23 Uhr. Wer weiß, wie lang die Nacht für uns wird. Der Typ ist unsere letzte Chance.“
Kurz vor 23 Uhr liefen wir zu fünft – Stella, Jan-Stellan, Sören, John und ich – über den hell erleuchteten und voll belebten Zoco Chico. Viele Studenten mit teils noch langen Haaren wie zu guten alten Hippiezeiten, Junghippies und ältere, mehr oder minder aus der Bahn geworfene Weltenbummler trieben sich hier herum. Eigentlich wollten viele von ihnen weiter gen Süden, nach Marrakesch, doch sie waren hier in Tanger hängengeblieben, hohläugig, ohne Geld, verwahrlost, von der Hand in den Mund lebend.
Sören ging auf eine auffallend beleuchtete Bar zu, deren Werbung um Besucher auf dem Dach mit Farblichtern wie aus Tausendundeine Nacht anmutete. Drinnen nahmen wir an einem Ecktisch in einer Nische Platz, die wie ein Séparée erschien, denn links und rechts war ein Seidenvorhang zum Zuziehen angebracht. Eine Wasserpfeife stand auf dem Tisch. Sören ging zur Theke.
Er kam mit einem Kellner zurück, dessen Alter zwischen Ende Zwanzig und Ende Dreißig liegen konnte. Vielleicht war er auch schon Ende Vierzig, schwer zu schätzen, ein ziemlich undefinierbarer Typ. Er war mir nicht gerade sympathisch.
„Seien Sie herzlich willkommen, meine Herren!“ Stella übersah er geflissentlich. „Sie kommen mit meinem guten Freund Sören, dem ich vertrauen kann. Und so vertraue ich Ihnen und empfehle Ihnen eine Reise in das libanesische Paradies. Beste Ware.“
„Wie?“, fragte Jan-Stellan.
„Ich biete nur das Beste“, sagte der Kellner und zwinkerte süffisant lächelnd.
„Was?“, fragte Jan-Stellan erneut.
„Marihuana!“ Der Mann sah uns erwartungsvoll an. „Natürlich verdammt gutes Kraut.“
„Azza“, sagte Sören und zog den Kellner näher zu sich heran. „Wir haben nur Eines im Sinn: Wo finden wir unsere Freundin Svea?“ Azza konnte wohl nichts mit dem Namen anfangen, deshalb fuhr Sören fort: „Sie ist eine junge Dänin, zweiundzwanzig Jahre alt. Tochter eines dänischen Diplomaten im Libanon. Er zahlt gut, wenn wir sie lebend wiederfinden.“
Das war zwar eindeutig geschwindelt. Über Sveas Elternhaus wussten wir absolut nichts. Aber es war legitim, dem Bakschisch-empfänglichen Araber den Mund wässrig zu machen.
„Wir telefonieren am Abend mit ihm. Er macht sich große Sorgen um seine Tochter. Er zahlt, wie er bereits sagte, alle Auslagen, die entstehen“, warf ich, ohne rot zu werden, ein.
„Und wenn er nicht zahlt?“, fragte Azza hinterlistig.
„Dann zahle ich!“ Wieder wurde ich nicht rot.
Azza war es zufrieden. Ein zahlungskräftiger Deutscher hier vor Ort und für ihn greifbar, schien ihm eine Anstrengung wert. Doch zu unserer Enttäuschung sagte er: „Ich kenne so ein Mädchen nicht. Skandinavierin? Seht euch selbst um: Es gibt hier Hunderte, und sie sehen sich alle sehr ähnlich. Aber ich werde für euch Erkundigungen einholen. Vielleicht will es der Zufall und …“ Er brach ab, weil ein anderer Kellner für jeden von uns einen Mokka und ein Glas Wasser brachte.
Dann setzte er sich zu uns und ließ sich alles erzählen, was er über Svea wissen musste, ihre Aufenthaltsorte und Hotels, die Männer, die man bei ihr gesehen hatte, die tote Schwedin, die mit ihrem Pass unterwegs gewesen war. Mit diesen Informationen verließ er uns, und wir verließen die Bar, um später zurückzukommen. Es war jetzt dreißig Minuten nach Mitternacht.
Wir drehten noch eine Runde über den Zoco Chico und studierten das Milieu intensiver als vorher. In Marrakesch, auf dem Djemaa, schien eine wesentlich entspanntere Atmosphäre vorzuherrschen als hier. Wir sahen hier echtes Elend und durchgängig eine Art hilfloser Apathie unter den nichtarabischen Jugendlichen. Sie hatten sich zu dem großen Abenteuer einer Reise ins Land ihrer Rauschträume aufgemacht und waren in Tanger tief enttäuscht hängengeblieben.
Um Marrakesch zu erreichen, bedurfte es ausreichenden Geldes, gleichwohl hier alles sehr billig war. Es verlangte jedoch hauptsächlich Willenskraft und Ausdauer und die Möglichkeit, unterwegs etwas dazu zu verdienen, wenn die Reserven erschöpft und die Eltern nicht mehr zahlungsbereit oder nicht mehr erreichbar waren.
Anders verhielt es sich, um nach Tanger zu kommen. Da reichte ein einfaches, erschwingliches Ticket für die spanische Fähre. Wir sahen in dieser Nacht all jene, die es zwar nach Tanger, aber keinen Schritt weiter geschafft hatten. Und nun fehlte ihnen das Geld für die Fähre zurück. Zwei Jungs und ein Mädel aus München im Alter von zirka fünf- oder sechsundzwanzig Jahren setzten sich zu uns und meinten, dass das 1975er-Tanger von heute lange nicht mehr das wäre, was es noch zur alten Hippie-Aufbruchzeit vor sieben Jahren gewesen wäre.
Wir erzählten ihnen, weshalb wir hier seien, stießen jedoch auf keinerlei näheres Interesse der Drei, die offenbar zu jenen hoffnungslos in dieser Stadt Hängengebliebenen zählten.
„Das passiert jeden Tag“, sagte einer der Jungs. „Sie wird schon wieder auftauchen.“ Dann lenkten sie das Gespräch auf ein anderes Thema. Vielleicht hatten sie die Erfahrung gemacht, dass es besser war, wenn sie sich nicht in solche Affären einmischten.
John wollte nicht aufgeben und warf ihnen ihre Gleichgültigkeit an den Kopf.
Einer der Jungs sah ihn mitleidig an und meinte: „Ach, dein Mädchen?“
John nickte.
Da sagte der zweite: „Mich würde nicht wundern, wenn sie einfach mit einem anderen in den Schlafsack gekrochen ist. Im Moment stehen die Skandinavierinnen auf schwarze Schwänzen.“
John wollte auf- und ihm an die Gurgel springen. Ich konnte ihn gerade noch zurückhalten. „Bleib ruhig. Vielleicht brauchen wir noch die Aufmerksamkeit unserer drei Landsleute. Wer weiß, wie lange wir noch bleiben und suchen müssen. Haltet bitte die Augen offen“, sagte ich an die drei gewandt, die teilnahmslos nickten.
Wie um meine Worte zu bestätigen, kam Azza mit einer niederschmetternden Nachricht zurück: „Meine Leute haben eure Svea nicht gesehen.“
Wir schliefen lange und unterrichteten Gerd, Wolle und Leif am nächsten Morgen über die negativen Ergebnisse unserer Recherche. Gerd kam auf die Idee, beim dänischen Konsulat anzurufen, um mitzuteilen, dass die dänische Staatsbürgerin Svea Lindström seit nunmehr vier Wochen auf mysteriöse Weise verschollen ist sowie nach Sveas Familienhintergrund zu fragen. Eventuell konnte uns das Konsulat wertvolle Tipps geben oder sogar eigene Suchanstrengungen unternehmen.
Aber wir hatten uns gründlich getäuscht. Weder erhielten wir Auskunft zu Sveas Familie, noch die Zusage, dass der Konsul ihre Familie informieren würde, noch wollte oder konnte man uns Tipps und Hilfe geben. Wir fragten uns, wofür solche beamteten Sozialschmarotzer und Wichtigtuer eigentlich bezahlt würden.
Die nächsten zwei Tage verbrachten wir damit, verschiedenen Spuren und Mutmaßungen nachzugehen. Doch alle Wege führten ins Nichts. Azza, der uns versprochen hatte, sich sofort zu melden, sobald er etwas wusste, war stumm geblieben. Am zweiten Abend gingen wir in seine Bar und fragten den Chef, wo Azza sei.
„Er hat sich zwei Tage Urlaub genommen; wer kann wissen, wo er ist!“
Wir tranken noch einen Pfefferminztee und wollten gerade gehen, als Azza aufgeregt und mit breitem Grinsen hereinstürzte. „Meine Freunde und ich haben sie gefunden! Die Bullen konnten euch nicht helfen, aber ich!“
Wir hörten gespannt, was er zu berichten hatte: „Es hat mich eine Stange Geld gekostet. Zwei meiner Freunde habe ich in das Zentrum des Haschisch-Anbaus nach Chaouen geschickt. Viele Dealer kommen von dort hierher und bringen ihre Ware an die lokalen Verteiler. Im Gegenzug nehmen sie hübsche europäische Mädchen mit in das abgelegene Gebiet und halten sie sich dort als Quasi-Ehefrauen. Ich hatte so eine Vermutung.“
John war ganz zappelig. Ohne einen genauen Adressaten anzusprechen, fragte er beunruhigt: „Ist es möglich, so schnell wie möglich dorthin zu fahren?“
„Ihr solltet, glaube ich!“, sagte Azza mit bedeutungsschwerem Blick.
„Was heißt das?“
Azza sah John an, dann Stella und mich. „Es ist wahrscheinlich besser, ich spreche erst einmal mit einem von euch“, schlug er vor und deutete auf mich. Er wusste ja, dass John Sveas Freund war. Er führte mich in ein Hinterzimmer, wo er mir reinen Wein einschenkte: „Der Zustand der Frau ist nicht gut“, sagte er halblaut. „Die beiden Jungs, die Svea hier kennen gelernt hat, sind Einheimische aus Chaouen … sie machten aus eurer Bekannten ein Geschäftsmodell und ließen ihre sechsköpfige Clique an sie ran … einer nach dem anderen. Dann verschleppten sie eure Bekannte in ein abgelegenes Haus einer Haschischplantage. Sie wurde aufgrund ihrer Mangelernährung und der Drogen krank.“
Ich war entsetzt. Er sah mich nachdenklich an, überwand sich aber und sagte nun das, was er genau vor John eben nicht sagen wollte: „Meine Informanten berichteten mir vor Ort: ‚Sie wurde sechs- bis achtmal am Tag gefickt und immer nur mit Haschkeksen gefüttert, aber mit sonst nichts.‘ So ist es also.“
*
In der Rostlaube saß Doro in der Germanistikvorlesung, dachte an uns, die wir auf dem Weg nach Chaouen waren und an meinen Anruf von heute früh, als ich sie auf den neuesten Stand gebracht hatte. In der Drogenszene wiederholen sich stets die gleichen Muster. Als sei den Menschen das Wiederholungsprinzip in die Wiege gelegt. Ja, die ganze Menschheit wiederholte ihre Fehler – ach, egal … Ihre Gedanken kehrten zurück in die Realität der Vorlesung. Sie hätte jetzt gerne mit mir den Tag verbracht, und wir hätten wahrscheinlich gemeinsam in der Cafeteria ihr Referatsthema besprochen, um das es hier im Hörsaal 121 ging – eine Analyse der Asterix-Comics. Ganz sicher hätten wir uns gemeinsam bei Croissant und einem Milchkaffee einige Brainstorming-Notizen für ihre Arbeit gemacht. Gemeinsam studieren, gemeinsam arbeiten, das stärkte unsere Beziehung. Nun lagen fast dreitausend Kilometer Luftlinie zwischen uns.
Am Pult referierte ein junger Assistenzprofessor. Er kam aus der Studentenbewegung und war einer der ersten gewesen, bei denen im Berufungsverfahren die Studenten mitbestimmen durften. Insoweit war der Muff von tausend Jahren unter den Talaren verweht. Doro schaltete jetzt von Chaouen auf Gallien um und hörte weiter den Ausführungen zu …
Die Situation ist immer dieselbe: „Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. – Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“
Eine Landkarte bestätigt die Lage: Die römische Standarte, etwa in der Bourbonnais aufgepflanzt, hat Galliens Boden aufgerissen. Das wehrhafte Dorf, etwas nördlich vom heutigen Brest in der Bretagne, direkt am Meer gelegen, ist eingeschlossen von vier römischen Feldlagern.
Aber nicht nur das. Die Situation scheint schon immer dieselbe gewesen zu sein. Bereits das erste, 1968 in der BRD erschienene Heft mit dem Titel „Asterix der Gallier“, erweckt den Eindruck der Fortsetzung einer Geschichte, als wäre sie bereits in vielen Heften beschrieben worden. Die Serie „Asterix und Obelix“ erfährt keine Veränderung. Alles ist schon dagewesen, wenn die erste Geschichte anfängt. Die Konzeption geht der Serie voraus. Das ist durchaus nicht üblich bei Comic-Strips, wenn man weiß, wie sich beispielsweise die Donald-Duck-Strips von Disney im Laufe der Zeit wandelten.
Bei „Asterix“ sind alle Topoi so angelegt, dass sie beliebig übertragen oder erweitert werden können. So ist „das Dorf“ nicht das einzige. Der geschichtsnotorische Vorfall (kleines Volk widersetzt sich imperialistischem Eindringling) wiederholt sich in England („Asterix bei den Briten“) und in Spanien („Asterix in Spanien“) – die Dörfer liegen in Kent und Andalusien …
Doro erinnerte sich an die beiden Hefte sehr gut, denn sie lagen seit Monaten auf der Ablage im Bad. Wenn wir hin- und wieder badeten – meistens duschten wir nur – dann lasen wir in der Badewanne Comics und tranken dabei im Winter einen Punsch, den wir auf der hellgrün gekachelten Badewannenablage abstellten. Im Sommer badeten wir nie. Eine kühle Dusche war angenehmer.
Doros Gedanken wären wieder zu unserer Rettungsaktion in Marokko abgeglitten, wenn da vorne der Assprof nicht die Studenten mit kräftiger Stimme aufgefordert hätte, Beispiele solch wiederkehrender Elemente zu nennen, falls sie den Comic kannten. Es stellte sich heraus, dass die Asterix-Fans in großer Zahl vertreten waren und sie diese Serie nicht zuletzt wegen der reichhaltigen Variationsbreite des immer Gleichen schätzten.
Immer wieder wird Troubadix gefesselt und geknebelt, um ihn am Singen zu hindern, denn er singt schrecklich. Immer wieder braut der Druide des Dorfes, Miraculix, seinen Zaubertrank. Immer wieder will Obelix auch von dem Zaubertrank haben, bekommt ihn aber nicht, weil, wie ihm immer wieder gesagt werden muss, er als Kind hineingefallen ist. Immer wieder gehen Asterix und Obelix mit bloßen Händen auf Wildschweinjagd und kehren vollbeladen mit Wildschweinen heim, um mit ihrer Dorfgemeinschaft beim gemeinsamen Wildschweinessen zu feiern. Immer wieder begegnen die Seeräuber – selbst zu Lande – Asterix und Obelix und werden von ihnen regelmäßig verprügelt. Immer wieder halten die Schildträger den Schild schief, sodass der Dorfchef Majestix herunterfällt.
Doro dachte an die schwierigen Kommunikationswege zwischen ihr und mir, zwischen Berlin und Tanger in Marokko. Die Telefonvermittlung war oft reines Glücksspiel. Wohl deshalb erinnerte sie sich in diesem Moment einer Szene, als Obelix den Postboten fragte: „Kann man auch Hinkelsteine mit der Post schicken?“
Rohrpostix, der Postbote, antwortete: „Ja, aber nur als Einschreiben. Sie könnten sonst beim Aussortieren verlorengehen.“
Am Abend war sie mit Elke bei Tommi und Rosi zu Besuch und Tommi erzählte seine postalischen Belehrungserlebnisse. Da resümierte Doro lachend den Obelix-Dialog mit dem Postboten. Schließlich kamen sie auf das Telefonat zwischen Berlin und Tanger zu sprechen, das aus technischen Gründen so schwierig zustande gekommen war. Doro berichtete ihnen, wie es um uns und hauptsächlich um Svea stand.