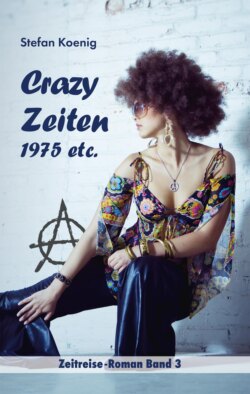Читать книгу Crazy Zeiten - 1975 etc. - Stefan Koenig - Страница 6
Zwischenlandung bei den Kelly Kids
ОглавлениеAm nächsten Morgen wachte ich in einem Hotelbett neben Doro auf.
„Wo sind wir?“, fragte ich.
„In Madrid; der Flieger hatte technische Schwierigkeiten. Und du hattest hohes Fieber. Ich muss jetzt deine Temperatur messen.“
Ich war wohl heillos überfordert gewesen, körperlich und psychisch, dazu ein Infekt – und nun lag ich hier an meinem Geburtstag. Die erste Hotelübernachtung ging auf Kosten der Lufthansa. Auf Doros hartnäckiges Betreiben hin durften wir beide allerdings zwei Übernachtungen bleiben, obwohl das Hotel am Madrider Flughafen ab dem Folgetag angeblich ausgebucht war. Ich war noch viel zu schwach, um die Weiterreise antreten zu können. Meinen Geburtstag im Krankenbett zu feiern, war mal was Neues. Doro besorgte mir ununterbrochen Tee und versorgte mich mit Obst, Tapas und irgendwelchen obskuren Genesungspillen.
Ich schlief den ganzen Tag bis zum nächsten Vormittag und war nach der üblichen spanischen Siesta-Zeit um 17:00 Uhr wieder soweit fit, dass wir gemeinsam einen kleinen Spaziergang in Madrids Altstadt unternehmen konnten. Das Taxi setzte uns in der Nähe der Kunstgalerie »Circulo de Bellas Artes« ab. Von dort aus schlenderten wir Richtung »Museo Nacional Thyssen-Bornemisza« und kamen schließlich am »Plaza Mayor« an.
„Was hat denn der Thyssen-Konzern hier in einem Museum verloren?“, fragte Doro. Ich wusste es nicht. Warum das Museum den Namen Thyssen führte, würde ich vielleicht später herausfinden.
Eine große Menschentraube stand am Plaza um eine achtköpfige Gruppe singender Kinder und Jugendlicher herum, die mit den unterschiedlichsten Instrumenten eine tolle Gesangsschau abzogen. Mittendrin befand sich ein älteres Paar, das sich beim Singen gegenseitig anhimmelte und voller Energie und Leidenschaft die Kinderschar in ihrem Gesang mitriss. Fast schien es mir, als sei dies eine große Familie. Die hüftlangen Haare fast aller Gruppenmitglieder und ihr ungewöhnlicher Kleidungsstil sprangen ins Auge.
„Das ist eine am Existenzminimum nagende Großfamilie“, sagte Doro.
„Es scheinen Geschwister zu sein, und die beiden Älteren sind wahrscheinlich Vater und Mutter“, meinte ich.
Die Geschwister traten in teils ländlichen, teils hippieähnlichen Gewändern und Kostümen auf.
Doro wiegte ungläubig den Kopf. „Die müssen sämtliche Flohmärkte, Antiquitätengeschäfte und Secondhandläden abgegrast haben.“
„Oder sie haben einen Theaterfundus aufgekauft.“
Musik und Gesang der Gruppe klangen bezaubernd und rissen uns in ihren Bann.
„Ist zwar nicht meine Musikrichtung“, sagte Doro, „aber die können wirklich was!“
Wie um das zu bestätigen, brandete jetzt tosender Applaus auf, der sich fast zu einer kleinen Fan-Hysterie steigerte. Das war ein richtig gutes Straßenkonzert, wie wir es bisher in dieser musikalischen Wucht noch nicht gehört hatten – auch wenn es nicht unbedingt unserem „reinen“ Hippie-Musikstil entsprach. Sie sangen alte spanische Volkslieder, und es waren Akkordeon, Banjo, Violine, Saxophon, Geige und zwei afrikanische Trommeln im Einsatz.
So lernten wir sie zufällig kennen, es war eines ihrer ersten Straßenkonzerte vor einer größeren Menschenmenge. Sie nannten sich »The Kelly Kids«. Wir kauften ihnen eine Kassette ab, die wir ein paar Tage später aus unserem Reisegepäck auskramten und zuhause auf zwei leere Kassetten kopierten. Eine davon brachten wir als Geschenk bei der Clausewitz-WG vorbei, die andere schickte ich meinen Eltern nach Frankfurt.
Sechs Jahre später, als die »Kelly Family« ihren ersten Hit landete, suchte ich verzweifelt nach einer dieser Kassetten. Doro und ich hatten uns zu dieser Zeit getrennt und unsere musikalische Erinnerung aus Madrid war verschwunden. Auch das Mitbringsel für die Clausewitzer war 1980 unauffindbar.
Jetzt aber, im September 1974, freuten sich unsere Freunde über „diese musikalische Rumdudelei“, wie Peggy meinte. Meine alte gute Wohngemeinschaft Clausewitzstraße 2 in Charlottenburg bestand inzwischen aus sechs Bewohnern. Rolf, unser orthodoxer Marxist-Leninist, war eine ehrliche Haut und immer noch gut im Secondhand-Geschäft unterwegs, womit er reichlich Knete verdiente, denn er hatte als Erster diese Idee vom Gebrauchtkleiderhandel in Westberlin auf den Markt gebracht – eine beachtliche kapitalistische Leistung, auf die er jetzt mit seinen 25 Jahren schauen konnte.
Rolfs Freundin Peggy, inzwischen 22 Jahre alt, harrte noch immer bei ihm aus. Sie führten nun eine ziemlich altbackene Beziehung, die sie schon vor drei Jahren eingegangen waren. Als hauptamtliche Gewerkschaftlerin war sie gewohnt, dass man in Arbeiter- und Funktionärskreisen dem Trinken zugeneigt war, doch mit Rolfs heimlichen Besäufnissen wollte sie sich nicht abfinden. Als wir die WG besuchten, hoffte ich eine veränderte Situation vorzufinden. Alles aber war unverändert. Rolf bestritt, jemals über den Durst zu trinken, wobei Peggy ärgerlich schnaubte und keinen offenen Streit vor uns austragen wollte. Vielleicht hätte das damals noch Rolfs unausweichliches Schicksal verhindern können.
Mein guter, kluger und bescheidener Freund Richy hatte sein Zimmerchen immer noch gegenüber der Küche, gleich neben dem Gemeinschaftsraum. Regina und Helmut waren neu eingezogen und wohnten in meinem ehemaligen Zimmer. Gegenüber von ihnen hatte Francois, Spitzname »Frankholz«, das Zimmer von Tommi und Rosi bezogen, die ihre Zweisamkeit seit Kurzem in einer Zweizimmerwohnung in Spandau genossen.
Tommi holte nun das Abi auf dem zweiten Bildungsweg nach, was nach Feierabend jede Menge Abendschule bedeutete. Kaum dass sie dort hingezogen waren, wurde Tommi aus dem Innendienst in Spandau zum Außendienst nach Kreuzberg versetzt. Sein Postler-Dasein bestritt er nun als maulender Aushilfs-Briefträger in Kreuzberg, was ihm keiner von uns verübeln konnte, wenn er von seinem Arbeitsdrama berichtete.
Sein Vorgesetzter war ein Stiernacken namens Beckstein, vielleicht um die Dreißig. Man brauchte dort dringend Hilfe, und es war leicht zu sehen, weshalb. Beckstein hatte ein aufgeplustertes rotes Gesicht und hervorquellende Augen und trug immer rote Socken und ein blutrotes Hemd aus einem Stoff, den er wohl in einer spanischen Stierkampfstadt erworben haben musste. Beckstein roch förmlich nach Menschenquälerei.
Neben Tommi gab es noch drei weitere Aushilfen – Lothar, Nino und Toni. Morgens um fünf mussten sie antreten. Nino war der einzige Trinker in der Mannschaft. Er trank immer bis nach Mitternacht. Früh um fünf saßen sie dann auf Abruf in der Sortierhalle, denn erst musste abgewartet werden, ob die regulären Briefzusteller erschienen oder ob einer oder mehrere von ihnen anriefen, um sich krank zu melden. Wenn Matschwetter oder Glatteis herrschten, oder wenn es im Sommer zu heiß oder im Frühjahr und Herbst zu regnerisch war, oder wenn in einem Kreuzberger Bezirk zu viele leerstehende Häuser besetzt worden waren, oder wenn ihre Kinder Ferien hatten, oder wenn zwischen einem Wochenende und einem Feiertag doppelt so viel Post auszutragen war, meldeten sich die Regulären meistens krank.
Dann platzte Beckstein der rote Kragen und er ließ seine angestaute Dauerwut an Tommi, Lothar, Toni und hauptsächlich an dem noch halbtrunkenen Nino aus. Er wirbelte auf seinem Aufsichtsstuhl herum und schrie den Vieren die Zustellbezirke zu: „Nino, du verdammter Trunkenbold, Bezirk 17! Und wehe, du kommst zu spät zurück!“ Dabei wusste er, dass Nino das Pensum niemals schaffen konnte. Schließlich ließ dieser grausame Postgott eine volle halbe Stunde verstreichen, um auf die morgendlichen Absagetelefonate zu warten, erst dann erteilte er die Anweisung, die gesamte Post nach Straßenzügen zu sortieren. Und dies mussten die Aushilfen ohne Kenntnis der einzelnen Straßenverläufe und Hausnummern tun. Dann wirbelte er zu Tommi, Toni und Lothar herum und schrie mit geschwollenen Halsschlagadern: „Ihr unfähiges Jungvolk …“, dabei zeigte er auf die drei betroffen dreinblickenden Aushilfen, „… ihr könnt euch aussuchen, wer was macht: Bezirke 22, 24 und 26! Und kommt ja nicht zu spät zurück!“
„Ihr Ärmsten!“, warf ich ein, als Tommi einen Moment in seiner Erzählung stockte.
„Natürlich diskutierten wir drei erst mal ausführlich, wer welchen Bezirk übernehmen würde, und so vergingen noch einmal zwanzig wertvolle Minuten“, sagte Tommi, als wir seine Situation besprachen.
Beckstein machte die vier Jungen richtig fertig. Er erwartete von ihnen, dass sie die Post rechtzeitig sortierten und austrugen und beizeiten wieder zurückkamen, damit er früher die Sortierstelle schließen und nachhause kommen konnte. Hinzu kam, dass die Jungs, ohnehin tagsüber schon fix und fertig von der Zustellschinderei, drei Mal die Woche nachts durch die Stadt fahren und die Nachtbriefkästen leeren mussten. Der Zeitplan, den sie einhalten sollten, war unmöglich. Das Postauto konnte gar nicht so schnell fahren, weshalb bei der ersten Runde stets fünf oder sechs Briefkästen ausgelassen wurden. Das rächte sich bei der nächsten Tour, weil dann die Briefkästen überquollen und es regelmäßig zu Beschwerden kam, die dem Kapo-Hitzkopf in der Sortierzentrale neuen Anlass zu einem Tobsuchtsanfall gaben.
„Die Aushilfen machen das »Wutsystem Beckstein« dadurch erst möglich, dass sie seine unmöglichen Anordnungen ausführen“, sagte Richy.
Als wir Tommis Arbeitserfahrungen diskutierten, meinte Doro in ihrer resoluten Art: „Ich verstehe nicht, dass man einen Mann von so augenscheinlicher Schwäche …“
„Grausamkeit!“, rief Tommi dazwischen.
„… dass man den in einer solchen Stellung belässt!“
„Den Regulären ist es wahrscheinlich gleich, so lange er ihnen nicht an den Job gehen kann. Davor bewahrt sie die Gewerkschaft“, sagte ich.
„Kannst du gegen diese proletarische Willkürherrschaft gar nichts machen?“ Richy sah Tommi fragend an.
„Ich schrieb an einem meiner wenigen freien Tage einen zwanzigseitigen Bericht mit allen Details über Becksteins Schikanen, legte einen Durchschlag auf Becksteins Platz und ging mit dem Original hinauf in die Leitstelle zum Ober-Boss, das heißt: Erst musste ich an der Sekretärin vorbei. Und da fiel mir auf, dass ich sie schon einmal gesehen hatte. Und zwar Arm in Arm mit Beckstein.
Die aufgedonnerte Tussi sagte, ich solle warten. Und dann wartete und wartete ich. Ich ging den Flur auf und ab und auf und ab und schaute auf die Uhr und wartete und fragte die Tussi, ob der Chef überhaupt da sei und sie nickte stumm und wies mit ihrem Zeigefinger auf den Stuhl vor ihrer Tür. Nach einer Dreiviertelstunde bekam ich endlich Zutritt zu dem begehrten Zimmer, in dem mich ein bürokratischer Fuchs in grauem Anzug und Postkrawatte misstrauisch von oben bis unten musterte und mich aufforderte, Platz zu nehmen.
Noch bevor ich mich setzen konnte, fing er zu brüllen an, wie ich es von Beckstein kannte: ‚Sie sind ein verdammter akademischer Alleswisser, nicht wahr?‘
Ich antwortete: ‚Es wäre mir lieber, Sie gingen auf meinen Beschwerdebrief ein.‘
‚Sie kommen sich soooo klug vor, Sie Klugscheißer! Einer von der Sorte, die hier bei Väterchen Staat ihr gutes Geld auf einfache Weise verdienen wollen, um sich dann abzumachen und sich später mit irgendwelchen nichtsnutzigen Studiengängen zu Vorgesetzten von solch feinen Leuten wie Herrn Beckstein und mir aufzuschwingen!‘
Er fuchtelte mit meinen zwanzig Seiten in der Luft herum und schrie: ‚Herr Beckstein ist ein feiner Mann. Er ist der zuverlässigste Postbeamte, den ich je in meiner ganzen Laufbahn kennen gelernt habe.‘
‚Seien Sie nicht betriebsblind und voreingenommen. Er ist offensichtlich auf dem falschen Platz und ein ausgesprochener Sadist. Vielleicht sollte er mal selber die Briefe austragen und das zu den Bedingungen, die er uns aufzwingt.‘
‚Wie lange sind Sie schon bei der Post?‘
‚Neun Jahre.‘
‚Herr Beckstein ist seit fünfzehn Jahren bei der Post!‘
‚Was hat denn das damit zu tun?‘
‚Ich sagte bereits, Herr Beckstein ist ein angenehmer Kollege und ein feiner Mann! Ich weiß nicht, ob Sie das von sich selbst auch behaupten können!‘
Ich glaube, der Typ wollte mich tatsächlich mit seiner blaugelben Postkrawatte erdrosseln. Wenn da nicht die Tussi im Vorraum gewesen wäre, hätte ich darauf gewettet, dass er mit Beckstein geschlafen hat. Na ja, vielleicht hat er das ja, bevor beide im Sankt-Pauli-Blättchen die Tippsen-Tussi ausfindig machten, die zum flotten Dreier bereit war. Irgendwas in dieser Art musste die Drei verbinden.
‚Na schön‘, sagte ich, ‚Beckstein ist ein guter Mann und ein überaus verständnisvoller Kollege. Vergessen wir die ganze Sache‘. Dann ging ich und nahm den nächsten Tag frei. Unbezahlten Urlaub, versteht sich.
Als mich Beckstein tags darauf um fünf Uhr morgens sah, wirbelte er in seinem Drehstuhl herum und Hemd und Kopf zerflossen in einem einheitlichen hochroten Ton. Seine aschfahlen Augen blickten stier aus dunklen Höhlen. Doch er sagte kein Wort. War mir sehr recht. Ich hatte bis zwei Uhr morgens mit Rosi im »Sound« getanzt und Whiskycola getrunken, eine Currywurst gegessen und Rosi anschließend gevögelt.“
Tommi schaute zu seiner Liebsten und wartete auf Bestätigung.
„Das war echt schön, Schatzi“, flötete Rosi.
„Und wie ging es mit Beckstein und dir weiter?“, fragte ich.
„Ich hatte mich zurückgelehnt und die Augen zugemacht. Der übliche Wartemodus. Um halb acht wirbelte Beckstein wieder herum. All die anderen Aushilfen hatten Arbeit bekommen oder waren zu anderen Postämtern geschickt worden, wo die Regulären fehlten.
‚Heute gibt’s nichts auszutragen. Sie können heute mal die Halle gründlich putzen!‘
Mein Gott, fünfhundert verwinkelte Quadratmeter!, dachte ich noch, dann gluckerte es in meinem Bauch.
Beckstein beobachtete meine Reaktion. Und die kam postwendend. Mein überstrapazierter Magen rebellierte mit Getöse und beförderte ganz außerhalb der postalischen Beförderungsbedingungen den Mageninhalt samt einem üblen Whisky-Cola-Curry-Bratwurst-Brötchen-Gemisch vor Becksteins Drehstuhl.
‚Okay, Beckman‘, rülpste ich und wischte mir den Mund mit dem Handrücken ab. Unter den Briefträgern war er Beckman, doch ich war der Einzige, der ihn auch so anredete. ‚Melde mich gehorsamst krank. Gehe zum Arzt. Magen-Darm!‘
Ich schleppte mich hinaus, mein Auto sprang sofort an, als hätte es auf mich gewartet, und schon war ich wieder bei meinem Schatz im Bett.“
Wieder schaute Tommi zu Rosi.
„Das war so eine schöne Überraschung!“, flötete sie.
„Verdammt wahr! Ich drückte mich an meine Kleine und war in weniger als einer Minute eingeschlafen.“
„Das allerdings war der unschöne Teil der Morgenüberraschung!“, sagte Rosi.
„Und wo bleibt bei allem das proletarische Klassenbewusstsein und dein Versuch, den vom staatsmonopolistischen System selbst unterdrückten Unterdrücker zu resozialisieren?“ Rolf meinte die Frage offenbar ernst, aber keiner hatte Lust, darauf einzugehen. Nicht einmal Peggy, die ihrem Freund gerne mal widersprach.
Am Abend gingen wir zu viert ins benachbarte Off-Kino, Peggy, Rolf, Doro und ich. Wir sahen uns den Film von Werner Herzog über das Leben Kaspar Hausers an. Als Kaspar achtzehn Jahre alt war, konnte er das erste Mal in seinem Leben das enge Kellerverlies verlassen. Eines Tages im Jahr 1828 führt ihn dieser Fremde aus seiner Zelle heraus, lehrt ihn Gehen und ein paar Sätze und lässt ihn dann in Nürnberg allein.
Kaspar wird Gegenstand der Neugierde der breiten Öffentlichkeit und in einem Zirkus ausgestellt, bevor ihn der Lehrer Georg Friedrich Daumer rettet. Mit dessen Hilfe lernt Kaspar schnell Lesen und Schreiben und entwickelt unorthodoxe Annäherungen an Religion und Logik, doch Musik erfreut ihn am meisten.
Er zieht die Aufmerksamkeit des Klerus, der Akademiker und des Adels auf sich, wird aber von einer unbekannten Person angegriffen, die ihn mit blutigem Kopf zurücklässt. Er erholt sich, wird jedoch erneut auf mysteriöse Weise mit einem Stich in die Brust attackiert – möglicherweise vom selben Mann, der ihn nach Nürnberg gebracht hat. Aufgrund der schweren Verletzung verfällt er ins Delirium, worin er Visionen vom Nomadenvolk der Berber in der Wüste Sahara beschreibt, und stirbt kurz danach.
Das gab uns genügend philosophischen Diskussionsstoff für eine lange Nacht bei Gyros und Tsatsiki im Athener Grill. Was macht das Menschsein aus? Wir kamen vom Hundertsten ins Tausendste und landeten bei den Drogen. Nun erzählten wir Peggy und Rolf, was wir in Marrakesch mit Svea erlebt hatten.
Nach unserer Rückkehr aus Marokko und nach meiner Genesung hatte ich mich sofort an eine journalistische Auftragsarbeit gesetzt. Ein Jahrestag. Ein trauriger Jahrestag für den demokratischen Sozialismus. Am 11. September 1973 hatte in Chile General Pinochet nach sorgfältiger Planung mit der CIA gegen den demokratisch gewählten Marxisten Salvador Allende geputscht. Für die antifaschistische Wochenzeitschrift »die tat« rekapitulierte ich das Geschehen in Form eines Kommentars.
Der rechtmäßig gewählte Präsident Chiles hat nicht verloren. Er ist gestorben, wie ein Revolutionär – im Kampf. Nun also, noch ein Jahr später, schwingen die Konservativen die Schlagzeilen-Keule triumphierend über den Köpfen ihrer ahnungslosen Leser: „Allende beging Selbstmord“ wiederholen die Balkenüberschriften jubelnd wie schon einen Tag nach dem faschistischen Staatsstreich. Natürlich kein Fragezeichen über dieser Lügenversion der putschenden Junta. Heute wissen wir aus vielen Quellen, dass die Militärs den Präsidenten erschossen, weil er sein rechtmäßiges Amt nicht freiwillig aufgab. „Rosa Luxemburg auf der Flucht erschossen“ – auch das war einmal eine reaktionäre Lügenversion über einen feigen Mord. Die deutsche Presse kennt viele solcher Todesnachrichten, die stets als unbezweifelbare Tatsachen-Version gemeldet wurden.
Allendes „Selbstmord“ passt ins Konzept. In der Version der Sprach- und Geschichtsmanipulateure lässt sich daraus zynisches Kapital schlagen: „Allendes letzter Coup – der Pistolenschuss zum Märtyrer“, betitelt die »Welt« ihren Bericht. Wen würgt es da nicht vor Ekel? Im Kommentar zu dieser Headline wird dann aus dem „Freitod“ eine Art freiwilliger Amtsrücktritt: Wenn sich Allende umgebracht habe, „dann wäre der Präsident in der Stunde seines Sturzes mit der letzten Konsequenz aus seinem Starrsinn zurückgetreten.“
Ergo: Die faschistische Junta regiert rechtmäßig. Das ist eine Leistung an Demagogie, vor der selbst ein Joseph Goebbels mit Respekt den Hut ziehen müsste. Seine Schüler von heute haben ihn eingeholt. Sie verstehen es sogar, aus der „chilenischen Tragödie“, wie sie einerseits heucheln, einen saftigen Kalauer zu reimen: „Allende am Ende“ (Kommentarüberschrift in der FAZ). Da kann man das brutale, schweinische Lachen jener Killer heraushören, die Salvador Allende niedermetzelten.
In den letzten zwölf Monaten wurden von der chilenischen Junta sämtliche Parteien und Gewerkschaften abgeschafft, über dreißigtausend Sozialisten, Pazifisten und Kommunisten erschossen, über vierzigtausend inhaftiert, über fünftausend sind „verschwunden“, Autodafés wie im Mittelalter fanden statt. Der französische Revolutionär Régis Debray war ein persönlicher Freund des Ermordeten. Er schrieb auf, was Allende ihm einmal sagte: „Mich wird man nicht zwingen, ein Flugzeug im Pyjama zu besteigen, und ich werde nicht um Asyl in einer Botschaft bitten.“ Für alle seine Freunde war es Gewissheit: Für den Hauptdarsteller endet das Drama nicht als Operette, wie man es so oft in den Nachbarländern gesehen hat. Die Verzagtheit dieser Leute hat Allende tief angeekelt.
Allende wusste, spätestens seit dem 29. Juni 1972, was ihm bevorstand. Damals hatte er den Putschversuch eines Panzerregiments niedergeschlagen, aber er musste feststellen, dass ihm die chilenische Armee, deren Spitze von den Gringos unterwandert war, diesen Sieg nicht verzeihen würde. Als er am Tag nach dem vereitelten Staatsstreich die Generäle der Armee in seinem Büro versammelt hatte, wurde klar: Er konnte nur auf vier von achtzehn Generälen zählen. Gleichzeitig forderte die Mehrheit der hohen Offiziere in den Kasernen offen die Absetzung dieser vier regierungstreuen Generäle, vor allem die von General Prats, dem Oberkommandierenden des Heeres, der treu zur Verfassung und dem Präsidenten stand.
Seitdem kämpfte Allende im leeren Raum. Ohne dass man wusste, woher er die sagenhafte Kraft dazu nahm. Da war einerseits die von Washington gesteuerte ökonomische Destabilisierungskampagne und da war andererseits die innenpolitische Kochtopf-Opposition der chilenischen High-Society. Doch bei Salvador Allende herrschte keine Hoffnungslosigkeit – aber auch keine Hoffnung.
Debray schildert eine Begegnung mit Allendes ältestem Freund und Berater, Augusto Olivares, den man „el Perro“ (der Hund) nannte und den Debray gefragt hatte: „Was würde passieren, wenn die Generäle von drei Armeen in sein Büro kämen, ohne vorher um Audienz gebeten zu haben, aber mit einem Ultimatum unter dem Arm.“ Die Antwort war: „Du weißt es genau, Salvador würde als erster die Waffe ziehen.“
El Perro starb mit ihm.
In mir wurde die Erinnerung an den feigen Mord an Che Guevara wach. Ich fühlte dieselbe hilflose Wut.