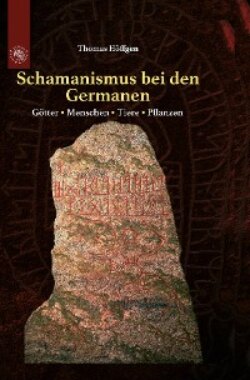Читать книгу Schamanismus bei den Germanen - Thomas Höffgen - Страница 15
Kultbäume der Germanen
ОглавлениеÜber eine Rolle Yggdrasils im Kult sei nichts bekannt, heißt es in der einschlägigen Forschungsliteratur. Dies gilt es anzuzweifeln. Zwar fällt im Kontext eines Kultes nirgendwo der Name „Yggdrasil“, aber warum auch, wenn der Baum woanders in Germanien ganz anders heißt? Tatsächlich scheinen die mittelalterlichen Nordgermanen aber ihre Heiligtümer und Naturdenkmäler explizit mit Yggdrasil assoziiert zu haben. So berichtet der Theologe Adam von Bremen im 11. Jahrhundert in seiner Hamburgischen Kirchengeschichte, dass die Heiden unweit ihres Tempels in Uppsala (Schweden) einen „sehr großen Baum“ verehren, „der seine Zweige weithin ausbreitet und im Winter, wie im Sommer immer grün ist. Welcher Art derselbe ist, weiß niemand“. Am Fuße dieses Baumes, an einer „Quelle“, kamen die heidnischen Germanen zum Kult zusammen und brachten „Opfer“ dar. Wer denkt bei der Beschreibung nicht an die immergrüne Esche Yggdrasil mit ihrer Schicksalsquelle?
Sicher belegt ist, dass die Germanen gewisse Bäume ihren Göttern weihten. Dies waren meist besonders alte Bäume, die an exponierter Stelle in den Hainen standen und in deren Schatten der jeweilige Stamm über hunderte von Jahren sich zum Thing versammelte. Die südgermanischen Chatten beispielsweise, die alten Hessen, huldigten dem Gewittergott Donar unter einer mächtigen Eiche unweit des heutigen Dörfchens Geismar – der „Donareiche“. Ein jähes Ende fand dieser Kult jedoch, als Bonifatius, der sogenannte „Apostel der Deutschen“, die heidnischen Hessen zwangschristianisierte und im Jahre 723 die Donareiche niederhauen ließ.
Die alten Sachsen verehrten einen Weltenbaum in stilisierter Form als kunstvoll gefertigte Ikone unter dem Namen „Irminsûl“ im Sauerland. Traurige Berühmtheit erlangte die Irminsûl im Jahre 772, als der Christenkönig Karl der Große in das Sachsenland einfiel und das Heiligtum zerstörte. Die einzige nähere Beschreibung dieses Weltenbaumes stammt aus dem Jahre 863 vom Mönch und Missionar Rudolf von Fulda:
Sie verehrten auch unter freiem Himmel einen senkrecht aufgerichteten Baumstamm von nicht geringer Größe, den sie in ihrer Muttersprache ,Irminsul‘ nannten, was auf lateinisch columna universalis bedeutet, welche gewissermaßen das All trägt.13
Wie die Irminsûl tatsächlich aussah, ist unbekannt. Ein ernstzunehmender Hinweis findet sich indessen an den Externsteinen im Teutoburger Wald. Die Externsteine sind eine markante Sandsteinfelsformation, die nachweislich schon in der Altsteinzeit von Menschen aufgesucht wurde. Nicht unwahrscheinlich, dass hier die Germanen einen Kultplatz hatten. An einer Seite dieses Felsens findet sich jedoch ein christliches Relief, das die Kreuzabnahme Christi zeigt. Schaut man genau hin, erkennt man etwas weiter unterhalb ein weiteres Symbol, nämlich einen abgeknickten Baum, der unter der Last des Kreuzes leidet. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein Bildnis der zerstörten Irminsûl, das Karl als Mahnmal in das heidnische Heiligtum hat eingravieren lassen.14
Das Aussehen dieser externsteiner Irminsûl ist höchst bedeutungsvoll. Es handelt sich um eine sogenannte Gabelsäule, also einen Stamm, der sich am oberen Ende in zwei Richtungen ausbreitet und eine Art „T“ bildet, eben eine columna universalis, eine „Säule, die das All trägt“. Bedeutsam deshalb, weil exakt dieselbe Form im Schamanismus bei den zirkumpolaren Kulturen Eurasiens vorkommt: Bei den Lappen lassen sich solche Gabelsäulen bis ins 17. Jahrhundert nachverfolgen, bei den sibirischen Schamanen sogar bis ins 20. Jahrhundert.