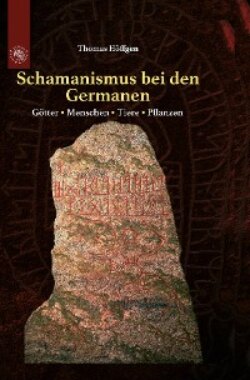Читать книгу Schamanismus bei den Germanen - Thomas Höffgen - Страница 7
Einleitung: Germanischer Schamanismus
ОглавлениеIn einer rustikalen Gaststube aus dem 19. Jahrhundert, die in dunkel-hölzernem Barock gehalten war, traf ich mich zu einem Abendessen mit dem Hochschullehrer Hasenfratz. Im Schein der Kerze offenbarte ich dem Schweizer Religionshistoriker die Idee, ein Buch zum Thema „Schamanismus bei den Germanen“ zu verfassen. Freilich ein schillerndes Thema. Der emeritierte Professor fand die Idee jedoch „höchst spannend“ und rezitierte mir sogleich den ersten Merseburger Zauberspruch in althochdeutscher Sprache – ich konterte mit dem zweiten. Hasenfratz sah mich scharf mit einem Auge an und sagte: „Natürlich macht ein solches Unterfangen Sinn. Denken Sie nur einmal an den Weltenbaum, den haben die Germanen ebenso wie alle zirkumpolaren schamanischen Kulturen. – Der Weltenbaum“, sagte Hasenfratz, zahlte das Essen und setzte im Hinausgehen seinen Hut auf, „könnte Sie tatsächlich zu den germanischen Schamanen führen“. Der Mann ließ mich verdutzt zurück, widersprachen seine Worte doch der wissenschaftlich etablierten Lehrmeinung, welche diesem Thema tendenziell mit Ablehnung entgegen tritt. Doch er machte mir auch Mut, meine langjährige Privatforschung, die zum Teil zu unorthodoxen Ergebnissen geführt hat, zu diesem kleinen Büchlein auszuarbeiten.
Tatsächlich ist das Thema „Schamanismus bei den Germanen“ bislang nur unzureichend diskutiert worden. Und die wenigen Untersuchungen, die sich damit befassen, sind gekennzeichnet durch eine geradezu hyperkritische Herangehensweise: Da ist von „Spuren“ und „schamanischen Überbleibseln“ die Rede sowie von Motiven, die „seltsam schamanisch“ sind (Eliade). Man spricht von „schamanistischen Zügen in der altisländischen Überlieferung“ (Buchholz) oder „Zügen des Schamanentums in der germanischen Überlieferung“ (Lichtenberger). Wissenschaftlicher Konsens sind nur mehr „Spuren schamanischer Praktiken“, „Formen des Schamanismus“ und „schamanoide“ Züge (Simek).
Doch sind es wirklich lediglich Spuren, Züge und Einzelheiten, die auf einen germanischen Schamanismus schließen lassen? Oder hat man bisher einfach noch nicht mehr als diese Spuren freigelegt und es außerdem versäumt, den Spuren auch ins Feld zu folgen? Erfüllt die Rede von den Einzelheiten nicht den Tatbestand der wielandschen Verwirrung, in welcher der vorsichtig-übervorsichtige Forscher nur mehr Bäume sieht, ohne sie als Teil des Waldes wahrzunehmen?
Sieht er nicht, dass es sich um Weltenbäume handelt?
In der schamanischen Kosmologie spielt der Weltenbaum eine Schlüsselrolle: Er ist Sinnbild für die axis mundi, die „Himmelsleiter“, die das Weltgefüge konstituiert und strukturiert. An seinem Stamm vermögen die Schamanen die drei Welten zu erklettern. Für den Schamanismus ist der Weltenbaum fundamental, und ohne Schamanismus macht ein Weltenbaum kaum Sinn. Dass ein solcher kosmischer Baum nun auch für die Germanen von zentraler Bedeutung war, lässt sich leichterdings belegen: In der nordischen Mythologie ist von einer Esche Yggdrasil die Rede, die das All verkörpert und in deren Schatten die Götter Rat halten. Äste, Stamm und Wurzeln dieses Baumes umfassen die drei Welten: Asgard, Midgard, Utgard. Von Odin, dem germanischen Ekstasegott, wird der Weltenbaum – eindeutig schamanisch – rituell erklettert.
Indes ist das doch keine Kleinigkeit, wenn im Mittelpunkt der germanischen Mythologie – im Zentrum des heiligen Haines – ein Weltenbaum gedeiht, also das Symbol des Schamanismus. Vielmehr lässt die exponierte Position des Baumes auf eine besondere, ja substanzielle Bedeutung des Schamanismus bei den Germanen schließen. Das ist zumindest eine ziemlich „heiße Spur“. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die germanische Religionskultur gerade doch und ganz grundsätzlich vom Schamanismus beherrscht und schamanisch strukturiert gewesen ist.
Das Gespräch mit Hasenfratz ließ mich an die Samí denken, jenes letzte indigene Volk Europas, das im zirkumpolaren Skandinavien („Lappland“) beheimatet ist. Wenngleich der Lebensraum der Samí sich über weite Teile Norwegens und Schwedens erstreckt, zählen sie doch nicht zu den Germanen; sie sprechen keine germanische, sondern eine uralische Sprache. Vermutlich wanderten die Samí kurz nach der letzten Eiszeit (ca. 10.000-5.000 v. u. Z.) aus dem nordwestlichen Sibirien nach Nordeuropa ein. Immerhin teilen sie mit den Sibiriern eine sehr spezielle Weltanschauung – den Schamanismus. Die alten Samí verehrten die Natur und gingen von der Allbeseelung des Kosmos aus sowie davon, dass ein Schamane – ein „Nojade“ – die Fähigkeit besitzt, mit dieser von Geistwesen belebten Umwelt in Kontakt zu treten. Das wichtigste Ritualgerät der samischen Nojaden war natürlich die Schamanentrommel (südsamisch: gievrie; nordsamisch: gobdas) mitsamt dem aus Rentiergeweih gefertigten Schlägel. Das Fell vieler dieser Trommeln ist bemalt mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Wesen aus der Anderswelt und Ahnengeistern. Es handelt sich um eine Art mythische Weltkarte, die es dem Nojaden möglich macht, sich während seiner Jenseitsreise orientieren zu können. Im mythologischen Bewusstsein der Samí ist diese Schamanentrommel aus dem Holz des Weltenbaums gefertigt.
Die frühste schriftliche Quelle zu den Samí ist ausgerechnet die Germania (98 n. u. Z.) des antiken Historikers Tacitus, ein Buch, das als wichtigste Quelle zur Kultur und Religion der germanischen Stämme gehandelt wird. Dass die Samí gar keine Germanen sind, hat Tacitus zwar geahnt, doch führt er sie gleichwohl in seinem ethnographischen Bericht auf, weil sie der germanischen Kultur so nahestehen. Tatsächlich trieben Samí und Germanen einen regen Tauschhandel, und es ist durchaus naheliegend, dass sie sich auch geistig-kulturell austauschten. Sollte hier der missing link liegen, durch den sich der Schamanismus – als Phänomen zirkumpolarer Völker – in die germanische Kultur transferieren lässt? Bezeichnenderweise werden in der Chronicon Norvegicum (12. Jhd.), der ältesten schriftlichen Quelle zum Schamanismus bei den Samí, die magischen Tätigkeiten der Nojaden mit den altnordischen Worten gandr bzw. galdr beschrieben, Bezeichnungen, die gleichsam zur Beschreibung der Zauberkünste der Germanen dienten. Nicht unwahrscheinlich, dass nicht nur die Worte, sondern auch die Techniken sich überschneiden. Es gibt eine Samí-Gottheit mit dem Namen Horragalles (auch Thora Galles oder Thoron), die verblüffende Ähnlichkeiten aufweist mit dem germanischen Gott Thor/Donar: Beide gelten als Wetter- und Gewittergott und werden dargestellt mit einem Hammer, so auf einer Schamanentrommel aus dem 18. Jahrhundert, die in Lappland (Norwegen) gefunden wurde. Der Frau von Horragalles, Ravdna, sind die Beeren der Eberesche heilig. In der germanischen Edda ist wiederum die Rede davon, dass die Eberesche dem Thor geweiht ist (Skáldskaparmál 18).
Zudem gibt es den berühmten Runenstein von Möjbro (Schweden). Dieses rund zweieinhalb Meter hohe germanische Kultdenkmal aus der frühen Wikingerzeit (5.-7. Jhd.) stellt kunstvoll einen von zwei Hunden begleiteten Reiter dar, der angeblich ein Schwert und einen Rundschild in den Händen hält. Als ich den Stein zum ersten Mal sah, dachte ich jedoch: „Das ist ein germanischer Schamane, der mit einem Stöckel auf die Rahmentrommel schlägt. Er reitet auf dem Schamanenpferd und wird begleitet von den Höllenhunden, den Hütern der Schwelle. Das ist der Schamanengott Odin mit seinen Krafttieren, dem Pferd Sleipnir und den Wölfen Geri und Freki“. Tatsächlich erkennt man bei genauerer Betrachtung, dass der längliche Gegenstand des Reiters an der Oberspitze eine Rundung aufweist – schlecht für ein Schwert, typisch für den Schlägel.
Dass die germanische Mythologie und Religion fürwahr alles das zu bieten hat, was man bei schamanisch strukturierten Völkern findet – Ekstasegötter und Jenseitsreisen, Zauberkünste und Zerstückelungen, Heilmagie und Liebeszauber, Trommelkult und Tierverwandlungen, Rauschorgien und Zauberpflanzen – soll dem Leser im Folgenden vor Augen geführt werden.
Wotan reitet auf dem Schamanenpferd und schlägt die Trommel. Runenstein von Möjbro (Schweden), 5.-7. Jhd.(Rundata U 877)