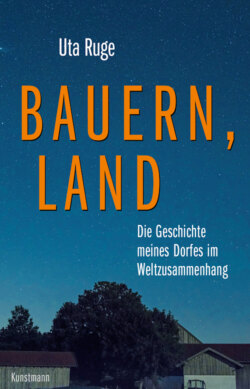Читать книгу Bauern, Land - Uta Ruge - Страница 12
4. KAPITEL DAMALS Aus einem Stall wird eine Kirche, dann ein Tanzsaal. Wie man im Winter auf Schlittschuhen überallhin kommt.
ОглавлениеGLEICH IN EINEM UNSERER ERSTEN JAHRE IM DORF gab es eine Hochzeit in der Nachbarschaft zu feiern. Wi möt na hochtied – hieß es. Wir müssen zur Hochzeit. Fast das ganze Dorf ›musste‹, und zwar nicht nur feiern, sondern auch bei den Vorbereitungen helfen. Und nach der Trauung einen Umschlag mit Geld überreichen, einen festgelegten Betrag, der den Brautleuten ein großes Fest ermöglichte. Hundert oder sogar zweihundert Gäste waren üblich.
Meine Eltern lernten schnell. Mein Vater fuhr jetzt mit anderen Nachbarn gemeinsam ›Grünes holen‹, das heißt mit Pferd und Wagen in die noch übrig gebliebene Wildnis eines nahe gelegenen Moores, in dem immer noch Torf gegraben wurde. Dort schlugen sie junge Bäume und Gesträuch, luden alles auf den Wagen und tranken viel Schnaps dabei. Wenn die Männer heimkamen, hatten die Frauen des Dorfs meist das Melken schon besorgt, die Kälber getränkt und vielleicht mit dem alten Bauern, wenn es auf dem Hof einen gab, das Vieh gefüttert. Dann mussten sie ihre schwer angetrunkenen Männer ins Bett bringen. Auch das war für meine Mutter neu.
Am nächsten Tag banden die Frauen die Kränze. Meine Mutter ließ sich von den freundlichen Nachbarinnen in alles einführen. Sie trafen sich in der Diele des nächsten Nachbarn, einige brachten Butterkuchen mit, einen auf großen Blechen ausgerollten Hefeteig, der mit Mandeln und Zucker bestreut oder mit einem Zuckerguss und geschroteten Mandeln glasiert war. Der war schnell ›abgebackt‹ worden, so nannten sie kurze Backzeiten. Zum Kuchen tranken sie reichlich Kaffee, beredeten alle Neuigkeiten, natürlich auf Plattdeutsch, und später wurde Likör ausgeschenkt.
Währenddessen errichteten die Männer am Eingang des Hofs ein Tor aus Balken und Latten, das bekränzt werden musste. Alleine für diese Einfahrt hatten die Frauen schon mehrere Meter Kranz aus Tannenzweigen und Papierrosen gebunden, die Eingangstür des Hauses wurde mit einem frischen Laubkranz geschmückt. Dazu kam die fast zwei Meter lange Buchsbaumumkränzung für das Brautsofa – und ein heimlicher Kranz aus Disteln und Brennnesseln für das Brautbett, den irgendwer irgendwann am nächsten Abend unter die Bettdecke schmuggeln würde.
Wir Kinder liefen zwischen allem umher, den Blumen aus Krepppapier, Schleifen und Bändern, aßen zu viel Kuchen, von dem uns abends schlecht war, und freuten uns am Gelächter der Erwachsenen, auch wenn einige, wie meine Mutter, streng blieben mit uns.
Trauung, Hochzeitsessen und Tanz fanden am nächsten Tag allesamt auf der Diele im Haus des Bräutigams statt, unseres Nachbarn zur Rechten. Es war, wie damals noch alle Häuser hier, ein niedersächsisches Hallenhaus, der Giebel im typischen Fachwerkstil gehalten, weiß gestrichene Balken teilten das Mauerwerk in Fächer auf, und das große Dielentor, de Grotdör, war im selben Grün gestrichen wie die beiden kleineren Türen rechts und links, die auf die Viehgänge führten, links standen die Pferde und rechts die Kühe. Hoch bepackte Erntewagen mit Heu oder Stroh konnten von Pferden oder auch dann den ersten Traktoren direkt auf die Diele gezogen werden oder rückwärts hineinbugsiert. In der hohen Balkendecke gab es eine Luke, durch die Heu und Stroh nach oben auf den Boden zur Winterlagerung gepackt wurden. Von der Diele aus, die auch bei uns noch aus Lehm gestampft war, fütterte man das Vieh. Rechts und links verliefen die dafür auf einen gemauerten Sockel gesetzten Krippen, hinter denen die mit Ketten befestigten Kühe und Rinder und ein bisschen abgesondert davon die Pferde standen. Aber man hatte auch Holzwände über den Krippen angebracht. Und so konnten nach dem Melken und Füttern, und wenn alle Arbeit im Stall getan war, die schweren Klappen, die an den Krippen nach unten hingen wie offene Türen in ihren Angeln, angehoben und am oberen Rand mit Holzknebeln befestigt werden. Damit war dann die Diele ein Raum für sich geworden und das Vieh aus dem Blickfeld verschwunden, auch wenn man es dahinter während des Tanzes noch rumoren hörte.
Die Diele unseres Nachbarn ist für die Hochzeitsfeier jetzt zusätzlich mit einem Holzboden ausgelegt, und am Ende des so entstandenen Saals ist der Altar aufgebaut. Davor steht der Pastor.
Zum ersten Mal sehe ich einen Mann in einem langen schwarzen Kleid. Er hat einen weißen Kragen um und macht ein ernstes Gesicht. Während alle singen, muss ich vor dem Brautpaar Blumen streuend auf ihn zugehen. Kurz vor ihm soll ich nach rechts abbiegen. Aber das habe ich vergessen, ich bleibe stehen und blicke zu ihm hoch. Meine Mutter, die seitlich in den Kulissen steht, zieht mich zu sich.
Dann kniet das Brautpaar schon vor dem Pastor nieder. Man hat dicke Kissen auf den Holzboden gelegt, damit die gute Kleidung nicht beschmutzt wird. Und damit die Braut sich leichter wieder erheben kann, ohne ihr Kleid zu verziehen oder den langen Schleier einzureißen.
Auch das Paar ist ernst – und sehr jung, beide sind keine zwanzig Jahre alt. Die älteren Frauen weinen. Das ganze Dorf ist gekommen, ungefähr achtzig oder hundert Menschen stehen in der Diele, nur die engsten Verwandten sitzen. Es gibt kaum jemanden, der mit der Braut und dem Bräutigam nicht irgendwie verwandt oder verschwägert ist, außer uns und noch ein paar anderen Flüchtlingsfamilien.
Nach der Trauung wird noch einmal gesungen. Die Bläsergruppe des Schützenvereins spielt. Die Gemeinde singt: »So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst geh’n und stehen, da nimm mich mit.« Es ist mein erstes Kirchenlied. Ich singe und weine mit, vom Ernst der Worte und der Feierlichkeit der Gesichter überwältigt.
Endlich lächelt der Pastor nun doch und die Gäste rascheln und husten und schnauben kräftig in die Taschentücher. Dann stellen sie sich paarweise zum Gratulieren an und übergeben das Kuvert mit dem Geldgeschenk. Wer mit dem Brautpaar angestoßen hat – Schnaps für die Männer, Likör für die Frauen –, hilft beim Hereinschaffen der Stühle und Bänke. Die Frauen decken die Tische mit weißen Tüchern, tragen das Geschirr auf und legen das Besteck aus. Wir Kinder laufen zwischen ihnen herum und stören und werden irgendwann auf den Hof gescheucht. Da stehen einige Männer vor dem Dielentor, ein wenig steif in den ungewohnten Anzügen, redend und rauchend. Onkel Edu ist auch dabei und legt mir, als ich schüchtern an ihnen vorbeigehe, kurz seine harte Hand auf den Kopf. Na, min Deern.
Da bin ich verlegen und auch ein bisschen stolz, denn so gehöre ich jetzt etwas mehr dazu. Auch die anderen Männer gucken zu mir runter. Es kommt mir vor, dass ich keinen von ihnen kenne. Aber vielleicht liegt das auch nur an den Sonntagsanzügen. Während ich mich langsam entferne, höre ich, wie Onkel Edu den anderen erklärt, wer ich bin. De Lütte von denn Niegen. Die Kleine vom Neuen. Die Große ist meine Schwester.
Die Alten haben sich inzwischen auf die Bänke im Saal gesetzt und viele Kinder schliddern über den glatten Boden, hüpfen, rufen, rennen wild durch den Saal. Junge Männer fahren sich mit dem Zeigefinger in die Hemdkragen und lockern ein wenig die zu stramm gebundenen dünnen Schlipse. Eine der jungen Frauen, deren hoch toupiertes Haar ich schon von Weitem bewundert habe, hält sich mit einer Hand am Oberarm eines Mannes fest und hebt erst den einen und dann den anderen Fuß, um mit dem Gesicht über die rechte und dann die linke Schulter blickend zu prüfen, ob sie mit den Pfennigabsätzen ihrer Schuhe womöglich Dreck mit in den Saal gebracht hat. Die vor der Dielentür Stehenden reden und rauchen weiter, und wenn eine der Ehefrauen vorbeikommt, zieht sie ihrem Mann die Hand aus der Hosentasche, weil dies ein Festtag ist und sich nicht gehört – jedenfalls solange der Pastor noch da ist.
Wenn alle Tische und Bänke aufgebaut und die Tische gedeckt sind, nimmt das Brautpaar, wo eben noch der Altar gestanden hat, auf dem bekränzten Sofa Platz, die Brauteltern und der Pastor sitzen bei ihnen. Dann tragen die jungen Leute des Dorfs mit musikalischer Untermalung in schnellem Schritt und Gleichmarsch die Hadelner Hochzeitssuppe auf – große Schüsseln mit Rindsbrühe und Reis, kleinere mit Rosinen, dazu große Platten mit Rindfleisch. Meine Eltern werden aus dem Augenwinkel die Nachbarn beobachtet haben. Zuerst nahm man sich also ein großes Stück Fleisch und schnitt es im Suppenteller in Stücke, dann häufte man Reis drauf, streute Rosinen drüber, und als Letztes kam aus großen Kellen die mit kleinen, würzigen Fleischbällchen reichlich bestückte Brühe hinzu. Jeder mischte sich die Anteile nach seinem Geschmack, dazu gereicht wird Bier und Schnaps.
Wenn alle gesättigt sind, räumen die jungen Leute wieder ab – und der erste Tanz, zu dem die drei oder vier angeheuerten Musikanten aufspielen, gehört ihnen, noch vor dem Ehrentanz des Brautpaars.
Alles das mussten unsere Eltern kennenlernen und sich darin einfügen. Denn alles war neu für sie: die Menschen, ihre Haltungen und Gebräuche, von der Architektur – den strohbedachten Häusern und Ställen – bis zu den Gerichten – Hochzeitssuppe, Butterkuchen, aber auch Bratkartoffeln mit Rhabarberkompott zum Mittag. Vor allem aber der Grund und Boden für alles, die Landwirtschaft, die aus dieser Moorerde folgte, die Geräte, mit denen der Boden bearbeitet wurde, die Holzschuhe für Mensch und Tier – auch Pferden wurden im Moor Holzschuhe angeschnallt, damit sie nicht so tief einsanken. Dazu kam die Sprache, das andere Plattdeutsch, das hier gesprochen wurde und das ihnen völlig unbekannte Wörter enthielt. Dass ein Escher ein Spaten bedeutete und ein Leuwagen ein Besen – wer konnte das ahnen?
Am schwierigsten aber war es, sich an das viele Wasser zu gewöhnen. Man musste die verschiedenen Namen der Gräben lernen, die als kleine Gräben Grüppen hießen, auf der Grenze zum Nachbarn waren sie Grenzgräben, und der besonders breite und tiefe Graben, der durch das ganze Dorf führte, nannte sich, wie gesagt, die Wettern, ausgesprochen »Weddern«, »de Weddern«. Dazu gab es noch Kanäle und Vorfluter. Und den Hadler Kanal, der war der größte und schon etwas weiter weg.
Die Wettern war die Grenze des Hofs zur Straße, zum Dorf. Von der Straße aus, die parallel zur Wettern lag, führten kleine Brücken zu den Höfen. Sie waren zwischen Dorf und Hof die Übergänge für Mensch und Tier. Dicke hölzerne Pfähle, in deren Angeln die beiden Flügel der Pforte hingen, standen links und rechts an der Wettern. Sie waren weiß gestrichen, und wer Vieh durchs Dorf trieb, ließ gerne eines der Kinder vorauslaufen, das die Pforten schloss, damit die Rinder oder Schweine oder Schafe nicht auf die Nachbarhöfe liefen. Sonst waren sie selten tagsüber geschlossen, und bei uns fehlte von Anfang an der linke Pfortenflügel. Der rechte hing, dadurch sinnlos geworden, noch lange an dem bald schon gänzlich seitwärts geneigten Pfahl. Nie kam unser Vater dazu, ihn zu reparieren oder abzubauen, und einen Altenteiler, einen Opa, der sich mit solchen Reparaturarbeiten hätte beschäftigen können, hatten wir nicht. Es dauerte nicht sehr lange, bis auch der Rest der Pforte verschwand. Nur der Pfahl auf der rechten Seite mit seinen rostigen Angeln stand noch ein paar Jahre lang da. Immerhin markierte er fürs Auge die Begrenzung der Überfahrt. Denn im Sommer setzte an den Rändern der Wettern ein so üppiges Pflanzenwachstum ein, dass das Gras, die Brennnesseln und Brombeerbüsche bis ins Wasser hineinhingen. Man musste lernen zu erkennen, wo vermutlich noch fester Boden war und ab wann man gleich schon durch das Gebüsch mitsamt den abbrechenden Grassoden ins Wasser rutschen würde.
Vor allem unsere Mutter müssen die vielen Gräben geängstigt haben. Kleine Kinder konnten leicht hineinfallen und vom tiefschwarzen Wasser verschlungen werden, ohne dass es einer bemerkte.
Neben der Brücke über die Wettern gab es unten am Wasser eine flache Stelle, wo offenbar durch viele Fuhren Sand eine Zugangsstelle entstanden war. Unser Vater trug oder fuhr die diversen Geräte und Wagen dort nahe heran, holte mit einem Eimer braunes, mooriges Wasser aus der Wettern und übergoss, was zu säubern war, schrubbte mit dem Besen und spülte eimerweise nach. Ich staunte jedes Mal, dass der Mist- und der Düngerstreuer, dass die Schaufeln, Spaten und Hacken nach dem Waschen mit so einem schwarzen Wasser wirklich sauberer waren und sogar glänzen konnten, und die eisernen Gitterräder, die manchmal zur Verdoppelung der Radfläche an die großen Hinterräder des Treckers geschraubt wurden, zeigten dann Spuren ihrer ursprünglichen Rotlackierung.
Bei Regenwetter war der kleine matschige Strand völlig aufgeweicht. So oder so diente er unseren Entenmüttern als Zugang, wenn sie im Frühjahr ihre frisch ausgebrüteten Küken zum Wasser führten. Und wir Kinder spielten dort gerne mit Matsch und Wasser – obwohl es an Matsch und Wasser an keiner Stelle des Hofes fehlte. Da setzten wir dann kleine Boote aus Baumrinde oder auch Löwenzahnkränze aufs Wasser, sahen sie wegschwimmen und versinken.
In den ersten Jahren existierte noch ein weiteres Spiel. In den Wettern lagen nämlich Baumstämme, die als Bauholz zum Härten gewässert wurden. Die Stämme waren entastet, besaßen aber noch ihre Rinde, auf deren mal trocken-bröckeliger, mal glitschig-nasser Oberfläche wir entlangbalancierten, barfuß, in Schuhen oder Gummistiefeln. Oft lagen mehrere Stämme so dicht nebeneinander, dass sie sich nicht rührten, wenn wir auf ihnen entlangspazierten. Manchmal aber drehte sich auch ein Stamm um seine eigene Achse und ein Kinderfuß konnte da leicht abrutschen oder das ganze Bein zwischen den Stämmen im moorigen Nass verschwinden. Wenn einer von uns dann ›einen nassen Fuß‹ bekommen hatte und auf Nachfragen, wie das passiert war, mit der Wahrheit rausrückte, stellte unsere Mutter uns aufgebracht vor Augen, dass man auf diese Weise zwischen den Stämmen abrutschen könnte und sich nicht ohne Weiteres selbst befreien, weil das schwere Holz der Stämme sich über dem versunkenen Kind wieder nebeneinanderlegen würde. Das jagte uns wirklich einen mächtigen Schrecken ein. Beim nächsten Mal war das Balancieren dann umso aufregender. Aber wenn wir einen Erwachsenen kommen sahen, sprangen wir doch lieber ganz schnell ans Ufer und taten harmlos.
Das Schönste aber war, wenn die Wettern im Winter zugefroren war. Als kleine Kinder fuhren wir dann mit Schlittschuhen auf dem Eis das ganze Dorf entlang. Die Brücken zu den Höfen, unter denen wir dann gebückt hindurchkriechen mussten, machten die Sache noch etwas spannender. Denn dort unten war das Eis nicht ganz so dick gefroren und überhaupt war man hier den brüchigen Rändern näher. Mit den Absätzen der Schuhe oder den scharfen Kanten der Schlittschuhe testeten wir an den kristallinen Eisrändern, ob es wohl brechen würde. Wir zogen dann, ein kleines Rudel von Dorfkindern, die nach der Schule Schlittschuh liefen, auf den Wettern durch das ganze Dorf und zurück. Und die Großen fuhren noch weiter über das Kanalsystem in die Weiten uns unbekannter Felder zu einem See, von dem es dann hieß, er sei gänzlich zugefroren, und dort gebe es eine schneefreie Eisfläche, auf der man wirklich lossausen konnte.
Gingen wir nur deshalb nicht mit, weil die Großen uns klarmachten, dass sie keine Lust hatten, auf die Kleinen aufzupassen? War es uns ausdrücklich verboten worden? Oder fürchteten wir, in der früh einbrechenden Dunkelheit auf den weiten, unbekannten Wiesen und Kanälen und auf uns selbst angewiesen nicht mehr nach Hause zu finden? Vielleicht war es auch, dass wir spätestens zum Viehbesorgen zu Hause sein mussten.
Fünf Uhr, das war immer schon der Auftakt zur letzten Runde des Tages. Für die Frauen und Kinder hieß es, die Milchkannen waschen, melken, die Kälber tränken, Enten und Hühner für die Nacht einsperren und mit Wasser und Futter versorgen. Das Füttern der Kühe und Ausmisten der Ställe besorgten die Männer.