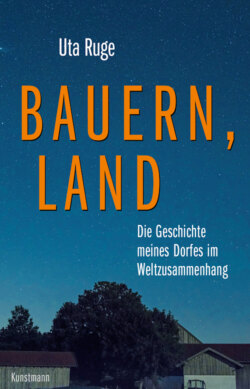Читать книгу Bauern, Land - Uta Ruge - Страница 23
13. KAPITEL HEUTE Wenn Milch- und Bodenpreise die Stimmung verderben.
ОглавлениеBEIM MITTAGESSEN IST MEIN BRUDER SEHR EINSILBIG. Ein bisschen zu munter frage ich nach den Kühen, dem Zustand im Stall, auf dem Feld.
»Auf dem Feld?«, fragt Waldemar leicht gereizt. »Was willst du da machen, solange Wasser drauf steht?«
»Und im Stall?«, hake ich nach.
»Schon davon gehört, dass gerade die Milchquote abgeschafft wird?«, sagt Hannes, der Mitleid mit seiner Tante aus der Stadt hat.
»Ach ja, stimmt, natürlich.« Mir ist peinlich, dass ich den Zeitpunkt vergessen habe, 1. April 2015. Der Milchpreis wird weiter sinken, jeder darf produzieren, so viel er will. Europaweit eingeführt worden war die Quotenregelung 1983, jedes Land der EG bzw. EU durfte nur eine begrenzte Menge Milch produzieren. Produzierte ein Hof mehr als seine Quote, musste er eine hohe Abgabe zahlen.
»Erstens«, zählt Waldemar auf, »war die Milchquote eigentlich nie dafür da, um den Preis zu stabilisieren. Es ging darum, das Milchangebot nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. In Osteuropa gab es vor dem Mauerfall einen hohen Bedarf, unser Export dorthin wurde subventioniert. Inzwischen geht es andersherum, zu unserem Binnenmarkt gehört jetzt auch der Zufluss der Milchmassen aus den landwirtschaftlichen Großbetrieben der neuen Bundesländer und der osteuropäischen Staaten der EU. Aber dafür haben wir ja jetzt den globalen, z.B. den asiatischen Markt, angeblich ist die weltweite Milchnachfrage riesig – und darunter musst du dir Milchpulver, Käse und Butter, Joghurt und Babynahrung vorstellen. Aber dann hat Russland die Schotten gegen europäische Lebensmitteleinfuhren dicht gemacht – als Strafe für die europäischen Sanktionen 2014 gegen Russland wegen der Besetzung der Krim. Und plötzlich schwächelt die chinesische Wirtschaft, und – bums, ist unser asiatischer Markt auch weg – und zu viel Milch da.«
Er holt Luft.
»Und drittens ist Milch«, fügt Hannes ein, »zu einem Rohstoff geworden, und die Verarbeiter des Rohstoffs, die milchverarbeitende Industrie, wollen den natürlich möglichst billig einkaufen.«
Er lächelt spöttisch: »Es sind nicht alle unglücklich über die großen Milchmengen und die niedrigen Preise.«
»Viertens sind«, setzt Waldemar wieder ein, »mittlerweile die Boden- und damit auch die Pachtpreise der begrenzende Faktor für unsere Produktion geworden. Land ist Spekulationsobjekt für Geldleute geworden, in erster Linie für die Agrarindustrie, die Böden ankauft für ihre Vertragsproduzenten, aber auch fachfremde Unternehmen, ein großes Brillen-Unternehmen ist dabei oder reich gewordene Medienheinis, die hier in der Gegend für sehr viel Geld viele Tausend Hektar aufkaufen – und dann Agrarsubventionen einstreichen, weil sie nun als Landwirte gelten.«
»Die stellen dann einen Geschäftsführer ein und beschäftigen ukrainische oder rumänische Pflücker oder Melker im Niedriglohn«, setzt Hannes hinzu.
Es hat den ganzen Vormittag über nach Regen ausgesehen. Jetzt kommt plötzlich ein wenig die Sonne durch.
Mein Bruder und sein Sohn heben die Köpfe. Vielleicht kann man doch mit dem Walzen anfangen, also dem Anpressen der durch Frost, Tauwetter und Regen gelockerten Grasnarbe.
Wenigstens auf den Stücken, die am festesten sind? Der Junge brennt darauf, der Alte bremst.
»Vielleicht morgen«, sagt Waldemar.
Auch die hohe Extraabgabe – ein paar Tausend Euro – drückt auf die Stimmung. Sie muss demnächst gezahlt werden für jene Kilogramm Milch – Milchpreise werden in Kilogramm gerechnet –, die man im letzten Jahr zu viel, d.h. über die eigene Quote hinaus geliefert hat. Obwohl mein Bruder schon viele ältere Kühe rausgeschmissen und meine Schwägerin rohe Kuhmilch an die Kälber verfüttert hat, rechnen sie dennoch mit einer Strafzahlung. Im Moment gibt es noch zusätzlich ein kleinliches Gehampel über die Lieferungen in den letzten Tagen der Milchquote. Um nicht noch mehr Liter aufs Konto der ›Überlieferung‹ angeschrieben zu bekommen, wollen die Bauern so viel Milch wie möglich zurückhalten und erst am 1. April abliefern. Aber das wird natürlich nicht erlaubt. Es gibt dann einen Kompromiss: 1.000 Liter werden noch vorher bei jedem abgeholt, alles andere am regulären Ablieferungstag, dem 2. April. Vorstandsentscheidung! Genossenschaft!
»Die Genossenschaft, das seid doch ihr«, sage ich.
Waldemar schnaubt. »Das Einzige, was in einer Genossenschaft stört, sind die Genossen.«
»Das musst du mir erklären.«
Ihre Vertragsmolkerei gehört inzwischen zum Deutschen Milchkontor (DMK), dem größten Milchverarbeiter des Landes; das DMK hat sechsundzwanzig Niederlassungen in zehn Bundesländern, der Hof gehört durch die traditionelle Molkerei zur Niederlassung in Zeven, früher war es Nordmilch – von ihnen kennt man als Marke vielleicht Milram. Aber eine echte Genossenschaft bei einem Milliardenumsatz-Unternehmen? Die Struktur ist wie früher im Kleinen, mit Mitgliedern, Vorstand und Aufsichtsrat. Aber jetzt gibt es einen Geschäftsführer, und der muss mehr oder weniger tun, was vom Konzern beschlossen ist.
»Die vom DMK gezahlten Milchpreise waren eher unterdurchschnittlich.«
»Kann man da nicht kündigen und zu einer anderen Molkerei gehen, die mehr zahlt?«
»Kann man. Unsere Kündigungsfrist beträgt allerdings zwei Jahre – und wer weiß, wohin die Preisentwicklung geht und wer dann wen bis dahin wieder aufgekauft hat. Der nächste Mitbewerber ist auf der anderen Seite der Elbe, da wird die Milch mächtig hin- und hergefahren. Obwohl, das könnte einem egal sein …«
»Ist es aber nicht?«
»Das ist doch Mist«, sagt mein Bruder wütend und schiebt den Stuhl schon zurück, um gleich aufzustehen, »wenn man weggeht von der eigenen Molkerei, die wir hier selbst mal gegründet haben. Zehn Kilometer von hier ist die Verarbeitung, da sind Arbeitsplätze, und unsere Milch wird in den hiesigen Supermärkten verkauft. Das ist doch bekloppt, dass man von da weggehen muss, weil ein Großkonzern sie gekauft hat! Und der hat inzwischen mehr Angestellte als bäuerliche Mitglieder – also Milcherzeuger.« Bevor ich noch nachfragen kann, ist Waldemar schon rausgegangen.
Am letzten Morgen bin ich mit den anderen zusammen um sechs Uhr aufgestanden.
Es ist schon hell, die Sonne aber noch nicht über den Horizont gekommen.
Ich denke darüber nach, wie fern uns Stadtbewohnern ein solches Leben ist, wenn der erste Gang am Morgen der in den Stall ist. Alltäglich und ein Leben lang ist vor dem Frühstück immer zuerst das Vieh an der Reihe.
Dabei geht es nicht nur ums Melken, sondern auch um das Füttern und Misten und Einstreuen, das Sichkümmern um Gesundheit und Sicherheit der Tiere, weil man ohne ›Tierwohl‹, wie es heute heißt, keine Qualität von ihnen kriegt in Sachen Fleisch, Eier, Milch, sozusagen Haut und Haar.
Der Himmel leuchtet morgendlich blau und rosa, dazu ein Vogelkonzert, Kälberblöken und Bäume, die sich im langsam abflauenden Wind wiegen.
Nach dem Frühstück fahre ich zurück nach Berlin.
In den nächsten Monaten und Jahren hat sich der Druck auf die Milchbauern verstärkt.
War der durchschnittliche Erzeugerpreis 2013, also zwei Jahre vor dem Ende der Milchquote, bei 30 Cent pro Kilo und stieg er bis zum Dezember sogar noch auf 42 Cent an, so war er im Frühjahr des Quotenendes unter 30 Cent gefallen – und weiter im freien Fall. Bis auf 19 Cent ging er herunter, Aldi senkte die Preise der Vollmilch um ein Drittel. Milchbauern landeten derweil mit Burn-out in Rehakliniken, viele gaben hoch verschuldet ihre Höfe auf. Einige nahmen sich das Leben.