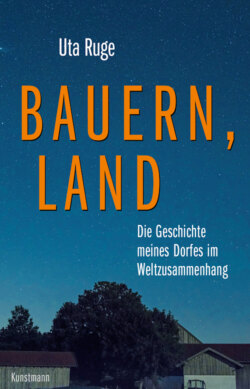Читать книгу Bauern, Land - Uta Ruge - Страница 9
1. KAPITEL HEUTE Die Stimmung auf dem Hof meines Bruders.
Оглавление»ENTWEDER, ODER«, sagt mein Bruder Waldemar. Wir stehen am Melkroboter*. Vor einigen Wochen ist der installiert worden und bedient, wie es im Fachjargon heißt, vierzig Kühe. Insgesamt kann so ein Roboter sechzig bis siebzig Kühe pro Tag melken. Im Moment läuft die Einarbeitungsphase. Noch muss man die Kühe etwas antreiben, später werden sie alleine zum Melken gehen – den ganzen Tag über und sogar nachts. Denn während ihnen der Roboter die Milch abpumpt, fressen sie das Kraftfutter, das je nach Chipkartenlesung ausgeschüttet wird. Der Transponder, ein Erkennungssender, hängt ihnen um den Hals. Jeweils vor und hinter dem Tier hält ein Gatter es auf der Stelle fest und öffnet sich erst wieder, wenn keine Milch mehr fließt und kein Futter mehr ausgeschüttet wird.
Ich staune.
»Wachsen oder weichen«, sagt Waldemar, während er mir die Neuerwerbung zeigt. »Und der Große frisst den Kleinen«, sagt er noch. »Das ist immer so gewesen. Und glaub’ man nicht, dass das bei den Biobetrieben anders ist. Dieselbe Technik, dieselben Größen.«
»Und? Gehörst du selbst inzwischen zu den Großen?«
»Nein.« Mein Bruder lacht grimmig. »Aber nicht zu den ganz Kleinen. Noch nicht.« Er betrachtet die digitale Anzeige auf der uns zugewandten Rückseite des Melkroboters. »Von den zwanzig Höfen im Dorf sind vier übrig geblieben. Alle anderen haben aufgegeben.«
Waldemar ist aus dieser Generation der Bauern im Dorf der Jüngste, das Rentenalter hat er noch nicht erreicht und er hat – anders als die meisten hier – einen Nachfolger. Sein Sohn will Bauer werden, ist es schon. Die moderne Technik, wie der Melkroboter, wird über Kredite finanziert, die man kriegt, wenn man Land besitzt.
Jetzt fallen die Zitzenbecher vom Euter ab und der Roboterarm schwenkt beiseite, um die Kuh freizulassen und das Melkgeschirr sofort zu spülen. Das vordere Gatter öffnet sich, die Kuh bewegt sich ohne Eile aus dem Melkstand hinaus, dann schließt es sich wieder. Erst wenn Zitzenbecher und Milchschläuche mit Wasserdampf gereinigt sind – es dauert nur Sekunden –, öffnet sich das hintere Gatter und lässt die nächste Kuh ein.
»Nebenan«, Waldemar zeigt zum Nachbarhof, »wird inzwischen Strom produziert, also Gas aus Biomasse. Das wird in Strom umgewandelt und ins Netz eingespeichert. Die Sauen, die sie halten, sind fast nur noch ein Anhängsel. Zwar sind sie einerseits die Grundlage des Geschäfts mit dem Strom, ebenso wie der Mais, der angebaut wird. Aber der Verkauf der Ferkel bringt weniger Geld ein als die – Entschuldigung – Scheiße, die den Strom erzeugt.«
Wir hören eine Weile schweigend dem Pumpen und Zischen, dem Brummen und Schnaufen der Maschine zu. Der Roboterarm schwenkt unter den Bauch der neuen Kuh, hebt eine Düse direkt unter das Euter, eine desinfizierende Flüssigkeit wird aufgesprüht. Erst dann kommen die frisch gespülten Zitzenbecher angefahren und saugen sich einer nach dem anderen an den Zitzen der Kuh fest. Die hat inzwischen angefangen zu fressen.
»Wie viele Melkroboter für wie viele Kühe brauchst du, um in ein paar Jahren abgeben zu können?«, frage ich. Die Hofübergabe an die nächste Generation schließt ja ein, dass der Nachfolger seinem Vorgänger ein Altenteil zahlen kann, also lebenslang Wohnung, Nahrung und ein bisschen Bargeld, so wie es mein Bruder und seine Frau Anna mit unseren Eltern gemacht haben.
Mein Bruder winkt ab. »Die Frage ist im Moment, wie viel Land wir uns leisten können, um genug Futter für das Vieh anzubauen und seine Gülle* loszuwerden. Immer mehr große Stromerzeuger kaufen und pachten Land. Und obwohl weiß Gott genug Bauern aufgeben und viel Land auf dem Markt ist, wird der Boden immer teurer.«
Mir kommt der Gedanke, dass die Übergabe an die nächste Generation womöglich nicht mehr stattfinden wird. Ich atme tief ein.
Aber Waldemar hat genug von meinen Fragen. Er steht an der Tür des Melkstands, öffnet sie und ist schon halb draußen, als er noch sagt: »So ist das nämlich. Ihr wollt ja alle Biostrom. Aber ihr habt keine Ahnung.«
Mit ›ihr‹ sind immer alle Städter gemeint – oder doch alle, die keine Landwirtschaft betreiben. Zu diesem ›ihr‹ zähle auch ich seit vielen Jahren.
Auf dem Weg ins Haus gehe ich vorbei an den neugierig ihre Köpfe durchs Futtergatter steckenden Jungrindern. Ein paar Katzen begleiten mich zur Haustür.
Die Hündin ist mit meinem Bruder gegangen.
Seit ein paar Tagen stehe ich morgens um sechs zusammen mit allen anderen auf, um zu sehen, zu hören, zu riechen, wie sich Landwirtschaft heute anfühlt auf dem Hof, auf dem ich aufgewachsen bin. Ich ziehe die Stallklamotten an und gehe nach draußen. Erst nach ein paar Tagen fällt mir auf, dass ich hier den Blick nicht heben muss, um den Himmel zu sehen. Kein Haus ist im Weg. Und ob es regnet oder bald regnen wird, wie der Wind geht, ist sofort gewusst, in Auge und Ohr und Nase eingeströmt.
Ich gehe mit ihnen in den Stall, aber ich laufe nur so mit – mal mit meiner Schwägerin Anna, die für die Kälber verantwortlich ist, mal mit meinem Bruder, der im alten Melkstand steht, mal mit ihrem Sohn Hannes, der für die Fütterung sorgt und den Roboter kontrolliert. Helfen kann ich nicht, denn kein Handgriff ist noch so, wie ich ihn kannte. Die Gebäude, die Maschinen, alles ist anders. Aber der Sonnenaufgang über den Bäumen und Weiden vor dem Hof ist derselbe. Immer schon lag das stärkste Licht am Morgen auf der Hofeinfahrt vor dem Stall. Immer schon wuselten ein paar Katzen, junge und alte, vor der Milchkammer umher, und immer schon lag in ihrer Nähe der Hund, der aufpasste, dass ihm nichts entging, vor allem kein Futter im nebenbei gefüllten Napf. Und der Stall ist immer noch ein einziger großer Organismus, Ort der Tiere, ihres Atmens, Fressens und Verdauens, ihres Wiederkäuens, ihrer Ausscheidungen und ihres Schlafs, ihrer Ruhe und manchmal ihrer Unruhe. Und der Ort von ineinandergreifenden Arbeitsabläufen.
Ich gehe da hindurch, über die Futtergänge und an den Barrieren entlang, die Tiere, fast hundert Kühe und vielleicht vierzig Jungrinder, sehen mich mit gesenkten Köpfen neugierig an.
Alles ist unter einem Dach angeordnet. Es gibt den Bereich, in dem lahmende Kühe oder diejenigen, die aus anderen Gründen nicht ganz fit sind, auf Stroh laufen und liegen dürfen, sozusagen die Krankenstube; sie können durch das den ganzen Stall durchziehende System sich öffnender und schließender Gatter zum Melkstand geführt werden und aus ihm zurück in ihren Bereich gehen. Neben ihnen stehen ebenfalls auf Stroh die Kühe, die demnächst kalben und – im Unterschied zu den ›melkenden Kühlen‹ – ›trocken stehen‹. Eine oder zwei haben vielleicht schon gekalbt, und dann liegt zwischen ihnen ein frisch geborenes Kalb, das sich auf zittrige Beine erhebt und nach dem Euter der Mutter sucht. Heute sind es sogar zwei, die sich manchmal zur falschen Kuh verirren, aber immer wieder von der Mutter gefunden werden. Mit Rührung sehe ich, dass die anderen Kühe die Kleinen freundlich beriechen und neugierig zusehen, wie das eine schon ein paar Probesprünge macht und das andere kläglich blökt. Aus dem Weg gehen sie ihnen nur, wenn sie bei ihnen zu saugen versuchen.
Der größte Bereich im Stall ist der, in dem die ›melkenden Kühe‹ sind, wiederum aufgeteilt in den Bereich, in dem die ›Roboterherde‹ ist, und in den größeren, in dem noch konventionell gemolken wird. Denn ein Roboter schafft, wie gesagt, nur sechzig bis siebzig Kühe – einen zweiten Melkroboter wird man sich erst in ein paar Jahren leisten können. Die konventionell gemolkenen Kühe werden morgens und abends in einen abtrennbaren Bereich direkt vor dem Melkstand getrieben. Hinter ihnen schließt sich wiederum ein Gatter, sodass die noch ungemolkenen getrennt bleiben von denen, die nach dem Melken zurückkehren in den Stall.
Ich gehe an Hund und Katzen vorbei zum Melkstand, klettere in die Melkergrube zu Waldemar und Anna. Rechts und links von ihnen stehen je vier Kühe auf Schulterhöhe, von Gestängen an ihrem Platz gehalten. Sie legen ihnen die Melkgeschirre an, tragen dabei Handschuhe, schützen sich und die Tiere vor Keimen. Mich nehmen sie sozusagen nur aus den Augenwinkeln wahr und ich muss sehen, dass ich ihnen nicht im Weg stehe.
Aus der Gruppe der noch ungemolkenen Kühe kommen durch Schiebetüren die nächsten herein, wenn eine Kuh fertig ist. Türen und Gestänggatter werden vom Melkstand aus von Seilen bedient, teils gehen sie automatisch. Die nächste Kuh wird durch das hier herrschende System sich öffnender und schließender Gatter auf ihren Platz geleitet, kommt an, und gleich wird ihr Euter, wie gesagt, auf Schulterhöhe der Melkenden, besprüht, gewischt, mit ein paar Handgriffen angemolken und die Zitzenbecher angelegt.
Wenn einmal nicht gleich die nächste Kuh nach dem Öffnen der Melkstandtür den Melkstand betritt, steigt mein Bruder oder seine Frau eine Metalltreppe hoch, gehen durch eine schmale Tür zu den ungemolkenen Kühen und treiben nach. Da sind die Neuen oder die Scheuen oder diejenigen, die zu oft von hierarchiehöheren Kühen abgedrängt worden sind. Schnell und dabei doch ruhig gehen sie dann zurück in die Grube und prüfen, welche der acht gleichzeitig gemolkenen Kühe jetzt so weit ist, dass ihr das Geschirr abgenommen werden kann – sehen währenddessen darauf, ob die vier zwischen Becher und Schlauch gesetzten Gläschen anzeigen, dass auch wirklich jedes Euterviertel ausgemolken ist, und prüfen aus dem Augenwinkel die digitale Anzeige der Milchmenge. Es gibt Kühe, die ihre Milch ›verhalten‹, vielleicht weil sie krank sind oder brünstig oder aus irgendeinem anderen Grund. Kühe sind empfindliche Tiere und man muss so einiges im Auge behalten, besonders bei einer großen Herde, in der es dann beim Melken ein paar Minuten Zeit gibt, um jede einzeln in Augenschein zu nehmen.
Ich registriere das Sich-nicht-mehr-bücken-Müssen, die-Milch-nicht-mehr-tragen-Müssen. Früher haben wir auf einem Melkschemel dicht an der Kuh gesessen, den Kopf in ihre Flanke gestützt, Hände am Euter oder am Milchgeschirr der Kuh, die angekettet im Stall stand – im Winter standen sie fünf oder sechs Monate am selben Fleck. Wenn die Kuh ausgemolken war und wir den Deckel mit dem Pulsator, der den rhythmisch pulsierenden Sog für das Melken produzierte, auf einen zweiten Eimer gesetzt, die nächste Kuh per Hand angemolken und ihr das Sauggeschirr angelegt hatten, griffen wir den vollen Eimer und eilten mit der Milch durch den Mistgang zur Milchkammer, hoben den Eimer hoch, schütteten die Milch durch ein Sieb in die Kanne, eilten zurück, passten auf, im Gang nicht in der Jauche auszurutschen. Und immer so weiter, bis die zehn, später zwanzig und dreißig Kühe ausgemolken waren.
Jetzt wird die Milch direkt vom Euter durch ein Rohrsystem zum Tank geführt. Es herrscht große Sorgfalt im Schutz gegen Bakterien. Am Ende des Melkvorgangs wird das Euter wieder mit einer desinfizierenden Lösung besprüht. Dann öffnet Waldemar per Seilzug das vordere Gatter des Stands, während sich schon das hintere Gatter öffnet, um die nächste einzulassen. Wie mein Bruder und seine Frau hin- und hergehen in der Grube – und ich sie möglichst nicht störe –, ihr Alles-im-Blick-Haben, ihre Handbewegungen, das ist schnell, effizient, tänzerisch elegant trotz der Störungen. Eine Kuh schlägt das Geschirr mehrmals ab, bei einer anderen Kuh hängt das Geschirr zu tief und muss abgestützt werden, genau in diesem Moment aber rutscht das stützende Holz- oder Plastikstück heraus und das Geschirr fällt zu Boden, die nervöse Kuh tritt darauf. Da bewährt sich, was alle, die mit Tieren arbeiten, gelernt haben: Abstand halten, langsame Bewegungen, eine ruhige Stimme, klare Gesten des Beruhigens oder Leitens. Es ist, als ob sich das gemächliche Tempo dieser großen Tiere auf die Menschen, die mit ihnen arbeiten, übertragen hat. Ich erkenne wieder, was ich als Kind selbst gelernt habe. Das ist geblieben.
Nach einer Weile sehe ich dann vom Futtergang aus zu, was die Tiere tun, wenn sie vom Melken kommen. Viele gehen erst einmal zur Tränke und trinken in großen Schlucken. Manch eine geht auch gleich zum Futtertisch und guckt, ob da inzwischen frisches Futter liegt, oder sie spaziert mit ihrem Transponder um den Hals zur Ausgabestelle für das Kraftfutter und probiert, ob ihr der Apparat nach sekundenschnellem Einlesen ihrer Kennziffer vielleicht Nahrung zuteilt; in diesem, dem sogenannten konventionellen Melkstand wird kein Futter beim Melken ausgegeben. Eine andere tritt vielleicht unter eine der großen Bürsten, die von der Stalldecke herabhängen, und lässt sich durch ihr Darunterhergehen den Rücken und die Flanken bürsten; die Nächste zieht es zum Mineralsalz eines Lecksteins, den sie mit kräftiger Zunge bearbeitet. Und manche sucht sich eine Freundin – alle ranggleichen Kühe sind Freundinnen –, deren Hals oder Kopf sie beleckt oder sich von ihr belecken lässt.
Ich finde es schwierig, dabei zuzusehen, ohne selbst die Hände zu rühren, während Waldemar, Anna und Sohn Hannes auf ihren Arbeitsgängen vorbeieilen – Kälber tränken, Kühe melken, Jungrinder füttern.
Waldemar hat schlechte Laune. Nach dem Melken sitzen wir am Frühstückstisch, er liest in der Zeitung. Wütend macht ihn nicht, dass sie vor dem Kaffee schon zwei Stunden gearbeitet und das Vieh besorgt haben und dass dies trotz Melkroboter schon wieder gut zwei Stunden dauert, weil viele Stärken* aus der eigenen Nachzucht, also Erstkalbende hinzugekommen sind, die Herde gewachsen ist und damit auch die Menge der zu fütternden Kälber. Das ist ja, was er gewollt hat: Wachstum. Die höhere Arbeitslast ist nur die logische Folge.
Mein Bruder nimmt das Brot aus dem Toaster, legt sich eine Scheibe auf sein Brett, wirft die andere mit zu viel Schwung auf den Brotteller in der Mitte des Tischs. Sie fällt daneben. Meine Schwägerin und ich sehen uns schweigend an. Ich nehme die Scheibe, Anna schenkt ihm Kaffee in den hingehaltenen Becher.
Wir kauen, trinken Kaffee, reichen uns dies und das.
Ich lobe die Kürbismarmelade.
Anna erzählt, dass eine ihrer Töchter ihr einen großen Topf mit schon geschnittenem Kürbis gebracht hat. Den musste sie sofort verarbeiten, und da hat sie eben Marmelade gekocht. Ich bewundere, wie sie sich immer wieder etwas Neues einfallen lässt. Auch das weiche, gelbliche Kürbisbrot war ein Erfolg.
»Na«, sage ich nach einer Weile, »wo drückt der Schuh?«
Waldemar schnaubt nur: »Frag lieber, wo er nicht drückt.« Dann liest er weiter die Zeitung. Schließlich schiebt er sie mir hin. »Lies selbst«, sagt er.
Es sollen in Niedersachsen neue Feuchtgebiete geschaffen werden, Moore renaturiert. Das Wasser soll wieder die Weideflächen erobern dürfen – zum Nutzen der Artenvielfalt von Flora und Fauna.
Die Zeitung berichtet von heftigen Diskussionen. Es werden die Argumente von Befürwortern und Gegnern wiedergegeben. Aber sie nimmt nicht Partei für die Bauern. In einer Gegend wie dieser, die derartig von der Landwirtschaft geprägt ist, wundert mich das.
Aber als ich das sage, blickt mein Bruder mich nur verärgert an.
»Was denkst du denn? Wo lebst du? Wir sind doch in den Dörfern längst eine Minderheit. Auch auf dem Land fühlen sich die meisten durch uns nur gestört – durch unsere schweren Maschinen auf den Dorfstraßen, die man nicht überholen kann, durch den Gestank der Tiere, die nun mal Mist machen, durch unsere Silagehaufen*, auf denen so hässliche alte Gummireifen liegen, durch den Mais, der hier steht statt des hübschen Roggens und der Rüben von früher …«
Er winkt ab und steht auf. Im Weggehen sagt er: »Hauptsache, eure Kühlschränke sind voll.«
Dann ist er draußen.
Am nächsten Morgen, es war mein letzter, versuchte ich noch einmal, meinen Bruder Waldemar zum Helden für meine Geschichte zu machen. Ich fragte ihn, aber er hat nur gesagt: »Das interessiert doch sowieso keinen Menschen.« Dann hat er den Kopf geschüttelt, ist aufgestanden, hat seiner Frau gesagt, auf welchem Feld er jetzt arbeiten und wann er zum Mittagessen zurück sein wird, hat im Gehen sein Handy auf Nachrichten überprüft, im Flur seine Stiefel angezogen und weg war er. Mit ihm ist auch mein Neffe Hannes aufgestanden und hinausgegangen.
Als ich noch ein Kind war, endeten Gespräche bei uns auch schon so. Dass unser Vater aufstand und zurück an die Arbeit ging, in den Stall oder aufs Feld.
Reden nützt sowieso nichts, war Teil der Botschaft. Der andere Teil war, dass die Arbeit nicht von allein fertig wird, und dass man, je eher man anfing, desto eher mit ihr fertig sein würde. Obwohl die Arbeit eigentlich nie fertig wurde. Aber darüber konnte und wollte keiner nachdenken. Das hätte ja auch nichts genützt.
Mit meiner Schwägerin räumte ich den Frühstückstisch ab. Sie fuhr mich zum Bahnhof und ich kehrte zurück in die Stadt.
* Worte, die mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, werden im Glossar ab S. 471 erklärt.