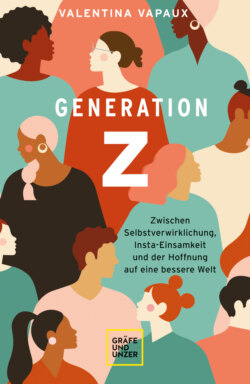Читать книгу Generation Z - Valentina Vapaux - Страница 10
SOCIAL-MEDIA-SUCHT IST PROFITABEL
ОглавлениеVon Psycholog:innen und Steinzeitfeuilletonist:innen wird Generation Z gern als iGen, Generation Selfie oder als Zoomers bezeichnet. Dazu muss man eigentlich gar nichts sagen. Es ist sehr unterhaltsam, Artikel zu lesen, die Titel wie »Leben für die Likes« tragen und dann mit Sätzen beginnen wie: »Selfies sind zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Sie werden im Netz geteilt und geliked. Um aber möglichst viele digitale Herzen zu erobern, müssen die Schnappschüsse schon etwas hermachen.«1
Moin, Klaus, du hast es voll raus. Ich geh dann mal wieder rein ins Netz, paar Herzen erobern! Irgendwer ist vor einigen Jahren dann auch auf die bescheuerte Idee gekommen, dass Smombie (I know, don’t get me started), also Smartphone und Zombie, das Jugendwort des Jahres ist. Der Joke an dem Ganzen war aber, dass das Wort bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal im Internet aufgetaucht war. Irgendein Kultur-Jürgen dachte sich wahrscheinlich, das sei absolut genial. Jugendkultur ohne Internet. Ja klar, let’s go!
Texte von Boomern und Gen-X-Autor:innen zeigen, dass Welten zwischen den Generationen liegen. Die Sprache ist ganz anders, irgendwie ulkig. Vor allem wenn so von oben herab über »unsere« Themen geschrieben wird. Und trotz der klaffenden Lücke und des mangelnden Diskurses haben Jürgen und Klaus und all die anderen irgendwie recht. Auch wenn ihre Analysen oft sehr eindimensional sind und wir mehr als stumpfe Smombies sind, so sind wir doch vor allem eins: fucking Social-Media-süchtig.
Die sozialen Medien können inspirierend und unterhaltend sein, doch sie machen uns auch oft traurig, einsam oder depressiv. Aber wie ist es möglich, dass eine ganze Generation, eigentlich sogar ein Großteil der Menschen, so stark von einem kleinen metallenen Ding abhängig geworden ist?
»Menschen sind soziale Wesen« ist so ein Satz, den man gern mal in eine Deutschklausur reindrückt, um schlauer zu wirken. Vielleicht passt er nicht in jede beliebige Dramenanalyse, aber er beinhaltet eine tiefere Wahrheit über uns. Wir brauchen andere Menschen, deren Präsenz, deren Anerkennung, deren Meinung und deren Halt, um zu überleben. In den sozialen Medien wollen wir genau diese Bedürfnisse befriedigen.
Der Neurowissenschaftler Dar Meshi war der Erste, der die Wirkung von sozialen Medien anhand eines MRT-Gehirnscans analysierte. Die Untersuchungen ergaben, dass Likes, Kommentare und Nachrichten das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktivieren.2 Evolutionsbedingt ist unser Körper darauf abgestimmt, lebenswichtige Handlungen wie Essen oder Sex als positiv zu empfinden, sodass wir diese immer und immer wiederholen möchten.
Was wir wollen, ist das Glückshormon Dopamin. Soziale Medien nutzen das Prinzip und basieren fast alle auf einem Instant-Gratification-System: Wir wollen sofortige Belohnung. Bei jedem Like setzt unser Gehirn Dopamin frei und wird somit langfristig auf schnelle, kurzlebige Dopamin-Highs programmiert. Und davon braucht es dann immer mehr.
Wir sehen Instagram-Likes und TikTok-Views als Beweise für unsere Beliebtheit. Sie erfüllen unser Bedürfnis nach Anerkennung. Und dabei geht es vor allem um Quantität. Instagram und alle anderen sozialen Medien basieren auf Zahlensystemen, die unsere Popularität direkt messbar und vor allem vergleichbar machen. »Möglich gemacht wurde das alles durch Gamification, das Anwenden von aus Spielen bekannten Mechanismen auf reale Situationen und Herausforderungen.« Wir leben in einem riesengroßen Casino. Soziale Medien sind unsere Slotmaschinen und wir sind zu High-Score-Chasern von digitaler Aufmerksamkeit geworden.3
Aber warum ist das so? Warum haben die Mittzwanziger-Genies im Silikon Valley das genau so entwickelt? Das Ergebnis liegt eigentlich bereits im Aufbau und der Struktur der Programme und Apps, die uns heute so sehr prägen. Das Ziel von sozialen Medien wie Instagram, TikTok, Twitter, YouTube oder Tumblr ist, dass wir sehr viel Zeit auf ihnen verbringen. Das ist notwendig, um möglichst viele Daten über uns zu sammeln. Damit kann uns dann eine noch personalisiertere Werbung angezeigt werden, und die soll uns zu einer Kaufentscheidung inspirieren. Je mehr wir durch Social Media scrollen, desto mehr lernt der Algorithmus über unser Verhalten, unsere Wünsche, unsere Unsicherheiten und unsere Träume. Der Spätkapitalismus hat uns beigebracht, die kreisenden Gedanken mit Konsum zu stillen.
In der Frontline-Dokumentation »Generation Like« erklärt der Journalist Douglas Rushkoff: »Wenn ein Teenager online etwas liked, ein Produkt oder eine Marke oder einen Star, wird es Teil seiner Identität, die er dann auch (über seine Social-Media-Kanäle) in die Welt broadcastet. (…) Und die Jugendlichen dazu zu bringen, sich für etwas zu interessieren, ist ein großes Geschäft. Deshalb ist es für die Unternehmen so wichtig, dass die jungen Menschen online bleiben, klicken, liken und tweeten.«4
Jeder kennt das subtil gruselige Gefühl, über ein Produkt zu sprechen und es am nächsten Tag vorgeschlagen zu bekommen. Viele glauben, dass die sozialen Medien mithören und unsere Gespräche verarbeiten. Und das ist teilweise auch der Fall (Smart TV, Alexa etc). Jedoch sind das (noch) zu große Datenmengen, als dass die Werbeindustrie sie effizient nutzen könnte. Aber wie kann es dann sein, dass Instagram weiß, dass ein rosa Kühlschrank oder ein lila gefärbtes Spitzentop mich für einen Moment glücklich machen würde?
Wir werden nicht abgehört, der Algorithmus hat uns einfach nur in den Tausenden von Stunden, die wir dort verbracht haben, so gut analysiert und kennengelernt, dass er Produkte, die wir haben wollen, schon voraussieht, bevor wir selbst wissen, dass wir sie unbedingt brauchen.