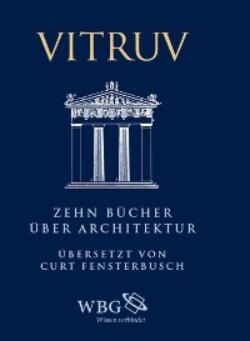Читать книгу Zehn Bücher über Architektur - Vitruv - Страница 9
Die Quellen
ОглавлениеDie Quellenforschung hat bei Vitruv z.T. mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Den Stoff für sein Werk boten Vitruv 1. der Unterricht bei verschiedenen Lehrern, 2. eigene Erfahrung und eigene Beobachtungen,
3. eine große Anzahl von, vornehmlich griechischen, Fachschriftstellern.
Verhältnismäßig leicht lassen sich die Abschnitte erkennen, in denen V. wiedergibt, was er seinen Lehrern verdankt, weil er diese Abschnitte durch Hinweise wie quemadmodum a praeceptoribus accepi (z.B. 91,11) kennzeichnet. Ob er hier, wie Sontheimer meint, zu „Unterrichtszwecken zugeschnittene Auszüge aus der Literatur der Alexandrinerzeit“ zu Grunde gelegt hat oder eigene bei den Vorträgen seiner Lehrer gemachte Notizen, muß dahingestellt bleiben. Wer die Lehrer waren und wie sie hießen, wissen wir nicht und werden wir wohl nie erfahren, da Vitruv trotz der hohen Verehrung, die er für seine Lehrer hegt, nirgends ihre Namen nennt.
Auf eigene Erfahrungen aus seiner praktischen Tätigkeit als Geschützbauer weist V. 269,11 (quae ipse faciundo cognovi) auf eigene Beobachtungen bei der Besprechung der Wasserquellen 204,7 (nonnulla ipse per me perspexi) hin. Sicherlich haben sich aber die eigenen Beobachtungen, die V. in seinem Werk verarbeitet hat, nicht auf solche an Wasserquellen beschränkt. Als Teilnehmer an den Feldzügen Caesars in Spanien, Gallien9 und Britannien bot sich ihm ja zu Beobachtungen verschiedenster Art reichlich Gelegenheit. Zweifellos geht z.B. das, was V. 59,17 über die Unverbrennbarkeit des Lärchenholzes sagt, auf eigene Beobachtung bei der Belagerung von Larignum zurück. Freilich steht hier die Quellenforschung oft vor Schwierigkeiten und Unsicherheiten, da V. außer an der oben angeführten Stelle keine Hinweise gibt. Jedoch läßt z.B. die malerische Ortsbeschreibung von Halikarnaß (49,26) darauf schließen, daß V. hier aus eigener Anschauung schildert, also (vielleicht auf einer Studienreise?) einmal in Halikarnaß war und dann wohl auch andere Orte Kleinasiens besucht hat.
Bei den Fachschriftstellern nennt V. nur vereinzelt für besondere Abschnitte ihre Namen, z.B. 8,5 Pytheos (ait in suis commentariis), 110,25 Aristoxenos (ex Aristoxenis scripturis interpretabor), 260,20 Ktesibios, 275,18 Diades. Im allgemeinen jedoch faßt er die Schriftsteller in Katalogen zusammen, ohne im einzelnen anzugeben, für welche Stelle er einen der im Katalog genannten Schriftsteller benutzt hat. So werden beispielsweise von den 12 Schriftstellern über das Maschinenwesen, die er 162,2ff. als seine Quellen anführt (quorum ex commentariis, quae utilia esse his rebus animadverti, collecta in unum corpus coegi), 6 später überhaupt nicht wieder erwähnt10. In solchen Fällen wird die Quellenfrage schwierig, so daß die Ergebnisse der Quellenforschung, soweit sie gesichert erscheinen, nur in großen Zügen wiedergegeben werden können.
Außer Zweifel steht, daß die naturphilosophische Weltanschauung, die im ganzen Werk immer wieder zum Ausdruck kommt, aus Lucretius de rerum natura geflossen ist. Von lateinischen Schriftstellern hat Vitruv sonst noch aus Varros antiquitates und de re rustica geschöpft. Für den Abschnitt über die Wasserquellen (192,10ff.) ist außer einem Einschub aus der Mirabilienliteratur und eigenen Beobachtungen Vitruvs von den 204,6 genannten Schriftstellern Poseidonios die Hauptquelle. Auch die Geographie der Rassen (134,32ff.) dürfte als aus Poseidonios stammend anzusehen sein. Für die astronomischen Kapitel im 9. Buch schließlich ergibt sich als Hauptquelle, neben einer Aratparaphrase und einer wohl nach einem Globus gearbeiteten Schrift, Arat11.
Die oben besprochenen Quellen haben den Stoff für den größten Teil des Werkes geliefert, aber doch auch wieder nicht allen. Aus Vitruv selbst als schöpferisch-planendem Baumeister stammt der Entwurf der Basilika in Fano (106,12ff.). Und daß auch der Gedanke, das Wasser in die Stadt Rom von 3 getrennten Sammelbecken aus zu leiten, von Vitruv stammt, zeigen seine Worte 207,13: haec autem quare divisa constituerim, hae sunt causae, wie man sich denn überhaupt bei den technischen Kapiteln über die Wasserleitung (205,17ff.) des Eindrucks schwer erwehren kann, daß hier der Wasserbauingenieur Vitruv, ohne auf eine Quelle zurückzugreifen, zu uns spricht. Vielleicht gehört zu diesen von Vitruv selbst erdachten Entwürfen auch die Grundrißkonstruktion des theatrum latinum. Jedenfalls legt der verkrampfte Versuch, mit 5 Dreiecksecken die compositio scenae zu bestimmen, den Gedanken nahe, daß es sich hier um einen (nie zur Ausführung gelangten!) Reißbrettentwurf handelt, zu dem die (in Priene wirklich angewandte) Grundrißkonstruktion des theatrum Graecorum mit Hilfe von 3 Quadraten als Vorbild gedient hat. Sicher läßt sich auch sonst noch rein vitruvianisches Gedankengut ausfindig machen (z.B. die Kritik an der zeitgenössischen Wandmalerei 173,1), und es wäre angebracht, daß die Quellenforschung auch hierauf einmal ihr Augenmerk richtete.