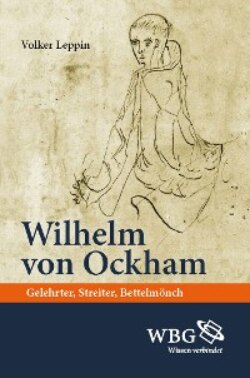Читать книгу Wilhelm von Ockham - Volker Leppin - Страница 16
5. Die Sentenzenvorlesung in Oxford
ОглавлениеDie Sentenzenvorlesungen des späten Mittelalters sind nicht nur die erste Vorlesung des angehenden Theologen, sie sind oft auch das originellste und grundlegende Werk. Zum ersten Mal darf hier jemand nach Jahren des Studiums eigenständig agieren, darf Fragen zur Entscheidung führen. Die Grundlage für diese Vorlesung, die ihr auch den Namen gab, war die Sentenzensammlung des Petrus Lombardus (1095 – 1160). Das Buch des Pariser Kathedralschullehrers und späteren Bischofs von Paris war ein typisches Produkt der geistigen Welt des 12. Jahrhunderts und steht als solches neben zwei anderen Standardwerken aus dieser Zeit, die das Denken bis weit in das späte Mittelalter hinein geprägt haben: dem „Decretum Gratiani“, dem kirchenjuristischen Handbuch des Bologneser Juristen Gratian und, etwas älter, der „Glossa ordinaria“, dem durchgehenden Bibelkommentar aus der Schule des Anselm von Laon (1050 – 1117).
Petrus Lombardus hatte aus den Sentenzen der Väter ein Buch zusammengestellt, das durch seinen klaren Aufbau für den schulischen Gebrauch bestens geeignet war. Seine Sentenzensammlung war in vier Bücher eingeteilt, die gewissermaßen den Weg von Gott zu den Menschen und wieder zurück zu Gott nachzeichneten. Das erste behandelte die Trinität, das zweite die Schöpfung, das dritte Menschwerdung Christi und Erlösung und das vierte die „Zeichen“, wie der Lombarde es in Anlehnung an Augustin umschrieb, das hieß: die Sakramente. Die einzelnen Bücher wiederum waren in Distinktionen eingeteilt – damit war das Hauptgeschäft des Werkes bezeichnet: die saubere Unterscheidung der Begriffe. Der Lombarde selbst beschränkte sich auf wenige Hinweise, meist Erklärungen, was in dem jeweiligen Buch oder der jeweiligen Distinktion, die in der Regel wiederum in mehrere Kapitel unterteilt war, behandelt werden musste, und auf das Sammeln einschlägiger Zitate.
Dabei darf man die Bedeutung solchen Sammelns freilich nicht unterschätzen: Die selbstständige und vollständige Lektüre einer alten theologischen Schrift dürfte im Mittelalter eher die Ausnahme gewesen sein. Was man von den Vätern wusste, hatte man aus den einschlägigen Sammlungen. Das bedeutete auch: Man wusste es in eben der steinbruchartigen Weise, in der die Kirchenväterzitate in die jeweilige Sammlung aufgenommen worden waren. Auch bei Ockham selbst lässt sich nachvollziehen, dass etwa von Werken zur Bibelauslegung vorscholastischer Autoren lediglich vier Zitate aus seinem Sentenzenkommentar weder in der „Glossa ordinaria“ noch in der Sentenzensammlung des Petrus Lombardus nachweisbar sind50: Was er von den Alten wusste, wusste er fast ausschließlich aus zweiter Hand. An einen Gelehrten, der Augustin, Gregor den Großen oder Hieronymus von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hätte, braucht man bei ihm nicht zu denken – seine Lektürezeit scheint viel eher für die modernen Autoren gebraucht worden zu sein.
Doch ging die Bedeutung der Sentenzensammlung über eine solche Funktion als Zitatenschatz weit hinaus – hierfür konnten ja unter Umständen auch die üblicherweise verwendeten Florilegien von Zitaten herhalten. Der umfassende, bei aller methodischen Modernität theologisch weitgehend konservative Charakter des Werkes und seine Bindung an die Stadt Paris, die bald zum Zentrum theologischer Gelehrsamkeit werden sollte, bescherten den Sentenzen einen rasanten Erfolg, der noch durch eine Zufälligkeit verstärkt wurde: Das vierte Laterankonzil (1215) verurteilte den kalabresischen Abt Joachim von Fiore (ca. 1135 – 1202) wegen Ansichten, die nicht mit seiner abenteuerlichen Geschichtstheologie zusammenhingen (s. u. S. 157), sondern mit seiner Trinitätslehre: Joachim hatte sich gegen eine Stelle aus der fünften Distinktion des ersten Buches der Sentenzensammlung des Lombardus, also gegen einen Satz aus der Trinitätslehre gewandt, indem er dem Lombarden vorwarf, zu lehren, in Gott gebe es neben den drei Personen eine ihnen gemeinsame Wesenheit als eine dritte Entität, so dass man nach Joachim eigentlich, wollte man Petrus Lombardus folgen, eher von einer Quaternität, einer Vierfaltigkeit, als von einer Trinität zu sprechen hätte. Der Konzilspapst Innozenz III. (1198 – 1216) erklärte ausdrücklich gegen Joachim von Fiore:
„Wir aber glauben und bekennen unter Billigung des heiligen Konzils mit Petrus Lombardus, dass es eine bestimmte höchste Entität ist, freilich unverstehbar und unaussprechlich, die wahrhaft Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, drei Personen zugleich, und jede von ihnen als Abdruck aufeinander bezogen. Und daher gibt es in Gott nur eine Trinität und keine Quaternität.“51
Eine herausragende Nobilitierung für ein akademisches Lehrbuch! Der Papst selbst und sein Konzil zitierten es und machten sich seine Position zu Eigen – und dies just in der Zeit, als sich in Europa die verschiedenen Schulen zu Universitäten zusammenschlossen, allen voran in Paris. Damit war der Weg für die Sentenzensammlung des Lombarden geebnet, das erfolgreichste Lehrbuch zu werden, das es in der Geschichte der Theologie je gegeben hat.
Jeder angehende Doktor der Theologie musste fortan vor seiner Promotion eine Vorlesung über die Sentenzen des Lombarden gehalten haben, jeder Student musste sie hören. Entsprechend umfangreich ist die Sammlung der heute – meist handschriftlich – noch erhaltenen Kommentare. Einer der letzten, nur in wenigen, abgekürzten Bemerkungen erhalten, stammt von Martin Luther, der 1509 / 10 in Erfurt über die Sentenzen zu lesen hatte.52 Damit endete dann auch bald die Wirkungsgeschichte der Sentenzensammlung, die aber seit ihrer Entstehung immerhin ein gutes Vierteljahrtausend umfasste.
Gerade die Dauer dieser Wirkungsgeschichte führte freilich auch dazu, dass sich die Gestalt der Vorlesungen weiter änderte. Das zeigt sich in besonderer Weise an dem Prolog, der immer umfangreicher wurde. Die universitären Anforderungen brachten auch ein geschärftes Bewusstsein für Fragen nach dem Status der Theologie als Wissenschaft an der Universität mit sich. Hierfür hatte der Lombarde noch kaum Raum erübrigt: Er begnügte sich im ersten Kapitel der ersten Distinktion mit einigen wenigen, auf den Bahnen des Augustin erfolgenden Ausführungen dazu, dass alle theologische Lehre von Sachen und von Zeichen handele53 , um dann gleich zu den Sachen selbst, zum Verhältnis des Menschen zu Gott zu gelangen. Die erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Problematik, die die präzise Aristotelesrezeption der folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte mit sich brachte, war dem Gelehrten in der Mitte des 12. Jahrhunderts noch fremd.
Doch brachten die Sentenzenkommentare nicht nur eine zunehmende Ausweitung dieser Einleitungsfragen mit sich. Auch sonst gewannen sie eine immer größere Eigenständigkeit gegenüber dem von ihnen behandelten Text. Während den philosophischen und auch den biblischen Kommentaren in der Regel tatsächlich der Kommentar- und Vorlesungscharakter anzumerken ist, insofern hier dicht am vorgegebenen autoritativen Text gearbeitet, dieser vorausgesetzt, wohl oft auch vorgelesen und dann erläutert wird, gibt die Sentenzensammlung durch ihre Distinktioneneinteilung die Möglichkeit, die jeweiligen Themen in Frageform zu behandeln und dann, zwar in Anlehnung an den vorgegebenen Text und unter Gebrauch der darin bereitgestellten Zitate, letztlich aber doch in freier, traktatartiger Weise zu dozieren.
Zu Ockhams Zeiten war dieser freie Umgang mit den Sentenzen schon längst üblich. Er entsprach auch der Stellung der Vorlesung im Ausbildungsgang der Studenten. Wenn sie denn hier erstmals die Möglichkeit hatten, sich eigenständig zu äußern und hierfür gerade auch durch das sachorientierte Verfahren der Disputation vorbereitet waren, so lag es nahe, dass sie die in den Disputationen erlernten Techniken auch in ihrer ersten Vorlesung anwandten und den Stoff in breiter Abwägung der Argumente vortrugen.
Zu der Freiheit gehörte auch ein weiteres Abweichen von den Vorgaben des Lombarden, das in Paris bestens dokumentiert ist, aber auch für Oxford vorausgesetzt wird. Man änderte die Reihenfolge der Bücher, las also nicht von I bis IV, sondern zog das vierte Buch vor: Es kam unmittelbar nach dem ersten Buch zu stehen, Buch II und III folgten dann. Der Hintergrund für diese Änderung bestand wohl in einer Mischung aus theologischen und pragmatischen Erwägungen. Theologisch sah man die Trinitätslehre, das Spezifikum des christlichen Gottesverständnisses, und den Heilsweg als die entscheidenden Inhalte an, über die in jedem Falle ausführlich gehandelt werden musste. Damit dies aber geschehen konnte, hatte man auf einen pragmatischen Gesichtspunkt Rücksicht zu nehmen, den nämlich, dass es einem mittelalterlichen akademischen Lehrer kaum anders erging als den meisten heutigen: Die jedenfalls in Oxford in der Regel auf ein Jahr konzipierte Sentenzenvorlesung54 wurde zu Beginn großzügig angegangen, man ließ sich Zeit zur Entfaltung der jeweiligen Positionen – gerade auch in den erwähnten ausufernden Prologen. Und je weiter man dann im Stoff fortschritt, desto gedrängter wurde die Zeit – offenbar trotz der im Sommer ja wegen des längeren Tages zur Verfügung stehenden zusätzlichen Stunden. Nicht jeder musste es so weit treiben wie Ockhams Zeitgenosse Robert Holcot, der zum dritten Buch lediglich eine Frage stellte – und in dieser den Leser auf seine Ausführungen zum vierten Buch verwies.55 Ins Gedränge dürften die meisten Autoren gekommen sein. Auch Ockhams Vorlesung zum dritten Buch enthielt nur noch zehn Fragen – allein der Prolog zum Ersten Buch hatte deren zwölf umfasst! Und Ockham ließ sich im ersten Buch auch Zeit für lange Exkurse – der berühmteste ist der zur Universalienfrage (s. u. S. 63 – 72).
Allerdings hat der schier unverhältnismäßige Umfang des ersten Buches im Falle Ockhams noch einen anderen Grund: Während die Bücher zwei bis vier lediglich als reportatio vorliegen, als Abschriften der Mitschriften, die Ockhams Studenten während der Vorlesung angelegt haben, liegt die Behandlung des ersten Buches in Gestalt einer ordinatio vor. So bezeichnet man im mittelalterlichen Schulwesen eine umfassende Behandlung, die der Autor, in diesem Falle also Ockham, selbst vorgenommen und zum Abschluss gebracht hat – gewissermaßen die „Fassung letzter Hand“. Noch einmal wird hier die grundlegende Bedeutung erkennbar, die Ockham wie auch andere gerade dem ersten Buch zumaßen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er diese ordinatio bereits schriftlich abgefasst, ehe er überhaupt an den mündlichen Vortrag der Vorlesung ging56 – das könnte auch erklären, warum es zu diesem ersten Buch gar keine erhaltene Abschrift einer Vorlesungsmitschrift gibt. Wegen der bereits vorliegenden ordinatio erübrigte sich die Vervielfältigung der in ihrem Wert natürlich geringer zu veranschlagenden Mitschriften. Ockham wäre dann also außerordentlich gut gerüstet an seine Vorlesung gegangen: Die grundlegenden Probleme waren sachlich bereits geklärt, ehe er seine Sentenzenvorlesung hielt. Dies alles muss in den Jahren 1317 bis 1319 erfolgt sein.
Etwas später allerdings erfolgte noch ein weiterer Schritt, der möglicherweise auch etwas über Ockhams Verhältnis zu seinen Schülern aussagt: Die textkritische Untersuchung des Sentenzenkommentars hat zu Tage gefördert, dass die ordinatio in zwei verschiedenen Redaktionen vorliegt.57 Eine maßgebliche Textgruppe weist an mehreren Stellen Einschübe auf, die wiederum bei einer beachtlichen Gruppe anderer Textzeugen nicht nachweisbar sind. Diese redaktionellen Zusätze wiederum stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang und lassen sich somit aus einem gemeinsamen Interesse erklären: Immer wieder geht es um Formulierungen, die auf die Universalienlehre abheben, und zwar auf eine Änderung, die sich auch in anderen Werken im Denken Ockhams abzeichnet. Waren für ihn Universalien zunächst noch reine ficta, vom menschlichen Verstand hervorgebrachte Konstrukte, so hat er später stets von intellectiones gesprochen, von Gedankenvorgängen, die ihren Sitz im Erkenntnissubjekt selbst haben. Diese Verschiebung, die der zunehmenden Betonung der durch Universalien ausgedrückten zuverlässigen Welterkenntnis diente (s. hierzu unten S. 70f.), prägt nun auch die unterschiedlichen Textfassungen: Während die kürzere Fassung noch – wie übrigens auch die reportatio der Bücher II bis IV – fast durchweg von der reinen fictum-Theorie ausgeht, korrigiert die erweiternde Redaktion diese Ansicht vorsichtig, indem sie immer wieder hinzufügt, diese oder jene Aussage sei eben nach dieser fictum-Theorie zu verstehen, könne aber im Rahmen einer intellectio-Theorie reformuliert werden – die ganze ordinatio wurde gewissermaßen auf den neuesten Stand Ockham’scher Theorie gebracht.
Wann dies erfolgt ist, ist ebenso unsicher wie durch wen. In der Forschung nimmt man in der Regel an, Ockham selbst habe hier noch einmal Hand an seine eigene Arbeit gelegt, wohl unter dem Eindruck, den die bis zur Häresieanklage reichende Kritik an seinen Theorien auf ihn gemacht hatte. Doch scheint dies nicht ganz sicher. Das Handexemplar der ordinatio jedenfalls, das Ockham bei späterer Gelegenheit benutzt hat, weist noch keine Spuren dieser redaktionellen Bearbeitung auf.58 Umgekehrt hat Ockham darin Streichungen und Zusätze vorgenommen, die ihrerseits nicht in die Handschriftenüberlieferung eingegangen sind. Das heißt, die erweiternde Redaktion, die den Großteil der Handschriften auszeichnet, geht jedenfalls nicht auf Ockhams eigenes Handexemplar zurück. Das macht es wahrscheinlich, dass Ockham die vergleichsweise mechanische Arbeit der jeweils sachangemessenen Ergänzungen Schülern überlassen hat. Am ehesten kommt hierfür Adam von Wodeham in Frage, dessen enges Verhältnis zu Ockham ja schon oben thematisiert wurde und der möglicherweise sogar die Funktion eines Sekretärs für Ockham übernommen hat.59 Leider muss auch dies Vermutung bleiben. Es würde allerdings einen interessanten Einblick in das Verhältnis zwischen Ockham und seinen Schülern geben, wenn man eine solche Bearbeitung durch Wodeham definitiv festmachen könnte, zumal Ockham Wodeham später – im Zusammenhang der „Summa Logicae“, der Summe der Logik – auch noch einmal zuschreibt, ihn direkt zu dieser Arbeit angeregt zu haben.
Unabhängig von dieser Frage aber bietet der Sentenzenkommentar einen einzigartigen Einblick in das theologische Denken Ockhams und seine Verbindungen zur Philosophie.