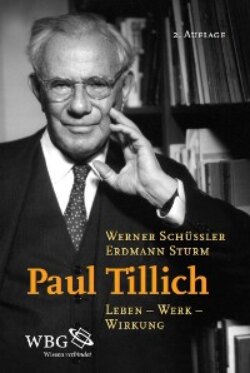Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 24
b) Philosophie und Religion
ОглавлениеIn seinem Beitrag „Philosophie und Religion“ (vgl. G V, 101–109) von 1930, den Tillich ebenfalls für die zweite Auflage der „Religion in Geschichte und Gegenwart“ verfasst hat, bestimmt er die beiden Bereiche wie folgt: „Philosophie ist die Haltung des radikalen Fragens, des Fragens nach der Frage und nach allen Gegenständen, sofern sie konkrete Antworten auf die radikale Frage geben können. Religion ist reines Ergriffensein von dem Unbedingten, Seinsjenseitigen, von dem, was dem Sein Sein und dem Sinn Sinn gibt. Religion ist also ein Haben, wenn auch in der Form des ‘Gehabt-werdens’. Philosophie dagegen ist gerade das Negative des Habens, ist das reine Anfangen, das Anfangen ohne Haben, ohne irgendein Vorgegebenes. Philosophie und Religion verhalten sich also wie Nicht-Haben und Haben, wie Fragen und In-der-Antwort-Stehen.“ (101) Mit diesen wenigen Sätzen ist im Grunde schon das angesprochen, was Tillich später als „Methode der Korrelation“ bezeichnen wird: Philosophie als Frage und Theologie als Antwort.
Auf den ersten Blick scheint in diesen Bestimmungen von Philosophie und Religion ein Gegensatz auf: „Der Religiöse glaubt, der Philosophie entraten zu können, da er als Besitzer der Wahrheit nicht zu fragen brauche, und der Philosoph glaubt, die Religion fernhalten zu müssen, da sie ihn durch ihre vorgegebene Wahrheit am radikalen Fragen hindere.“ (Ebd.) Das heißt, Philosophie und Religion scheinen sich auf den ersten Blick gegenseitig auszuschließen. Eine solche Position, wie sie beispielsweise von Karl Jaspers vertreten wird, ist aber für Tillich nicht das letzte Wort in dieser Sache. Denn wären Philosophie und Religion „Ausdruck einer letzten menschlichen Möglichkeit“, so wäre der Mensch nach Tillich „unheilbar gespalten“ (102).
Eine tiefere Analyse macht nach Tillich gerade deutlich, dass Philosophie und Religion etwas gemeinsam haben, und dieses Gemeinsame sieht er „in der Radikalität der Unbedingtheit“ (103): „Mit der philosophischen Frage ist an das gleiche ‘Letzte’ gerührt, das in der religiösen Ergriffenheit ergriffen wird. Die philosophische Frage ist ihrem Wesen nach selbst religiöse Ergriffenheit“ (103f.). Anders formuliert: Die Religion besitzt selbst ein „kritisches Prinzip“, und die Philosophie ist immer auch schon notwendig „existentiell“ (108f.).
Allerdings darf das Trennende natürlich nicht übersehen werden, denn es gibt zweifellos auch unauflösliche Differenzen zwischen Philosophie und Religion; die Identität ist also nicht total. So betrifft die religiöse Unbedingtheit den Menschen in seiner Ganzheit, während in der Philosophie die Totalität des Menschen ausdrücklichim Hintergrund bleibt. In der Religion geht es um das „Seelenheil“, in der Philosophie dagegen um „Erkenntnis“; die Philosophie ist „esoterisch“, das heißt, sie ist nur wenigen zugänglich, während die Religion „exoterisch“ ist, das heißt universal in ihrem Anspruch.