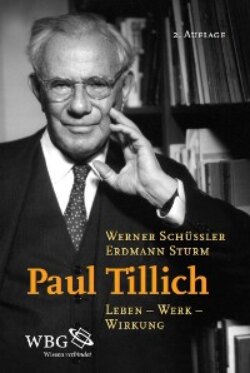Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 34
2. Die Religion als Tiefendimension des menschlichen Geistes
ОглавлениеDas, was Religion ihrem Wesen nach ist, kann nach Tillich nur im Rahmen einer Theologie der Kultur näher entfaltet werden (vgl. § 3); hier kann es deshalb nur darum gehen, eine erste Annäherung an seinen Religionsbegriff zu gewinnen. Tillichs Definition der Religion als „ultimate concern“ ist allseits bekannt: Religion ist das, was uns unbedingt angeht. Mit dieser Bestimmung will er sagen, dass Religion nicht eine Funktion des menschlichen Geistes neben anderen ist, sondern deren Tiefe: Religion ist die „Tiefendimension“ des menschlichen Geistes. Das, was uns unbedingt angeht, manifestiert sich „in allen schöpferischen Funktionen des menschlichen Geistes“. Das heißt, die Religion ist weder mit der ethischen Funktion, noch mit der Funktion des Erkennens, noch mit der ästhetischen Funktion oder dem Gefühl identisch. „Sie ist überall zu Hause, nämlich in der Tiefe aller Funktionen des menschlichen Geisteslebens. Die Religion ist die Tiefendimension, sie ist die Dimension der Tiefe in der Totalität des menschlichen Geistes.“ (G V, 40) Tillich fasst den Wesensbegriff der Religion bewusst in diesem weiten Sinne, um deutlich zu machen, dass die Religion etwas universal Menschliches ist. Der Mensch ist für Tillich wesentlich ein homo religiosus. „Das religiöse Prinzip kann nicht aufhören; denn die Frage nach dem letzten Sinn des Lebens läßt sich nicht zum Schweigen bringen, solange Menschen leben. Religion als Religion kann nicht untergehen, aber eine partikulare Religion kann nur solange am Leben bleiben, wie sie sich selbst als Religion transzendiert.“ (G V, 98)
Wenn Religion in diesem weiten und umfassenden Sinn zu verstehen ist, was hat es dann mit der Religion im engeren Sinne auf sich? Die Religion im engeren Sinne, sei es die Religion der offiziellen Kirche oder die Religion der persönlichen Frömmigkeit, verdankt nach Tillich ihre Existenz dem Faktum, „daß der Mensch seinem wahren Wesen nach tragisch entfremdet ist“ (G V, 42). Das bedeutet, dass der Wesensbegriff der Religion – Religion als Dimension der Tiefe – immer nur Gestalt gewinnt in den Symbolen und Einrichtungen einer konkreten, spezifischen Religion (vgl. G V, 44).
Wenn der Mensch in diesem Sinne wesentlich religiös ist, wie steht es dann mit dem Phänomen des Atheismus? „Wen die Frage nach Gott gleichgültig läßt, obwohl er weiß, daß sie zugleich die Frage nach dem Sinn seines Lebens ist,“ schreibt Tillich, „der hat sich seiner eigentlichen Menschlichkeit begeben.“ (R III, 97) Schon in einem Brief an den Freund Emanuel Hirsch aus dem Jahre 1918 heißt es dazu: „An Gott zu zweifeln ist unmöglich und an Gott nicht zu zweifeln ist unmöglich. Das erste bezieht sich auf den Gehalt, das zweite auf die Objektivationsform.“ (E VI, 122) Atheismus kann es also nach Tillich nur da geben, wo es um die Objektivationsform geht. Das heißt, ich kann die Objektivationsform leugnen, verneinen. Die tiefste Wurzel des Atheismus ist folglich darin begründet, dass Gott zu einem „Wesen neben anderen“ gemacht wird. Dieser Gott ist ein Objekt für uns als Subjekte, zugleich aber sind wir Objekte für ihn als Subjekt. Und dies ist dem Menschen unerträglich. In Anspielung auf Nietzsche heißt es bei Tillich: Dieser Gott „beraubt mich meiner Subjektivität, weil er allmächtig und allwissend ist. Dagegen wehre ich mich und versuche, ihn zu einem Objekt zu machen, aber es mißlingt mir, und ich ende in Verzweiflung. Gott erscheint als der unbesiegbare Tyrann, das Wesen, demgegenüber alle anderen Wesen ohne Freiheit und Subjektivität sind. Er erscheint uns wie die Tyrannen unserer Zeit, die mit Hilfe des Terrors Menschen in bloße Objekte zu verwandeln suchen, in Dinge unter Dingen, in Rädchen einer Maschine, die sie dirigieren. Er wird zum Muster alles dessen, wogegen der Existentialismus revoltiert. Er ist der Gott, von dem Nietzsche den Mörder sagen läßt, daß er getötet werden mußte, weil niemand ertragen kann, zu einem bloßen Objekt absoluten Wissens und absoluter Beherrschung gemacht zu werden.“ (G XI, 136) Diese Form des Atheismus ist also nach Tillich gerechtfertigt als Reaktion gegen einen Gott, der in Wirklichkeit ein Götze ist.
Der erste Schritt zum Atheismus ist somit immer eine Theologie, die Gott auf die Ebene der bezweifelbaren Dinge herabzieht. Denn dann hat der Atheist leichtes Spiel. Er ist nämlich nach Tillich ganz im Recht, wenn er ein solches Phantom mit seinen gespenstischen Eigenschaften zerstört. Das, was in mir einen solchen Gott töten will, das ist nach Tillich Gott selbst: „Man könnte dies den ‘Gott über Gott’ nennen, das heißt über jenem Gott, der ein höchstes Wesen und die Ursache jeder heteronomen und hypostasierten Autorität ist. Der wahre Gott, der Gott über jedem Gott, der ein Wesen ist, befreit uns von der totalen Autorität auch des höchsten polytheistischen Gottes, der in Wahrheit ein Dämon ist.“ (G VIII, 69) In der Konsequenz heißt dies: Wird Gott geleugnet, so wird er im Namen Gottes geleugnet. „Wo wirkliches Ergriffensein vom Unbedingten ist, kann Gott nur im Namen Gottes verneint werden.“ (G VIII, 142)
Wenn wir Gott aus unserem Bewusstsein verdrängen, wenn wir Gott von uns weisen, wenn wir Gott widerlegen, wenn wir seine Nicht-Existenz behaupten, dann wissen wir nach Tillich im letzten Grunde, „daß nicht er es ist, den wir widerlegen und verdrängen, sondern sein verzerrtes Bild. Und wir wissen, daß wir ihn nur deshalb verneinen können, weil er uns dazu treibt, ihn zu verneinen.“ (R I, 42) Darum kann Tillich den paradoxen Satz formulieren: „Wer Gott mit unbedingter Leidenschaft leugnet, bejaht Gott, weil er etwas Unbedingtes bekundet.“ (G VIII, 142)