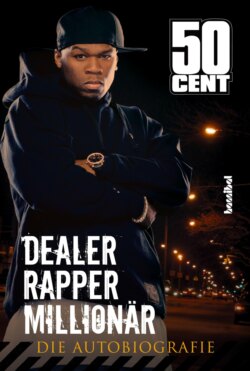Читать книгу Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie - 50 Cent - Страница 12
ОглавлениеKapitel 6
„Drogen waren kein Spiel – Drogen waren ein Geschäft …“
Bevor er eingesperrt wurde, hatte mein Onkel Trevor Sincere einigen gut gekleideten Kolumbianern vorgestellt, von denen einer den Namen Carlos trug. Wie Trevor hatte auch Carlos Klasse. Im Sommer trug er maßgeschneiderte Anzüge aus Seide oder Leinen, im Winter teure Strickpullover und weiche Ledertrenchcoats. Trevor und Carlos trafen sich immer im Haus meiner Großmutter, wenn sie bei der Arbeit war. Ich glaube, Trevor hatte deshalb das Haus meiner Großmutter gewählt, weil er oft genug dort war, um zu wissen, dass es sicher war, aber nicht oft genug, dass man ihn hätte aufspüren können. Ich erinnere mich, dass Carlos immer nur Wasser trank, und nichts als Wasser. Nur Wasser. Kein Eis. Egal, wie heiß es war. Ich brachte ihm sein Wasser immer als Vorwand dafür, bei ihnen herumzuhängen und mehr übers Geschäft zu lernen. Wann immer Trevor und Carlos zusammenkamen, war der Drogenhandel kein Spiel mehr – es war das Drogengeschäft. Sie nahmen die Angelegenheit sehr ernst. So viel lernte ich und viel mehr auch nicht, denn sie redeten nie über Drogen. Sie redeten nur über die Fußballweltmeisterschaft. Es dauerte eine ganze Weile, bis mir klar wurde, dass „Fußball“ ein Code war, den sie in ihren Geschäftsverhandlungen benutzten. Alles, was ich damals mitbekam, war, dass Onkel Trevor und Carlos sich sehr für die mexikanischen und kolumbianischen Mannschaften interessierten und dass Carlos kein Eis in seinem Wasser mochte.
Nachdem man Trevor in den Knast gesteckt hatte, begann Sincere, mit Carlos Geschäfte zu machen und wurde ebenfalls ein großer Fußballfan. Yo, ich fragte mich, was es verdammt noch mal mit diesem Scheißfußball auf sich hat? Ich versuchte ein- oder zweimal, mir ein Spiel anzusehen, aber es war nicht auf Englisch und lief auf einem dieser Kanäle mit schlechter Bildqualität. Ich kapierte es einfach nicht. Als ich Sincere fragte, was ihm denn an Fußball so gefalle, erklärte er mir nur, dass man es nur in den USA „Soccer“ nannte, der Rest der Welt das Spiel jedoch unter dem Begriff „Fußball“ kannte und dass das, was wir als „Football“ kannten, vom Rest der Welt „American Football“ genannt würde. Ich sagte ihm, dass ich nicht begriff, was daran so interessant sein sollte. Er sagte: „Die Welt ist viel größer, als wir denken.“
Mir fiel auf, dass sich Sincere immer mehr für Fußball begeisterte, je öfter er mit Carlos sprach. Je mehr er sich für Fußball begeisterte, desto mehr Geld verdiente er. Je mehr Geld er verdiente, desto mehr verdiente auch ich, also wurde auch ich ein Fußballfan. Ich glaube, ich war der größte Fußballfan, der nie ein Spiel gesehen hatte. Jede Mannschaft, auf die wir setzten, hatte bald eine solche Glückssträhne, dass ich begann, rohes Kokain von Sincere zu beziehen. Ich fing mit acht Bällchen an, wovon jedes eine Achtelunze – dreieinhalb Gramm – wog. Dann steigerte ich mich auf sieben Gramm, also eine Viertelunze, dann bis zu einer halben Unze. Für reines Kokain war das gar nicht so viel, aber ich kochte selbst Crack daraus und hatte am Ende mehr Einheiten zum Verkauf, als ich jemals von Sincere auf Kommission bekommen hatte, bevor er zum Fußballfan wurde. Ich war im Geschäft.
Als Geschäftsmann hatte ich Unkosten. Ich musste zum Latinoladen um die Ecke gehen und Kapseln und Rasierklingen der Marke Gem Blue Star kaufen, um die Klumpen zu schneiden. Ich musste mein Produkt irgendwo herstellen, also mietete ich schließlich Brians Küche. Obwohl mir Brian niemals etwas schenkte, war er jedoch derjenige, der mir zeigte, wie man das Zeug kocht. Er zeigte mir die richtige Mischung für den Teig: zwei Teile Kokain und ein Teil Backpulver. Und was noch wichtiger war: Er zeigte mir, wie man die Reste vom Boden des Topfs verwendet und daraus noch mehr Crack gewinnt. Als ich das tat, war es, als könnte ich meinen Vorrat verdoppeln. Ich konnte es kaum glauben. Als ich zum zweiten Mal am Herd stand, konnte ich bereits die perfekte Mischung nach Augenmaß herstellen – kein Abwiegen, kein gar nichts. Ich dachte: Mensch, so verdammt leicht kann das doch nicht sein.
Das einzige Problem war der Gestank. Anfangs hasste ich ihn, aber ich gewöhnte mich sehr schnell daran. Allerdings habe ich diesen Gestank auch nie vergessen. Genauso, wie ein Grassraucher den Geruch von brennendem Marihuana sofort erkennt – auch auf einen Block Entfernung oder durch eine geschlossene Tür –, kann ich bis heute riechen, wenn Crack gekocht wird, sobald das Wasser zu brodeln beginnt. Es ist einer jener komischen, eigenartigen Gerüche, wie bei Zigaretten, und man reagiert auch ganz ähnlich darauf. Wenn man Zigaretten raucht, stört einen der Geruch nicht. Aber wenn man gerade nicht raucht, geht einem der Gestank auf die Nerven, selbst wenn man Raucher ist. Mit Crack war es so, dass mich der Gestank störte, wenn ich nicht selbst am Kochen war, denn es bedeutete, dass jemand anderes Geld verdienen würde und dieser Jemand nicht ich war.
Crack herzustellen hat einen gewissen Rhythmus. Und mit jedem Arbeitsschritt schlug mein Herz schneller, denn alles, was ich damit tun wollte, war, es zu verkaufen. Ich rührte die Mischung an, brachte das Wasser zum Sieden, kochte das Zeug auf, ließ es klumpen, las die Klümpchen heraus, füllte die Kapseln, und ab ging’s auf die Straße.
Ich verkaufte an alle und jeden. Und entgegen Brians Ratschlag verschleuderte ich meinen Profit für Klamotten und Schuhe. Ich schmuggelte die Kleider an meiner Großmutter vorbei, aber meine Extraturnschuhe bewahrte ich im Haus meines Freundes Ray-Ray auf. Er war ein Junge, mit dem ich groß wurde und der nur eine Ecke weiter wohnte. Außerdem war er mein erster Mitarbeiter. Als er zu dealen begann, gab Ray-Ray sein Geld ebenfalls für Turnschuhe aus, und ich bunkerte sie im Haus meiner Großmutter. Weil er Größe neun hatte und ich Größe sieben, schnallte meine Großmutter nie, dass ich zu viel Geld hatte. Ab und zu fragte sie mich, warum Ray-Ray seine Turnschuhe nicht einfach mit nachhause nahm.
„Ich weiß“, sagte ich und tat so, als ärgerte ich mich über Ray-Ray. „Ich sag ihm schon andauernd, er soll sie endlich abholen. Ich schmeiße sie bald in einen großen Sack. Ist mir doch egal.“
***
Wie alles einmal ein Ende hat, so geriet auch Sinceres Glückssträhne ins Stocken. Das Problem war, dass Sincere die Meinung vertrat, dass jeder, der auf Fußballspiele wettete, auch die Verluste mit ihm teilen müsste – er erhöhte mir gegenüber einfach die Preise. Als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, beschloss er außerdem, Carlos zu wenig zu bezahlen. So lernte ich schließlich, wie man Fußball spielte.
Trotz dieser Maßnahmen wollte Carlos weiterhin mit ihm Geschäfte machen. Sincere verfügte über die richtigen Beziehungen im Revier, und der Profit war zu groß, als dass Carlos auf ihn hätte verzichten können. „Ich mache gute Geschäfte mit Sincere“, sagte Carlos. „Aber er begreift nicht, dass man eben manchmal gewinnt und manchmal verliert. Und wenn man verliert, dann sollte man nicht jeden mit hineinziehen. So arbeiten Männer einfach nicht.“
Wenn ich nur seinen Kundenstamm gehabt hätte, wäre Sincere weg vom Fenster gewesen. Allerdings begann Carlos, nun direkt mit mir Geschäfte zu machen. Er sagte, er erinnere sich, wie ich ihm immer Wasser gebracht hatte, wenn er sich mit meinem Onkel Trevor traf. Er sagte, er könne nur einem Mann vertrauen, der gewillt war, einem anderen Mann zu dienen. Dann gab er mir mein erstes Kilo Kokain. Es war fest in Plastikfolie eingeschlagen und sah aus wie ein massiver Ziegel aus Puderzucker.
Ich nahm den Ziegel mit zu Brian und benutzte seine Feinwaage mit den drei Balken, um ihn in Achtel-, halbe und Viertelunzen aufzuteilen. Ich behielt den halben Ziegel, um ihn zu Klümpchen zu kochen, und verkaufte den Rest von dem Klotz an andere Dealer. Ich ging noch in die Unterstufe und versorgte Typen, die doppelt so alt waren wie ich. Irgendwann war die Schule nur noch ein guter Witz: Nachdem ich meinen ersten Ziegel aufgeteilt hatte, beherrschte ich so viel Mathe, wie ich benötigte. Als mich mein Vertrauenslehrer dazu ermutigte, mir eine Arbeitserlaubnis ausstellen zu lassen, lachte ich ihn beinahe aus. Solche Papiere waren die Fastfoodkarte. Wenn ich einen Haufen Papierkram ausfüllte, würde ich eine hübsche kleine Karte bekommen, die es mir erlaubte, in einem Fastfoodladen zu arbeiten. Wenn ich ganz großes Glück hätte, dürfte ich an der Kasse sitzen und müsste nicht hinten versauern. Nichts, was man mir in der Schule beibrachte, ergab in meiner Realität irgendeinen Sinn. Noch weniger davon schien dazu geeignet zu sein, mir einen Ausweg aus dieser Realität zu verschaffen. Alles, was mich interessierte, war, Geld zu verdienen, denn Geld schien der Schlüssel zu all meinen Problemen zu sein.
Meine höhere Stellung auf der Habenseite der Drogengleichung brachte zwar nicht denselben Profit, aber der Arbeitsaufwand war geringer, und es festigte meinen Status im Viertel. Nachdem ich mein zweites Kilo verkauft hatte, investierte ich sofort in ein drittes, das ich nach Gramm aufteilte. Ich bunkerte ein Viertelkilo als Vorrat und tütete zwei Achtel ein. Wenn mir irgendjemand eins der Achtelkilos abgekauft hätte, wäre ich zum Star des ganzen Viertels geworden. Ein Vierzehnjähriger, der Achtel verkauft? Ich wäre ein Wunderkind gewesen. Ich kaufte mir für fünfzig Dollar einen Piepser, der kaum größer war als ein Kartenspiel, und begann, so viel Koks umzuschlagen, wie ich konnte. Die andere Hälfte von dem Klotz hatte ich in Achter-, Siebener- und Vierzehnerpäckchen aufgeteilt. Sie waren schnell verkauft – wenn ich auch den Piepser unter meinem Kopfkissen verstecken musste, damit meine Großmutter ihn nicht hören konnte.
Einmal piepste mich Chance immer wieder an, aber ich konnte ihn nicht zurückrufen, weil meine Großmutter am Telefon war. Chance war ein Typ, dem ich ein paar Siebener verkauft hatte. Ich musste zu einer Telefonzelle gehen, um ihn zurückzurufen, denn ich hatte Angst, das Geschäft könnte mir durch die Lappen gehen. Im Drogenhandel gibt es keine Markentreue. Die Konkurrenz bestimmt das Geschäft: Die Abhängigen kaufen von dem, der gerade da ist und der ihnen den besten Deal anbietet. Wenn du einem Süchtigen mal etwas billiger gibst – etwa einen Zehner für neun Dollar –, dann kommt er zu dir zurück. Nicht weil er loyal ist, sondern weil er ein Schnäppchen machen will. Wenn ihm jemand anders etwas billiger gibt, dann vergisst er dich, noch bevor er seine Pfeife anzündet. So ist das eben: Nachfrage und Angebot. Ich glaube, in der Schule lehren sie es andersherum. Dort heißt es „Angebot und Nachfrage“, wenn sich Firmen einen Haufen Scheiße ausdenken und das Zeug anbieten. Dann gaukeln die Firmen den Leuten vor, dass sie den ganzen Scheiß brauchen, für den sie werben, und erzeugen somit eine künstliche Nachfrage. Auf der Straße wurde es richtig verstanden: Erst kommt die Nachfrage, und wer liefern kann, macht den Profit.
In vielerlei Hinsicht sind die Dealer genauso abhängig wie die Süchtigen. Wir bauen unsere Existenz auf ihnen auf. Es ist wie mit den Politikern: Die meisten Politiker haben keinen Respekt vor den Leuten, von denen sie gewählt werden, und glauben, sie stünden über ihren Wählern. Doch wenn der Wahltag kommt, sind sie ihren Wählern ausgeliefert.
Als ich schließlich mit Chance Kontakt aufgenommen hatte, hatte er eine ganze Latte Fragen: Warum ich so lange gebraucht habe, um ihn zurückzurufen. Ich sagte ihm, dass meine Großmutter telefoniert hatte, aber er klang, als wolle er mir nicht glauben. Er fragte mir ein Loch in den Bauch, bis ich genug hatte und ihn fragte, ob er das Koks nun wolle oder nicht. Er sagte mir, er wäre gleich da.
Als Chance in dem Park aufkreuzte, wo ich auf ihn wartete, sah ich sofort, dass er wütend war. Er hatte einen Kerl bei sich, der im Auto saß und mich richtig böse anstarrte. Chance blickte sich andauernd um und fragte mich, warum ich so lange gebraucht habe, um ihn zurückzurufen. Ich dachte, er würde versuchen mich auszurauben, also fasste ich unter mein Hemd, als ob ich eine Pistole an der Hüfte hätte. Heute würde ich so etwas nicht mehr tun, denn wenn jemand denkt, ich habe eine Pistole, obwohl ich gar keine habe, dann kann es passieren, dass er auf mich schießt, selbst wenn er das gar nicht vorgehabt hat. Ein verängstigter Mensch schießt doppelt so schnell auf einen wie ein wütender. Aber ich war jung und dumm.
„Du hast eine ganze Menge Fragen, Alter“, sagte ich. Ich hielt die Waffe, die nicht da war, in meiner Hand und bewegte mich, als wollte ich sie jeden Moment hervorziehen.
Ich sah, wie der Typ im Auto große Augen bekam. Chance trat einen Schritt näher und sagte: „Das letzte Päckchen war zu leicht, Alter.“
Scheiße. Er wollte mich also tatsächlich ausrauben. „Zu leicht?“, fragte ich. „Was zum Teufel meinst du mit ‚zu leicht‘?“
„Ich habe dir eine Viertelunze abgekauft“, sagte er. „Das hätten sieben Gramm sein sollen, aber es waren nur sechs.“
„Mach, dass du deinen Arsch hier wegbewegst“, sagte ich. Wenn ich wirklich eine Knarre gehabt hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auf der Stelle erschossen. Ich wurde auf die Probe gestellt, und mein Verhalten in dieser Situation würde zu einem Präzedenzfall werden. Wenn ich Chance Recht gab, dann wäre ich auf der Straße nur noch eins: ein Nigger, mit dem man leicht fertig werden konnte. Ich musste die Diskussion an einen Punkt zurückführen, an dem ich mich in einer Machtposition befand, und ich musste es schnell tun.
„Ich habe verdammt noch mal fast vier ganze Ziegel verkauft, und keiner hat sich beklagt“, log ich. „Willst du mich verarschen, Alter? Ich komme den ganzen Weg hierher, um dir was von meiner allerletzten Unze zu geben, von meinem Privatvorrat, und du kommst mir so?“ Ich sah über seine Schulter nach dem Mann im Wagen und begegnete seinem Blick. Als er wegsah, tat ich so, als zöge ich meine Waffe aus dem Hosenbund. „Mann, ich sollte dich …“
Chance bedeckte sein Gesicht mit den Händen. „Bleib locker, Alter“, sagte er, die Augen auf den Boden gerichtet. „Ich sage nur, das Päckchen war zu leicht.“
„Scheiß auf dich und dein leichtes Päckchen“, sagte ich und ging davon. Als ich an die Ecke kam, schaute ich über meine Schulter zurück und sah, wie Chance mit dem Typen im Auto stritt. Ich bog um die Ecke und rannte den ganzen Weg nachhause.
In jener Nacht hatte ich lauter Albträume, in denen ich verfolgt wurde. Alle waren sie da. Carlos, Sincere, Brian, Chance, Rhonda – jeder, mit dem ich jemals auf der Straße gedealt hatte. Und alle versuchten, mich entweder auszurauben oder zu töten. In einem Traum wirkte Carlos sehr enttäuscht und redete von Vertrauen. „Wie können wir wie Männer Geschäfte machen, wenn ich dir nicht vertrauen kann?“, fragte Carlos. Er fragte andauernd, warum ich nicht antwortete, wenn er mich anpiepste. Ich sagte, dass ich keine Anrufe von ihm erhalten hatte, und zeigte ihm meinen Piepser. Ich versuchte, die gespeicherten Nummern abzurufen, aber er war kaputt und zeigte nur die Nummer von Chance an. Ich sagte Carlos, dass mein Piepser kaputt sei und dass dies möglicherweise der Grund dafür war, warum ich die Anrufe nicht beantwortet hatte. Ich hatte sie nie erhalten. Dann fragte er mich, warum ich eine Waffe auf ihn gerichtet hätte.
„Waffe?“, fragte ich. „Ich habe noch nie eine Waffe auf dich gerichtet!“, schrie ich Carlos an.
Carlos blickte zu Boden und hielt dabei seine Hände vors Gesicht. „Das ist nicht die Art, wie Männer Geschäfte machen, Boo-Boo“, sagte er. Ich schaute auf meine Hände. Ich zeigte mit dem Piepser auf ihn. Nur dass es kein Piepser war – es war eine Pistole. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie eine richtige Waffe in der Hand gehabt, und ich hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen war. Carlos stand vor mir, ganz erstarrt, und sprach davon, wie man als Mann Geschäfte machte und wie man sie besser nicht machte. Männer machten keine Geschäfte, indem sie die Waffen aufeinander richteten, betonte er. „Ich dachte, du wärst ein achtbarer Mann, Boo-Boo“, sagte er. „Aber jetzt sehe ich, dass ich mich geirrt habe. Du enttäuschst mich.“
Ich erinnere mich daran, was ich dachte, als Carlos das sagte. Ich dachte: „Verdammte Scheiße, jetzt muss ich ihn abknallen.“ Ich wollte schon den Abzug betätigen, doch da begann die Pistole in meiner Hand zu piepen. Piep! Piep! Piep! Piep!
Piep!
Piep!
Dann wachte ich auf, und das Herz schlug mir bis zum Hals. Unter dem Kopfkissen klingelte mein Piepser, aber ich war schon halb aus dem Bett gefallen. Ich robbte zu dem Piepser hin und sah, dass es Chance war, der mich anklingelte. Als ich ihn am nächsten Tag zurückrief, wollte er wissen, ob noch etwas von meinem „Privatvorrat“ übrig sei, das ich ihm verkaufen könnte.
***
Obwohl ich nun meine erste Prüfung als Straßendealer bestanden hatte, wusste ich doch, dass weitere folgen würden. Ich hatte jedoch keine Ahnung, wie bald sie kommen und wie tief in meinem persönlichen Umfeld sie mich treffen würden. Es begann mir zu dämmern, wie gefährlich das Spiel war, das ich spielte. Zu keinem Zeitpunkt wertete ich so etwas jedoch als Zeichen dafür, mit dem Drogenhandel Schluss zu machen und etwas anderes zu tun. Alles, was ich daraus schloss, war, dass ich in Zukunft vorsichtiger sein musste. Ich verkaufte also weiterhin Drogen, weil es das Einzige war, das ich kannte, und das Einzige, das für mich einen Sinn ergab. Der Gedanke war mir fremd, weitere sechs Jahre die Schulbank zu drücken, um dann weniger Geld zu verdienen, als ich jetzt in sechs Monaten einnehmen konnte. Ich betrachtete das Gewaltpotenzial als Teil des Preises, den ich bezahlen musste, um zu bekommen, was ich wollte. Hätte ich mich dafür entschieden, in die Schule zu gehen, hätte ich Hausaufgaben machen müssen, und andere Leute hätten mir gesagt, was ich zu tun hätte. Und selbst dann wäre ich höchstwahrscheinlich trotzdem bei den Dealern gelandet, die ich in meiner Nachbarschaft beobachten konnte. Es war in der Tat eine leichte Entscheidung.
Ich dachte mir, ich müsse einfach meine Verteidigungsstrategien als Dealer verbessern, aber ich bekam nicht sofort die Gelegenheit dazu, weil in den nächsten paar Tagen noch mehr Leute begannen, sich darüber zu beschweren, dass meine Päckchen zu leicht seien. Ich dachte: Was soll die Scheiße? Ich hatte geglaubt, Chance Angst einzujagen hätte gereicht, um mir wieder Sicherheit zu verschaffen, aber dem war nicht so.
Ich ging bei Brian vorbei, um ihm zu erzählen, was los war. „Die Nigger versuchen dich nur einzuschüchtern, weil du jung bist“, sagte er. „Wenn du wie ein Waschlappen reagierst, werden die Nigger immer wieder versuchen, dich auszubooten.“ Er zog seine Waage mit den drei Balken hervor, mit der wir meine Portionen abwogen, und legte einige von ihm gefüllte Päckchen darauf. Sie waren alle tadellos. „Niemand ist mir jemals mit dieser Zu-leicht-Scheiße gekommen“, sagte er. „Andererseits bin ich auch kein kleiner Nigger mehr, der neu in diesem Spiel mitmischt.“
Ich hatte genug gehört. Für mich war klar, dass die Nigger versuchten, mir krumm zu kommen. Ich beschloss, mir bei Old Man Dan eine Knarre zu besorgen, sobald ich den Rest des Ziegels verkauft hatte.
Als ich nachhause kam, sah ich gerade noch Onkel Star aus meinem Zimmer kommen. Das kam mir komisch vor, weil er sich nie für mich interessierte, schon gar nicht so sehr, dass er in mein Zimmer kommen und nach mir sehen würde. Aber daran dachte ich noch nicht einmal. Ich wollte ein Achtel von dem Kilo holen und möglichst schnell zu Brians Haus zurückkehren, um es dort aufzukochen. Ich hatte vor, den gesamten Mittelstandsaspekt meines Geschäfts erst einmal auf Eis zu legen, bis ich mir ein wenig Sicherheit leisten konnte. Als ich in meinen Schrank schaute, sah ich, dass mit dem Deckel des Schuhkartons, in dem ich die Kokainpäckchen aufbewahrte, etwas nicht ganz stimmte. Das versetzte mich in Panik, denn ich achtete stets darauf, dass er unter einem Haufen von Malbüchern und Spielsachen aus meiner Kindheit gut versteckt war. Jedes Mal, wenn ich an mein Depot wollte, musste ich eine Kiste mit grünen Soldatenfiguren, kaputten Robotern und ferngesteuerten Autos zur Seite schieben. Aber die Kiste war zur Seite geschoben, und der Schuhkarton war nicht richtig verschlossen. Plötzlich ergab alles einen Sinn.
Seit einiger Zeit waren im Haus immer wieder Kleinigkeiten verschwunden. Mein Großvater hatte gesagt, dass in seinem Geldbeutel immer zwanzig Dollar zu wenig seien und er sich einfach nicht daran erinnern könne, wo er das Geld ausgegeben hatte. Er sagte, dass er entweder senil würde oder Bush über Nacht die Steuern erhöht habe. Meine Großmutter war ein wenig misstrauischer. Sie war bereits mit der Frage auf mich zugekommen, ob ich aus ihrem Kleiderschrank Geld genommen habe. Ich wollte sagen: „Bei Ray-Ray zuhause habe ich zehn Paar Turnschuhe und mehr Kleider, als ich vor dir verstecken könnte.“ Aber das konnte ich ja nicht sagen. Sie wusste, dass mit mir etwas nicht ganz in Ordnung war, also begann sie, ein Auge auf mich zu haben. Sie überwachte meine Telefonate und stellte immer mehr Fragen. Sie begann sogar, ihre Schlafzimmertür abzuschließen. Ich werde nie vergessen, wie sie mich in jenem Augenblick ansah, als sie das Vertrauen in mich verlor. Es schmerzte mich zu wissen, dass sie dachte, ich wäre ein Dieb; beinahe so sehr, dass ich ihr erzählt hätte, was ich tat. Aber ich tat es nicht. Ich hatte keine Antworten für sie. Als ich sah, wie meine Kiste zur Seite gerückt worden war und der Deckel nicht ganz auf dem Schuhkarton saß, hatte ich alle Antworten, die ich brauchte. Ich wusste nun, dass Star mehr Drogen konsumierte als irgendjemand sonst im Haus. Ich wusste zwar, dass er den Punkt erreicht hatte, an dem er sich nicht mehr wohl fühlte, wenn er am Wochenende nicht high werden konnte. Aber ich hatte keine Ahnung davon, dass er bereits so abhängig war, dass er zuhause stahl. Ich ging ins Wohnzimmer, wo Star fernsah. Ich fragte ihn, was er in meinem Zimmer getan hatte. Er sagte: „Ich habe nach einem Stift gesucht. Ich musste etwas aufschreiben.“ Ich dachte: Was? Ich hatte dieses Arschloch noch nie in meinem Leben etwas schreiben sehen. Ich trat zwischen ihn und den Fernseher. „Was musstest du denn aufschreiben? Ich sehe dich gar nichts schreiben.“ Ich wollte hören, wie er es sagte. Ich wollte, dass er den Diebstahl gestand. Selbst wenn niemand da war, der es hören konnte, selbst wenn es nichts mehr daran änderte, dass meine Großmutter mich auf Distanz gehalten hatte, so musste ich doch wenigstens hören, wie er es sagte.
Er stand auf und schob mich durchs Zimmer. Eh ich mich’s versah, lag ich auf dem Fußboden, links und rechts von mir zerbrochenes Porzellan. Ich beschloss, dass ich nicht unbedingt hören musste, was er zu sagen hatte. Ich wollte ihn nur noch umbringen. Ich sprang auf, schnappte mir die große Holzgabel, die an der Wand hing, und begann damit auf ihn einzuschlagen.
Zack! Ich versuchte wirklich, diesen Nigger totzuschlagen. Zack! Er war schuld daran, dass jeder im Haus mich nun wie einen Dieb ansah. Zack! Die Wichser auf der Straße hätten mich umlegen können. Zack! Er brauchte nicht zu gestehen. Zack! Es würde mir vollkommen genügen, ihn umzubringen. Zack! Er war so im Arsch, dass er sich nicht einmal wehren konnte. Beim letzten Schlag zersplitterte die Gabel in der Mitte. Krack!
Cynthia kam ins Zimmer gerannt, um den Kampf zu beenden. Ich rannte hinauf, schnappte meinen Schuhkarton und verließ das Haus. Als ich bei Brian zuhause alles noch einmal nachwog, sah ich, dass das Crack diesem Nigger Star offenbar schon ein Loch in sein Scheißgehirn gefressen hatte. Er hatte jedes einzelne Päckchen geöffnet, ein wenig herausgenommen und es dann wieder verschlossen. So musste er von meinem Kilo etwa einhundert Gramm Kokain geklaut haben. Außerdem fehlte ein ganzes Viertelunzenpäckchen. Eigentlich hätte ich mich aufregen müssen, aber ich hatte genug damit zu tun, mir vor Angst in die Hosen zu machen. Ich war in etwas hineingeraten, von dem ich nicht wusste, ob ich je wieder herauskommen würde. Wenn die Typen, denen ich die zu leichten Päckchen verkauft hatte, dachten, dass ich sie mit Absicht betrog, dann würden sie mich umbringen. Daran, was passieren könnte, wenn Carlos dachte, dass ich mit seinem Geld spielte, wollte ich noch nicht einmal denken. Alles in allem hatte ich kaum mehr ein Achtel von dem Kilo in meinem Besitz, und das reichte nicht einmal dazu aus, um meine Schulden bei Carlos zu begleichen. Selbst wenn ich alles verkaufte, hätte ich immer noch fast tausend Dollar zu wenig, um ihn für seine Kommissionsware zu bezahlen. Dass ich all mein Geld für Turnschuhe und Jogginganzüge ausgegeben hatte, half mir nicht weiter.
Ich beschloss, das meiste von dem Pulver zu verkaufen, um wenigstens meinen guten Namen zu retten. Wenn ich mit den Leuten, mit denen ich arbeitete, nicht wieder ins Reine kam, würde ich nicht nur kein Geld mehr verdienen, dann wäre auch mein Leben auf dem Strip keinen Pfifferling mehr wert gewesen. Zuerst wollte ich die Päckchen überfüllen, aber Brian sagte, dass dies einem Schuldeingeständnis gleichkäme und dass ein Fehler ein Zeichen für Schwäche sei. „Wenn du das machst, kannst du das Zeug auch gleich verschenken“, sagte er. „Weil die Nigger kommen und dich einmachen, sobald du Schwäche zeigst.“ Also verkaufte ich das Rohkoks in normalen Gewichtseinheiten und behielt dreieinhalb Gramm für mich selbst. Ich kochte die dreieinhalb Gramm, füllte den Stoff in Kapseln und verkaufte sie unter der Hand. Als ich damit fertig war, reinvestierte ich das Geld und kaufte sieben Gramm von Brian. Ich kochte und verkaufte das Zeug innerhalb von zwei Tagen. Dann kaufte ich eine halbe Unze, die ich dann innerhalb von sechs weiteren Tagen in hundertfünfundzwanzig Gramm verwandelte. Ich war die ganze Zeit auf dem Strip. Nachhause ging ich gar nicht mehr.
Brian sagte meiner Großmutter, dass er nach dem Kampf mit Star nun auf mich aufpasse, und sie ließ es dabei bewenden. Es war Sommer, und wenn ich müde wurde, machte ich auf einer Bank oder auf einem Rasenstück ein Nickerchen. Ich verließ den Strip nur, wenn ich zu Brian ging, um einzukaufen und zu kochen. Ich ließ die Crackkekse nicht einmal mehr trocknen. Ich schnitt sie in Stücke, während sie noch weich wie nasse Seife waren. Ich war verzweifelt. Meine Haut war mit einer Schicht aus Schweiß und Schmutz bedeckt, in der ich mich schließlich wie gefangen fühlte. Ich stank derart, dass ich mir jedes Mal fast die Nase verbrannte, wenn ich an mir roch. Ich war zu konzentriert, um zu bemerken, dass ich aus dem Gleichgewicht geriet. Ich suchte so verzweifelt nach einem Ausweg, dass ich gar nicht sah, dass zwischen mir und den Süchtigen, die ich bediente, für eine kurze Zeit kaum noch ein Unterschied bestand. Innerhalb zweier Wochen hatte ich jedoch das ganze Geld zusammen, das ich Carlos schuldete, und sogar noch etwas mehr. Der einzige Gedanke, der mich zu derart harter Arbeit antrieb, war, dass mir nichts anderes übrig blieb, als dieses Geld zu beschaffen.
Das war eine wichtige Lektion für mich. Ich lernte daraus, dass man im Drogengeschäft niemandem trauen kann, nicht einmal der eigenen Familie. Bis zum heutigen Tag sprechen Star und ich kaum miteinander, weil er damals meinen Vorrat angezapft hat. Es mag ihm damals nicht klar gewesen sein, aber er hatte mich praktisch zum Abschuss freigegeben. Wie verzeiht man so etwas? Was soll man sagen? Wegen dir wäre ich beinahe umgebracht worden, aber das ist vorbei? Ich verstehe, wie das damals war, und ich vergebe dir?
Nö! So einfach kann man das nicht vergessen.