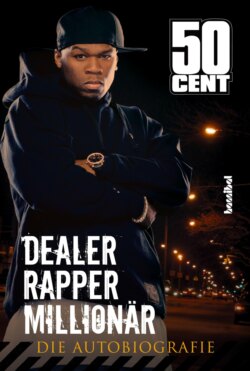Читать книгу Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie - 50 Cent - Страница 8
ОглавлениеKapitel 2
„Ständig passierten irgendwelche Sachen …“
Dumme Scheiße. Das erklärt wohl am besten, was ich die ersten paar Jahre nach dem Tod meiner Mutter alles anstellte und durchlebte. Nichts außergewöhnlich Dummes, nur ganz normale, dumme Querbeetscheiße. Ich benutzte etwa ein Fenster im Erdgeschoss als Ausgang, obwohl das Haus doch eine tadellose Eingangstür besaß. Oder ich kletterte über den kurzen Maschendrahtzaun, um nicht wie jeder normale Mensch das Tor öffnen zu müssen. Dumme Scheiße – etwa, sich dreimal pro Woche mit anderen Kindern in der Schule anzulegen oder den Lehrern zu sagen, wo sie sich ihre Lehrpläne und Hausaufgaben hinstecken könnten. Oder ich raste und sauste durchs Haus wie eine Aufziehpuppe, deren Feder nicht ablaufen wollte. Dumme Scheiße eben. Das heißt, bis jemand auf die Idee kam, mich auf Methylphenidat zu setzen, hyperaktiven Kindern auf der ganzen Welt besser bekannt unter dem Namen Ritalin.
Das Ritalin wirkte – nicht unbedingt deshalb, weil es als Medizin so effektiv war, sondern weil es ganz einfach eine Droge war, die einem Kind verabreicht wurde. Die Logik der Schulmedizin, einem hyperaktiven System ein entsprechendes Stimulans zu verpassen, schlug prächtig an: Mit jeder Dosis konnte ich spüren, wie jede einzelne Ader in meinem Kopf anschwoll, und ich wurde immer ganz duselig. Ich wurde langsamer, sah aus und benahm mich wie ein Drogensüchtiger. Das ging so lange, bis ich begann, mich lieber von selbst zu beruhigen, statt weiterhin die Medizin zu nehmen. Sie wurde zu einer Drohung: „Beruhige dich, sonst kriegst du wieder deine Medizin.“
„Schon gut, ich bin ja brav.“
In meiner Welt war der Grund dafür, dass für mich nun alles schlecht lief, der, dass meine Mutter nicht da war. Dies war die Begründung für alles und jedes, egal, ob groß oder klein. Wenn mir meine Tante auf die Nerven ging, dann wusste ich, dass sie mich niemals so unterbuttern könnte, wenn nur meine Mutter bei mir wäre. Wenn man mich anschrie, weil ich Matsch durchs Haus schleppte, dachte ich, man würde mich nicht bestrafen, wenn meine Mutter hier wäre. Sogar wenn es regnete, saß ich da und schaute aus dem Fenster und dachte: Wenn meine Mama hier wäre, würde die Sonne scheinen. Jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Mutter getroffen hatte, war etwas Gutes geschehen. Doch dann kam sie nicht wieder. Irgendjemand hatte sogar das kleine Motorrad gestohlen, das sie mir geschenkt hatte. Das kotzte mich wirklich an. Ich stand eines Morgens auf und ging hinaus, und weg war es. Wie meine Mama.
Vielleicht noch bevor es mir selbst klar wurde, bemerkte wohl meine Großmutter, wie ich litt, denn sie duschte mich mit extra viel Liebe und ließ mir mehr durchgehen, als sie es je bei meinen Onkeln und Tanten getan hatte. Ich wusste das, weil meine jüngste Tante, Cynthia, keine Gelegenheit ausließ, sich zu beklagen, dass man mir ein ungeheures Maß an Freiheiten zugestand. Verdammt, Cynthia und ich waren beinahe so etwas wie Todfeinde. Meine Kämpfe mit Cynthia begannen in dem Moment, als die Trauerzeit nach dem Tod meiner Mutter ihrem Ende entgegenging und sie das neue Familienporträt auf einmal klar vor sich sah: Sie begriff schnell, dass die Position, die sie als Nesthäkchen der Familie so genossen hatte, nun nicht mehr die ihre war – es war meine.
Da sie das jüngste von neun Kindern war, war Cynthia bereits vertraut mit der lästigen Hausarbeit. Die zusätzliche Verantwortung, die sie nun dadurch hatte, dass sie nach der Schule auf mich aufpassen musste, war für sie jedoch keine unangenehme Pflicht, sondern eine gute Gelegenheit, Rache zu üben. Ihre Foltermethoden waren auf eine passive Weise aggressiv. Sie kam niemals daher und ärgerte mich ganz direkt. Sie befolgte nur die Anweisungen meiner Großmutter bis aufs i-Tüpfelchen. Wenn ich zum Beispiel fernsah, sagte sie: „Großmutter hat gesagt, du darfst nicht fernsehen, bevor du nicht deine Hausaufgaben gemacht hast.“
„Ich bin fertig mit den Hausaufgaben“, sagte ich und hockte mich vor den Apparat.
„Na, das muss ich erst überprüfen“, sagte sie dann und schaltete den Fernseher vor meiner Nase ab! Solche Sachen machte sie absichtlich. Sie ließ mich gerade so viel von einer Sendung sehen, um mir den Mund wässrig zu machen. Meistens schaltete sie immer dann, wenn die Handlung so richtig in Gang kam, das Gerät aus und befahl Boo-Boo, seine Schularbeiten zu machen. Sie wusste verdammt genau, dass die einzigen Zeichentrickfilme, die es sich nachmittags anzuschauen lohnte, zwischen drei und halb vier liefen. Selbst wenn ich meine Hausaufgaben schnell genug machte, um noch irgendetwas Sehenswertes zu erwischen, ließ sie sich genüsslich Zeit, bis sie endlich meine Aufgaben überprüft hatte.
Die Sache ist die, dass Cynthia eine Streberin war, die Hausaufgaben und alles, was mit ihnen zusammenhing, liebte. Es ging ihr also nicht gegen den Strich, meine Hausaufgaben zu überprüfen. Nein, für sie war das toll! Etwa in der Art: „Ich kann meinen Neffen quälen und gleichzeitig auch noch Schularbeiten machen.“ Als wolle sie ihre Neigung noch unterstreichen, trug sie sogar so eine dicke Bifokalbrille. Diese Brille war es, die es mir erlaubte, einen kleinen Gegenschlag zu führen, nachdem sie Dillinger getötet hatte.
Bis zum heutigen Tag schwört Cynthia auf eine ganze Lastwagenladung Bibeln, dass sie nichts mit dem Tod – quatsch, der Ermordung – meines zweiten Hundes zu tun hat. Der erste war auf der Straße von einem Auto überfahren worden, da kann ich also fast sicher sein, dass sie nichts damit zu tun hat. Aber mit Dillinger war das etwas anderes. Der Dobermannwelpe war ein Geschenk sowohl für mich als auch für die Familie. Trotz der Androhung von Ritalin war ich außer Rand und Band. Kein Erwachsener und kein Kind im Haus konnte mit mir fertig werden. Ein Hund, so dachten alle, wäre das Beste – damit ich einen Spielgefährten und auch etwas zu tun hätte. Ich liebte diesen Hund. Er schlief selbst dann noch bei mir im Bett, als er so groß geworden war, dass der Rest der Familie Angst vor ihm hatte. Dillinger machte alle nervös, weil sie dachten, er wäre bösartig. Mit mir kam er gut aus, aber alle anderen mochte er nicht besonders.
Das einzige Problem, das ich mit Dillinger hatte, war, dass der Hund gefräßig war. Er war ein Hund, der hundertmal am Tag fressen konnte, ganz egal, was man ihm vorsetzte. Anfangs war er noch recht pflegeleicht gewesen und hatte sich mit Trockenfutter begnügt, aber als ich ihn mit den Essensresten zu füttern begann, die ich nicht wollte, kam es diesem Hund in den Sinn, dass menschliche Nahrung offenbar nicht unerreichbar war. Ein Problem. Es dauerte nicht lange, bis Dillinger auf den Tisch sprang und mir das Essen vom Teller wegfraß. Da bekam es meine Familie langsam wirklich mit der Angst, und sie tuschelten miteinander, ob man ihn nicht loswerden sollte. Ich spielte die Sache herunter und tat weiter so, als hätte ich alles im Griff, aber niemand hörte auf mich. Sie sagten nur: „Ein normaler Hund springt nicht auf den Tisch.“
Ich versuchte, mit dem Hund zu reden: „Sieh mal, wenn du weiterhin auf den Tisch springst, wollen sie dich loswerden.“ Dillinger zu erziehen war jedoch unmöglich. Ich konnte ihn einfach nicht unter Kontrolle halten. Also begann ich, ihn nach der Schule so viel wie möglich zu füttern, wenn die anderen noch nicht zuhause waren. Alles, was dabei herauskam, war, dass der Hund mir nun mein Essen gleich aus der Hand schnappte, wenn ich etwas essen wollte. Wenn ich zum Beispiel ein Sandwich essen wollte, riss er es mir sofort wieder aus der Hand und verfehlte dabei nur knapp meine Finger. Die Sache geriet jedoch erst dann richtig aus dem Ruder, als Dillinger einmal zu Thanksgiving den Truthahn fraß.
Meine Großmutter bereitete den Thanksgiving-Truthahn immer schon am Mittwoch zu, damit sie sich am Donnerstag ganz auf die letzten Vorbereitungen, Kleinigkeiten und Beilagen konzentrieren konnte. Als ich zehn war, machte sie jedoch den Fehler, den fertig gebrutzelten, riesengroßen, saftigen Truthahn über Nacht zum Abkühlen auf dem Küchentisch stehen zu lassen. Als ich am nächsten Morgen hinunter in die Küche kam, um Dillinger zu füttern, nagte er gerade die letzten Knochen des Truthahns ab. Ich war fassungslos. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass Dillingers Tage gezählt waren. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass Cynthia ihn töten würde.
Sie ging ziemlich geschickt vor. Sie spielte seine eigene Gier gegen ihn aus und ließ ihn die Hauptarbeit machen. Sie füllte einfach nur eine Schüssel mit Kakerlakenspray, sodass es so aussah wie Milch, und stellte die Schüssel auf den Boden. Natürlich hätte der natürliche Selbsterhaltungstrieb jeden normalen Hund davon abgehalten, eine Schüssel voll Gift auszutrinken. Nicht so Dillinger – er machte sich sofort über das Zeug her. Ich glaube, als er starb, war sein einziges Bedauern, dass er seine letzte Mahlzeit nicht mehr beenden konnte.
Ich wusste, dass Cynthia es mit Absicht getan hatte. Sie sagte, sie habe es nicht für ihn dort hingestellt. Aber warum sonst sollte jemand eine Schüssel mit Kakerlakenspray füllen? Ich war indes der einzige Freund, den Dillinger im Haus hatte, und so stießen alle Beschuldigungen auf taube Ohren. Ich stellte meine Rachegelüste auf die Warmhalteplatte und wartete auf eine Gelegenheit, die sicher bald kommen würde. Im rechten Moment würde ich dann blitzschnell handeln. Mehr konnte ich erst einmal nicht tun.
Die Gelegenheit kam eines Sonntagmorgens, als ich die Werbegutscheine in der Zeitung durchblätterte und auf eine Seite mit Weihnachtskupons stieß. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war, als hätte die Idee förmlich im Raum gestanden. Ich rannte hinauf, schlich mich in Cynthias Zimmer und schnappte mir die Bifokalbrille, die sie auf ihrem Nachttisch aufbewahrte. Ich rannte wieder hinunter und klebte alle Kuponmarken bis zum letzten Schnipsel auf ihre Brillengläser. Dann legte ich die Brille zurück auf ihren Nachttisch und wartete …
„Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!“, kreischte Cynthia. „Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Sie schrie so laut, dass ich Angst bekam. Ich dachte, sie hätte sich vielleicht wehgetan. Dann hörte ich: „Mama! Hilfe! Maamaaaa!“
Ich hörte, wie meine Großmutter ins Zimmer gerannt kam und Cynthia schrie: „Maaamaaa! Hilfe!!! Ich bin blind!!!“ Und dann fing meine Großmutter an zu lachen. Ich rannte hinauf und sah, wie Cynthia durch die bunten Gläser im Zimmer herumschaute. Sie konnte freilich nichts sehen und schrie: „Ich bin blind!“
Ich hatte nicht eine Sekunde lang daran gedacht, dass Cynthia ja die Angewohnheit besaß, ihre Augen erst dann zu öffnen, wenn ihre Bifokalbrille ordentlich saß. Ich wollte ihr eigentlich nur etwas Unbehagen bereiten, aber sie selbst verlieh meinem kleinen Streich eine ganz andere Dimension. Sie dachte tatsächlich, sie wäre blind. O Mann, das war unbezahlbar.
Es war Cynthia weitaus peinlicher, dass sie geglaubt hatte, blind zu sein, als wenn sie ihr Augenlicht tatsächlich verloren hätte. Und es wurde noch schlimmer: Meine Großmutter erzählte die Geschichte jedem Familienmitglied und jedem Besucher, der dieses Ereignis verpasst hatte, noch einmal von vorn. Es war, als ob ich die Geschichte jedes Mal, wenn ich sie hörte, noch einmal erleben durfte. „Hey, Herr Briefträger, haben Sie schon gehört, wie es war, als meine Tante dachte, sie wäre blind? Nein? Na, meine Großmutter wird Ihnen die Geschichte bestimmt gern erzählen. Kommen Sie doch herein, und setzen Sie sich. Es wird Ihnen gefallen.“
***
Während ich aufwuchs, passierten andauernd irgendwelche schlimmen Sachen. Die meisten meiner Tanten und Onkel dröhnten sich zu, betranken sich oder kombinierten beides. Sogar mein Großvater war ständig besoffen. Meine Großmutter mochte das gar nicht, aber sie konnte nicht viel dagegen ausrichten. Ich erinnere mich an einen Sommerabend, an dem sich alle im Hinterhof betranken. Es war nicht lange, nachdem Onkel Johnny aus der Navy entlassen worden war. Ich weiß nicht, ob Onkel Johnny sein Alkoholproblem aus der Navy mitgebracht hatte oder ob es erst anfing, nachdem er wieder zuhause war, aber er war jedenfalls an jenem Abend, an dem er sich die Hände verbrannte, sturzbetrunken.
Mein Großvater saß mit seinen Freunden draußen. Onkel Johnny saß mit Onkel Harold, Onkel Star und einigen gemeinsamen Freunden zusammen. Als die Nacht voranschritt und die Flaschen leerer wurden, begannen die alten Männer und die jungen Hirsche, sich gegenseitig mit allerhand prahlerischem Geschwätz herauszufordern. Onkel Star ließ seine glorreiche Vergangenheit als Basketballspieler wiederaufleben. Es schien ihn nicht weiter zu stören, dass sich niemand daran erinnern konnte, ihn je in einem Spiel gut spielen gesehen zu haben – von den Rekorden, die er gebrochen haben wollte, einmal ganz zu schweigen. „Ich war der Beste im ganzen Park, Mann“, sagte er. „Warum, glaubst du, hat mich Papa Star genannt?“ Mein Großvater sagte, es sei deshalb gewesen, weil er der einzige Curtis in der Familie war, aber wenn Star unbedingt Curtis heißen wollte, würde er gern mit ihm um den Namen kämpfen.
Dann sagte einer der Freunde meines Großvaters zu Onkel Johnny: „Ich wette, du kannst dieses Eis nicht von hier nach dort drüben bewegen.“ Er zeigte auf einen Block Trockeneis, den sie benutzt hatten, um die Getränke zu kühlen.
„Ich wette mir dir, dass ich diesen Eisblock tragen kann“, sagte Johnny.
„Na gut, dann wetten wir, dass du es nicht kannst.“
Johnny ging rüber zu dem Eisblock und murmelte irgendeine Scheiße vor sich hin, dass er in der Navy gewesen sei und was er alles könnte – einen Eisblock zu tragen war gar nichts. Sogar ich wusste, dass man das Eis lieber nicht berührte. Johnny aber nicht. Er bückte sich, um das Eis an den Seiten zu packen, und verbrannte sich die gesamte Haut an den Unterarmen. Meine Großmutter musste ihn ins Krankenhaus fahren, weil sie an jenem Abend die Einzige war, die nüchtern genug war, um hinterm Steuer zu sitzen.
Das ist genau die Sorte verrückter Scheiße, mit der ich aufgewachsen bin. Es passierte so viel, dass es normal erschien. Ich dachte, dass man in jeder Familie herumsaß, sich betrank und sich dann gegenseitig Streiche spielte, die zu Verbrennungen zweiten Grades führten.