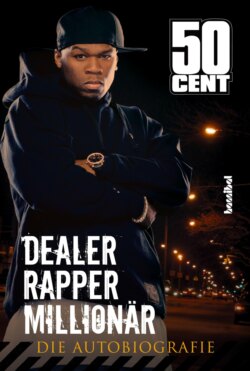Читать книгу Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie - 50 Cent - Страница 9
ОглавлениеKapitel 3
„Was soll das denn jetzt?“
Trotz des ganzen Wahnsinns, der bei mir zuhause abging, versuchte ich, eine möglichst normale Kindheit und Jugend zu verbringen. Ich spielte auf der Straße Football, wobei die Abwasserleitungen als Torpfosten dienten. Ehrlich gesagt, spielte ich eigentlich gar nicht gern Football, ebenso wenig wie alle anderen Mannschaftsspiele. Bei Mannschaftsspielen ließen die anderen Jungs den Ball fallen oder versauten einen Pass, und wir verloren das Spiel. Ich hasste diese Scheiße. Damals schon machte mich der Gedanke nervös, mein eigenes Schicksal nicht selbst in der Hand zu haben.
Ich verbrachte viel Zeit allein und träumte von Sachen, die ich mir nicht leisten konnte. Ich brachte ganze Tage damit zu, die vorbeifahrenden Autos anzuschauen: „Den da will ich haben!“ Ich kenne keinen Jungen und niemanden, der einmal ein Junge war, der dieses Spiel nicht gespielt hat. Ich glaube, es ist normal, dass kleine Jungs mit einem Spielzeugauto spielen und dabei davon träumen, ein richtiges Auto zu haben. Aber wenn ich eins sah und sagte: „Das da will ich“, dann meinte ich das tatsächlich so. Ich wollte genau dieses Auto, das Auto, das ich vor mir sah – und kein anderes. Als ich mir in den Kopf gesetzt hatte, einmal einen Mercedes-Benz zu fahren, war für mich der Fall klar. Ich wusste, ich würde das irgendwann tun. So hatte ich es mir in den Kopf gesetzt, und so würde es in Wirklichkeit auch sein. Ich bekam einen kleinen Spielzeug-Mercedes, den ich in meiner Hosentasche mit mir herumtrug, als ob ich das echte Automobil durch meinen schieren Willen herbeiwünschen könnte.
Es ist nicht so, dass dies alles reine Wunschträume gewesen wären. Die älteren Typen, die ich bei meiner Mutter gesehen hatte, fuhren alle dicke amerikanische Wagen und trugen scharfe Anzüge mit teuren Schuhen. Als ich ungefähr zehn war, bemerkte ich jedoch eine Veränderung: Andere Leute hatten nun das Geld, die Macht und das Sagen bei uns im Viertel. Die neue Generation bestand aus lauter Teenagern, die kleinere, ausländische Wagen wie Mercedes, Audi und Saab fuhren. Sie trugen Sportanzüge mit brandneuen Turnschuhen und behängten sich mit dem größten und klobigsten Goldschmuck, den sie sich nur leisten konnten.
Einer von diesen neuen Jungs war Sincere. Seine Tante lebte im Haus nebenan, und sein Großvater wohnte auch nur zwei Blocks entfernt. Er gehörte praktisch zur Familie. Manchmal sah er mich auf der Straße, wenn ich gerade nichts zu tun hatte. Meine Turnschuhe waren zerrissen, meine Kleider waren dreckig, meine Haut voller Asche. Dann öffnete er die Tür seines BMW und ging einfach mit mir einkaufen. Und zwar nicht bloß um die Ecke. Wir fuhren runter zum großen Einkaufszentrum in der Jamaica Avenue, wo wir zu Pop’s gingen. Dort kaufte er mir Jogginganzüge von Fila und alle möglichen Turnschuhe: Ellesse, Lotto, adidas, Nike. Als es draußen kühler wurde, kaufte er mir eine Jacke von Starter. Das war alles ganz toll, weil die Sachen, die er mir kaufte, auch noch gut zusammenpassten – es war nicht dieses Zeug vom Wühltisch. In Brooklyn wurden Leute für diese Sachen beraubt und umgebracht; ich bekam sie umsonst. Ich trug das Zeug, das er mir schenkte, sogar im Haus, wo mich niemand sehen konnte. Weil mir meine Großmutter keine Kleider kaufte, konnte sie mir auch nicht befehlen, etwas auszuziehen oder für einen „besonderen Anlass“ zu schonen.
Meine Großmutter tat für mich, was sie konnte, aber sie hatte schon eine ganze Reihe hungriger Mäuler zu stopfen gehabt. Als sie ihre Kinder großzog, kosteten Turnschuhe ein paar Dollar. Damals kosteten sogar die guten Markenschuhe kaum mehr als zwanzig Dollar. Die Turnschuhe, die ich wollte, kosteten aber locker fünfzig Dollar, und die richtig geilen Teile waren nah an der Hundertermarke. Das erschien ihr völlig sinnlos. In ihrer Welt bekam man für fünfzig Dollar einen guten Wintermantel und ein paar Hosen, nicht nur ein Paar Turnschuhe. Wie konnte ich sie also guten Gewissens um ein Paar Air Jordans bitten, die ein Heidengeld kosteten? Das ging nicht.
Meine Tanten und Onkel hätten nicht knapper mit Geld sein können. Einem nackten Mann greift man bekanntlich nicht in die Tasche, und wenn ich sie um Geld bat, dann war das wie eine Beleidigung: „Fünf Dollar? Wofür? Willst du sie ‚leihen‘, oder willst du, dass ich dir die fünf Dollar schenke? Hau mich bloß nie wieder um Geld an!“
Der Einzige, der sich jemals um mich sorgte, war Onkel Harold. Er hatte eine haitianische Frau namens Sharon geheiratet, deren Familie große Mengen von Marihuana und Kokain von Mexiko durch den Südwesten schleuste. Dafür, dass er ihnen die Verantwortung für ihre Schwester abgenommen hatte, verschafften die neuen Schwager meinem Onkel einen Posten in ihrem Unternehmen. Es dauerte nicht lange, bis es ihm finanziell gut genug ging, dass er sich ein Haus in Miami kaufen konnte, außerdem mietete er noch ein Apartment in Houston, von wo aus er arbeitete. Bevor er ganz nach Miami zog, kaufte er mir einen Motorroller als Ersatz für den, den man mir gestohlen hatte.
Der Mann von Tante Karen, Onkel Trevor, machte mir gern mal eine kleine Freude, obwohl er gar kein Blutsverwandter war. Jedes Mal, wenn sich unsere Pfade kreuzten, hatte Trevor etwas für mich. Seine jamaikanische Gang war berüchtigt. Als ich jünger war, wusste ich nicht viel über sie, aber ich bemerkte, dass die Typen, die ich für stark hielt, jedes Mal ganz nervös wurden, wenn Trevor oder seine Leute vorbeikamen. Ich verstand das nicht. Für mich war Onkel Trevor einfach ein netter Kerl, der gut verdiente und sein Geld mit den Leuten um ihn herum teilte. Selbst nachdem Trevor eingesperrt und zu dreizehn Jahren verurteilt worden war, betrachtete ich ihn nicht als schlechten Menschen. Einmal besorgte er meiner Großmutter sogar einen brandneuen Mercedes 190 E, weil ihr Oldsmobile ständig eine Panne hatte. Das war 1985, als dieser Mercedes noch eine verdammt heiße Schüssel war. Mein Großvater und ich fingen an, solche Scheiße zu reden wie: „Warum kriegt sie ein Auto?“
Das waren die einzigen Leute aus meinem Bekanntenkreis, von denen ich wusste, dass sie in der Lage waren, etwas für jemand anderen außer sich selbst zu tun – und sie alle vertickten Drogen. Alle Dealer waren großzügig – bis auf meinen Cousin Brian. Der gab niemals irgendjemandem irgendetwas. Hauptsächlich kümmerte sich Sincere um mich. Wenn ich mit ihm unterwegs war, konnte ich sehen, dass ihn alle mit Respekt behandelten. Die Ladenbesitzer begrüßten ihn, als gehöre er zur Familie, und die anderen Dealer sahen zu ihm auf. Ich mochte das Gefühl, das ich hatte, wenn ich mit Sincere unterwegs war. Man konnte mir auf keinen Fall weismachen, dass Dealen etwas Schlechtes war. Das waren die Leute, mit denen ich aufwuchs. Sie waren meine Vorbilder.
Zu jener Zeit, damals, in der ersten Hälfte der Achtziger, war Kokain noch eine Freizeitdroge. Meine Tanten und Onkel – Star, Johnny und Jennie (der in einem noch schlimmeren Zustand aus der Army entlassen wurde als Johnny aus der Navy) –, sie alle nahmen Kokain. Sie trafen sich mit ihren Freunden, zogen ein paar Bahnen und gingen dann aus. Wenn sie zurückkamen, zogen sie noch ein paar Bahnen und soffen, bis sie am Nachmittag des nächsten Tages schlafen gingen. Ich wurde dann morgens von all dem lauten Gerede wach und fand sie in denselben Klamotten im Wohnzimmer sitzen, die sie getragen hatten, als ich ins Bett gegangen war. Sie hatten immer so viel Spaß, dass niemand Nachschub besorgen gehen wollte, wenn das Koks alle war. Also schickten sie mich runter zu Brians Haus, um ihnen ein paar dicke Alberts zu holen. Ein „dicker Albert“ war ungefähr ein Viertelgramm Kokain, in Alufolie oder einen Fetzen Plastik eingewickelt, das für fünfundzwanzig Dollar verkauft wurde. Brian ging noch zur Highschool. Mit anderen Worten: Er war in dem Alter, in welchem er eigentlich die Highschool hätte besuchen sollen, aber ich sah ihn nie mit Büchern oder über seinen Hausaufgaben sitzen. Wenn ich ihn sah, war er herausgeputzt und wie frisch aus dem Ei gepellt. Er hing mit Kerlen herum, die viel älter als er selbst waren und Pontiac Bonnevilles mit Weißwandreifen fuhren. Aber wie ich schon sagte: Obwohl er mein Vetter war, schenkte er mir nie etwas.
Einmal hatte ich fünfzig Dollar in der Tasche und besorgte bei Brian ein paar Alberts. Er trug ein brandneues Paar Turnschuhe, und fünf oder sechs Schachteln mit Tretern, die er noch nicht einmal angehabt hatte, stapelten sich in seinem Zimmer. Es war mit das Verrückteste, das ich je gesehen hatte. Es sah aus wie in einem dieser Schuhgeschäfte, in die Sincere mit mir ging. Ich fragte Brian, ob er mir nicht ein neues Paar Turnschuhe kaufen wollte, weil die, die ich hatte, völlig ausgelatscht waren. Ich zeigte ihm die Sohlen meiner Lottos. Ein zerrissener Socken und die Spitze meines großen nackten Zehs schauten heraus, als wollten sie hallo sagen. Dieser Nigger Brian lachte mich aber aus, zählte das Geld, das ich ihm gegeben hatte, gab mir die zwei Alberts und schickte mich wieder fort. Ich dachte so was wie: „Scheiß auf ihn.“ Danach ging ich nie wieder zu Brian, um irgendetwas zu besorgen. Von da an ging ich zu Sincere.
Doch es kam die Zeit, als mir auch Sincere keine Kleider oder Turnschuhe mehr kaufen wollte. Sincere begann sich zu verändern. Mel und Jack, zwei von den älteren Jungs aus dem Viertel, hatten seinen Großvater gekidnappt und verlangten Lösegeld. Mel und Jack waren dieselben zwei Kerle, die sich auch auf Banküberfälle spezialisiert hatten. Die Zeiten änderten sich, aber Typen wie sie weigerten sich, sich mit ihnen zu verändern. Es mangelte ihnen an der Finesse und der Geduld, die das Drogengeschäft erforderte, also klammerten sie sich an ihren alten Haurucktaktiken fest. „Übernahme“ – so nannten sie es. Überfälle am helllichten Tag: „Alle auf den Scheißfußboden – mach den Safe auf, du Schlampe.“ Fast immer hatten sie es auf die Kohle im Safe abgesehen, denn dort lagerte das wahre Geld. Das Geld an der Kasse war nur Kleinkram und oft registriert. Das Geld im Safe war vielleicht auch mit einer Seriennummer registriert, aber es war in jedem Fall ein besserer Gegenwert zu dem Risiko, das man einging, wenn man Wächter, Kunden und Angestellte mit dem Gesicht auf dem Fußboden mit der Waffe in Schach hielt wie in den Tagen von Al Capone. Dann begannen sie auch noch Drogen einzuwerfen, als wären sie nicht schon verrückt genug.
Sincere sagte, ich müsste über solche Sachen die Klappe halten. Das brauchte er mir gar nicht zu sagen, denn die ganze Angelegenheit machte mir auch so schon gehörig Angst. Ich dachte: Was soll das denn jetzt? Diese ganze Scheiße ergab für mich einfach keinen Sinn. Ich fragte Sincere, wie es passiert war, und er erzählte mir, dass jemand den Fehler begangen hatte, Mel und Jack zu sagen, dass er Geld im Haus aufbewahrte. Sincere wusste nicht ganz genau, wer da sein Maul nicht gehalten hatte, aber er war sich ziemlich sicher, dass es Gary gewesen war. Gary war ein Junge aus dem Viertel, der die Angewohnheit hatte, bei den falschen Leuten mehr zu sagen, als für ihn gut war. Sincere hatte am Tag, bevor alles geschah, mit Gary abgehangen – und dieser Mel war der Vater des Babys von Garys Schwester. „Ich glaube nicht an Zufälle“, sagte er. Er glaubte nur an das, was er sehen konnte. Und er sah Mel und Jack, obwohl sie Masken getragen hatten. Die Räuber kidnappten seinen Großvater und schossen den alten Mann an, um Sincere mitzuteilen, dass sie es ernst meinten. Sie wollten Geld, und sie waren bereit, Leute zu durchlöchern, um es zu beweisen.
Die Geschichte öffnete mir die Augen für das, was wirklich abging. Bis zu diesem Punkt hatte ich an eine gewisse Ganovenehre geglaubt. Aber an diesem Abend schlug ich mir diese Illusion aus dem Kopf. Es ging nur ums Geld, und jeder schaute nur auf sich selbst.
„Ich begreife diese ganze Scheiße nicht, Boo-Boo, Mann“, sagte Sincere. Seine Augen wanderten umher, als erwarte er Mel und Jack jede Minute zurück. „Man kann heute offensichtlich nicht einmal mehr ein kleines Geschäft betreiben“, sagte er. „Nimm dich vor Gary in Acht.“
Sincere sagte, dass Brian genau dasselbe passiert war, nachdem er eine Weile lang mit Gary um die Häuser gezogen war. Es war nicht so, dass Gary irgendwelche Schwierigkeiten machen wollte. Er war ganz einfach erregt, wenn er sah, wie gut es den Leuten um ihn herum ging. Vielleicht dachte er, dass es ihn selbst wichtiger erscheinen lassen würde, wenn er herumerzählte, dass er mit wichtigen Leuten verkehrte. Aber Typen wie Mel und Jack hatten schon immer ihre eigenen Pläne. Sie kamen bei Brian vorbei, um ihn auszurauben. Als sich Brians Mutter weigerte, die Tür zu öffnen, versuchten sie, sich mit Gewalt Zugang zu verschaffen, und schossen Brians Mama schließlich in den Kopf. Ich wusste, dass Brians Mama erschossen worden war, aber bis zu jenem Abend kannte ich die Details noch nicht. Sincere sagte, dass es besser sei, solange Typen wie Mel und Jack frei herumliefen, darüber Stillschweigen zu bewahren, was man hat, und wie viel davon man bei sich zuhause aufbewahren sollte. Ich stimmte zu.
Ich hatte das Gefühl, dass mich Sincere auf etwas vorbereitete, aber ich war nicht ganz sicher, was es war.
„Hör zu, Mann, ich kaufe dir ein Paar Turnschuhe, die werden dann bald wieder schmutzig, und ich muss dir wieder ein neues Paar kaufen“, sagte Sincere. Dann zog er ein kleines zusammengewickeltes Päckchen Kokain hervor und sagte mir, dass es ein bisschen mehr als ein Gramm des Pulvers enthielt. Er teilte das Tütchen in fünf gleich große Portionen auf und wickelte sie in Folie. „Das sind fünf Alberts, Mann“, sagte er. „Verkauf sie an deine Onkel und Tanten, und gib mir dafür hundert Dollar wieder.“
Ich hielt die kleinen Bällchen in meiner Hand und blickte auf etwas, das meine erste profitable Transaktion mit Drogen werden sollte. Sincere erzählte mir, dass Kokain in Pulverform mehr und mehr aus der Mode kam. Alle verkauften und rauchten nun kleine gekochte Klumpen; die Stückchen hatten den schnellen Rauscheffekt von reinem Kokain. Bis zu diesem Zeitpunkt war reines Kokain hauptsächlich von Weißen konsumiert worden. Nun bereiteten sie das Koks in Löffeln oder auf einem Fetzen Alufolie auf. Sie kochten es mit Bleichmitteln, Ammoniak oder sonst einem stinkenden Scheißzeug, das man zum Putzen verwendet. Das konnte jedoch böse ins Auge gehen, denn die Chemikalien sind hochentzündlich. Genau so hat sich der Komiker Richard Pryor fast verbrannt, Mann. Bei den neuen gekochten Klumpen, von denen Sincere sprach, musste man nicht mehr mit brennbaren Haushaltsmitteln oder etwas in der Art herumhantieren. Er sagte, dass die Gewinnspanne zwar nicht so hoch war, als wenn man reines Pulver verkaufte, und dass man das auch nicht dadurch ausgleichen könnte, dass man das Koks mit Laktose oder Ajax verschnitt, um es zu strecken. Aber die reine Verkaufsmenge würde es schon rausreißen, denn die Wichser liebten das Zeug. Die Süchtigen kämen nach fünfzehn Minuten wieder, als hätten sie gar nichts geraucht. Sincere sagte, er verkaufe es hauptsächlich an weiße Leute, die von Long Island herüberkämen, aber dass mittlerweile auch die schwarze Gemeinde auf den Geschmack gekommen sei. Die Schwarzen vermischten es mit ihrem Grass und rauchten es, und sie liebten diesen Wumms. Er sagte, das Zeug sei ursprünglich von den Bahamas gekommen, dann verbreitete es sich nach Miami, und inzwischen kam es aus L. A., Mann. Es war überall: Chicago, Detroit, San Diego, Minnesota, Boston, San Francisco. „Ich könnte noch weitermachen, aber ich würde dir ja doch nur die Karte der USA vorlesen“, lachte Sincere. „Ich glaube, diese Wichser hier sind noch etwas hinterher, Mann.“ Er erschien fast wie ein Gelehrter, als er erklärte, wie sie auf den Bahamas derart viel Kokain gehabt hätten, dass sie begannen, daraus reinen Stoff zu kochen, um es schneller loszuwerden. Sie lösten es in Kerosin oder Säure auf und banden es dann mit Kalk. „Aber die Nigger haben keine Zeit für diese ganze Scheiße“, sagte er. „Die Nigger verschneiden es mit Backpulver, dann kochen sie die Scheiße. Glaubst du so eine Scheiße? Backpulver? Derselbe Scheiß, mit dem sie das Haus putzen und den Kühlschrank frisch halten. Hundsordinäres Backpulver!“
Er malte mir die Zukunft aus und verlor sich dabei in sämtlichen großen und kleinen Details. Er reiste von den Bahamas nach L. A., zu all diesen Punkten auf der Karte, sprach von dem Backpulver für den Kühlschrank und dem Geld, das er verdienen würde, vom Kokainkochen und den Kapseln, in denen sie es verkaufen würden, den Pfeifen, Flaschen und Glühbirnen, in denen es geraucht wurde. „Die Scheiße sieht aus wie kleine Stückchen Seife“, sagte er. „Die Nigger rauchen es in Glasröhrchen mit Haushaltsschwämmen als Filter.“ Ich hörte zu, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wovon er sprach. Ich merkte, dass er aufgeregt war, aber diese ganze abgehobene Kacke war nicht mein Ding. Ich konzentrierte mich lieber auf die Päckchen in meiner Hand. Ich wusste, dass ich ein Stück vom Kuchen abhaben wollte, aber ich sah keine Möglichkeit, wie ich für ihn arbeiten könnte. Ich war zu jung. Ich ging noch zur Schule. Ich kannte die Spielregeln nicht. Sincere warf seinen Kopf in den Nacken und lachte: „Nur mit sechs kannst du nicht dealen.“
Als er mir das gesagt hatte, warf ich all meine Zweifel über Bord. Sincere klang, als ob er aus Erfahrung sprechen würde – wenn er nicht selbst mit sechs gedealt hatte, dann musste er genug sechsjährigen Drogendealern begegnet sein, um zu wissen, wovon er sprach. Abgesehen davon musste man mich nicht erst überzeugen. Ich wollte mir meine Scheibe vom großen Kuchen abschneiden und hielt meine Zukunft buchstäblich in den Händen.
Ich verstaute die dicken Alberts in meinem Zimmer. Wann immer mich meine Onkel nach Kokain schickten, nahm ich einfach etwas aus meinem Depot, drehte eine Runde um den Block, um ein wenig Zeit totzuschlagen, und kehrte dann zurück. Wenn mein Vorrat alle war, ging ich wieder zu Sincere und füllte ihn neu auf. Ich war gerade mal elf. Ich ging immer noch zur Schule, also konnte ich nur nachmittags nach dem Unterricht dealen, wenn meine Großeltern dachten, dass ich draußen auf der Straße wäre und spielte. Ich arbeitete mich schnell ein, denn alles, was man zum Dealen wissen muss, kann man in weniger als einem Jahr lernen. Die meisten Dinge, auf die man achten muss, begreift man sehr früh, da sich alles ständig wiederholt. Es ist immer wieder derselbe Kreislauf. Es ist nichts Neues. Man weiß, dass man nicht darüber sprechen darf, was man tut, und man weiß, dass es nicht cool ist, andere Dealer zu verpetzen. Alles andere eignet man sich während der Arbeit an.
Je länger ich dealte, umso einfacher wurde es. Und je einfacher es wurde, umso mehr hatte ich davon. Anfangs konnte ich mir Kleinigkeiten leisten, Snacks und Fastfood. Dann konnte ich mir schon Turnschuhe und Kleider kaufen. Schließlich fing ich mit kleinen tragbaren Videospielen an, aber das war vollkommen unsinnig: Ich hatte gar keine Zeit für Videospiele; ich musste Koks verkaufen.
***
Crack hatte auf der Straße viel härtere Auswirkungen, als sich Sincere damals vorstellen konnte. Ich war immer noch dabei, überhaupt Fuß zu fassen, als sich die Spielregeln änderten. Am 26. Februar 1988 wurde in meinem Viertel ein Bullengrünschnabel erschossen, der in seinem Streifenwagen saß. Er gab einem Zeugen Polizeischutz, der sich bereit erklärt hatte, in einem Prozess gegen ein paar Dealer auszusagen, die auf der anderen Straßenseite, gegenüber von seinem Haus, Crack verkauften. Der Bulle wurde fünfmal in den Kopf geschossen. Die Polizei sagte, dass ein in Haft sitzender Dealer von der Southside den Killer bestellt hätte.
Nach dem Tod des Bullen dauerte es nur ein paar Stunden, bis sich die Machtverhältnisse in der Southside geändert hatten. Wenige Monate zuvor war das Viertel endgültig zum festen Revier der Dealer geworden. Sie gingen ihren Geschäften auf offener Straße nach, als hätten sie eine Generalamnestie. Halb tote, völlig zugedröhnte Gestalten streiften Tag und Nacht durch die Straßen wie Überlebende eines Atomschlags. Die normalen Leute waren zu verängstigt, um etwas zu sagen, und die Bullen kratzte es nicht weiter. Aber als es einen aus ihren eigenen Reihen erwischte, machte die New Yorker Polizei Ernst. Das Straßenleben wurde bald vom starken Arm des Gesetzes und seiner wütenden Faust lahm gelegt. Außenposten sprossen über Nacht wie Pilze aus dem Boden, und Streifenwagen fuhren durch die leer gefegten Straßen wie Steppenläufer. Man konnte Rammböcke hören, Razzien wurden durchgeführt, und einen Augenblick lang – aber nur für einen Augenblick – sah die Southside so aus, wie sie vielleicht ausgesehen hätte, wenn Crack nicht erfunden worden wäre. Aber es war nur eine leere Drohung, eine Einschüchterungsstrategie ohne Besatzungsplan. Es war nicht Teil eines Prozesses, und man wollte schon im Ansatz keine Veränderung herbeiführen. Die Auswirkungen der Aktion sollten und konnten auch gar nicht lange anhalten, da sich die ganze Sache nicht damit befasste, was wirklich im Bezirk vor sich ging. Die Dealer dealten, weil wir Geld brauchten. Die Abhängigen brauchten Drogen. Und ohne Jobs oder brauchbare Alternativen würde das auch so bleiben.
Der Mord an dem Grünschnabel war im ganzen Land auf den Titelseiten und heizte den „Krieg gegen Drogen“ richtig an. In den Jahren zuvor waren bereits verbindliche Mindeststrafen für Drogenvergehen und Strafrichtlinien auf Bundesebene eingeführt worden, nun aber kam das Drogenmissbrauchsgesetz von 1988, das für „schwere Dealer“ die Todesstrafe forderte und vorsah, dass wegen Drogen verurteilte Delinquenten mindestens fünfundachtzig Prozent ihrer Haftstrafe verbüßten. Dies führte auch dazu, dass Polizeieinheiten wie die „Taktische Drogeneinheit“ (Tactical Narcotics Team, TNT) und, zur Verstärkung vor Ort, die Street Narcotics Enforcement Unit geschaffen wurden, was der Polizei im Umgang mit den Straßendealern uneingeschränkte Machtbefugnisse verlieh.
Aber es gab keine Jobs. Ohne Jobs erreichten diese harten Maßnahmen nur, dass sich bald eine neue, einfallsreichere und damit widerstandsfähigere Sorte von Dealern entwickelte. Wenn das Viertel das Koks war, dann war der Mord an dem jungen Bullen das Backpulver. Und eine aggressive Polizeimacht war das Feuer, das eine ganz neue Generation von Dealern hervorbrachte. Dealer wie mich.