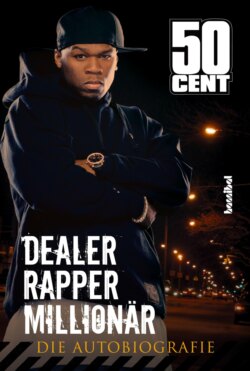Читать книгу Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie - 50 Cent - Страница 7
ОглавлениеKapitel 1
„So was wie Crack gab es noch nicht …“
Ich kann mich an die Zeit erinnern, als es so was wie Crack noch nicht gab. Klar, man konnte schon auf die eine oder andere Weise high werden. Jeder konsumierte den alten Klassiker: Grass, Shit, Dope, Kraut, Pot, Indo, Doja, Trees, Chronic, Cheeba – wie immer sie es damals auch nannten und wie immer sie es heute nennen, es war Marihuana; es war ein Ausweg, wie Ferien, die man mit sich herumtragen konnte.
Es gab Heroin, das aus Morphium gemacht wurde, und das Morphium wurde aus Opium hergestellt. Opium gab es schon lange vor Jesus. Es war in Asien, Europa und dem Mittleren Osten sehr beliebt – sie verwendeten es als Medizin. Morphium gibt es noch nicht so lange. Es wurde zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts von einem deutschen Arzt als Schmerzmittel entwickelt, das er nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume, benannte. In Vietnamfilmen, wenn ein Soldat völlig zusammengeschossen wird und starke Schmerzen hat – wenn er ganz schwer atmet und dem Typen, der seine Hand hält, das Versprechen abnimmt, dass seine Mutter oder seine Freundin oder wer auch immer seinen letzten Brief und das kleine Herz erhält, das er aus Holz oder sonstwas gemacht hat –, dann schreit der Typ, der den Arm des Soldaten hält: „Doc! Wir brauchen mehr Morphium!“ Dann kommt der Arzt angerannt und verpasst dem Typen eine Dosis von dem Zeug mit seiner Nadel. (Ich kann mich an einen Film erinnern, wo der Kommandant dem Typen einfach einen Gnadenschuss gesetzt hat, weil sie das Morphium sparen mussten, aber das gehört jetzt nicht hierher.) Wenn der Typ das Morphium bekommen hat, ist alles in Ordnung. Keine Schmerzen mehr. Er wird ganz friedlich und schwebt Morpheus direkt in die Arme. Ich glaube, Heroin hat diesen Traumgottfaktor vollkommen übertrieben, denn die einzige Wirkung, die ich jemals beobachten konnte, war, dass die Leute total abgeschaltet haben, wie wandelnde Zombies.
Kokain gibt es auch schon ziemlich lange. Aber man ist damit nicht immer so umgegangen, wie man es heute tut. 1863 hat man in Italien Kokain dazu verwendet, einen Wein herzustellen, den sogar der Papst so sehr liebte, dass er von seiner Eigenschaft, „den göttlichen Funken der Seele zu erwecken“, schwärmte – oder so ähnlich. Zwanzig Jahre später bezeichnete Sigmund Freud, der Vater der modernen Psychologie, Kokain als „magisch“ und konnte gar nicht genug von dem Zeug bekommen – er blieb noch nicht einmal beim Wein. Er pfiff sich das Rohweiß rein – schnupfte es, spritzte es, pinselte es sich auf die Haut. Damals war Kokain eine Wunderdroge, ein Anregungsmittel und Schmerzkiller, ein Stoff, der alles von der Impotenz bis zur Masturbation heilte und als Betäubungsmittel bei Operationen verwendet wurde. Es gab sogar Werbeanzeigen, in denen Kinder für Kokainpastillen zum Preis von fünfzig Cent warben: „Die helfen sofort!“ Ein Typ in Atlanta fing ebenfalls an, diesen Wein herzustellen, aber dann kam die Prohibition, also nahm er den Alkohol heraus und nannte es Coca-Cola. Irgendwann, etwa zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde Kokain verboten und zu einem ernsthaften Problem. Es war aber immer noch erhältlich, wenn man die richtigen Leute kannte.
Das alles und noch viel mehr war gerade im Gange, als meine Großeltern Curtis und Beulah Jackson von Ackerson in South Carolina nach South Jamaica in Queens zogen. Aber so etwas wie Crack gab es noch nicht. Das kam erst später.
Damals war Queens, das groß genug ist, um als Amerikas fünftgrößte Stadt durchzugehen, ein Zufluchtsort für relativ erfolgreiche Schwarze. Die Situation in Harlem, dem ursprünglichen Negermekka der Stadt, verschlechterte sich unter dem Druck der vielen Schwarzen, die aus dem Süden kamen, um in der Großstadt ihr Glück zu versuchen. Die ehemaligen Sklaven beschlossen, sich von ihrer kleinen Ecke in New York aus aufzumachen, ließen Lower Manhattan hinter sich (das sogar damals schon viel zu teuer für die meisten Menschen war) und kamen erst auf der anderen Seite des Flusses wieder zur Ruhe – unter den Bäumen, die in Brooklyn wuchsen. Bald jedoch erwies sich selbst Brooklyn als viel zu nah am Wahnsinn des innerstädtischen Daseinskampfs. So kam es, dass sich Queens zur Heimat einiger recht bemerkenswerter Neger entwickelte. Im ersten Abschnitt des zwanzigsten Jahrhunderts lebte dort Lewis Latimer, der Erfinder, der die von seinem Mentor Thomas Edison geschaffene Glühbirne weiterentwickelte, indem er den Glühfaden aus Kohlenstoff erfand und patentieren ließ. Später, in den Fünfzigerjahren, war Queens die Heimat von Jazzgrößen wie John Birks „Dizzy“ Gillespie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, William „Count“ Basie und dem Baseballgiganten Jackie Robinson. Queens ist nur einen Steinwurf von Brooklyn entfernt, das man auch „King’s County“ nennt, und das Einzige, was die beiden Viertel voneinander trennt, sind die von Menschenhand gezogenen Striche auf der Landkarte. Queens ist jedoch ganz anders bebaut als Brooklyn. Da es weiter im Inland gelegen ist, wurde es viel lockerer und in einem weniger urbanen Stil geplant und besiedelt als Brooklyn oder Manhattan, welchen im Großen und Ganzen ein Raster zugrunde liegt. Die fast dörfliche Landschaft von Queens mit ihren niedrigen Brücken und dem Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln machte es zu einem großartigen Zufluchtsort für diejenigen, die einen leichten Zugang zur Großstadt wünschten, aber ohne die Gefahren eines dauerhaften Wohnsitzes im Kern des verrotteten Big Apple.
Meine Großeltern hatten neun Kinder: Curtis Jr., Geraldine, Cynthia, Jennifer, Harold, Johnny, Karen und Sabrina, meine Mutter. Zu der Zeit, als meine Mutter geboren wurde, 1960, begann Queens zu verdrecken. Es war nicht länger der schnelle Rückzugsort vor der Verkommenheit der Stadt. 1964 wurde der Bezirk zum nationalen Brennpunkt der Aufmerksamkeit, und das nicht nur, weil Queens Gastgeber der Weltausstellung war oder weil dort das Shea-Stadion eröffnet wurde, sondern wegen dem, was mit Catherine „Kitty“ Genovese geschah. Sie wurde ermordet. Zweieinhalb Meilen vom Haus meiner Großeltern entfernt stach man über eine halbe Stunde lang insgesamt siebzehnmal mit einem Jagdmesser auf sie ein, während achtunddreißig Menschen von ihren Wohnungen aus zusahen. Nach diesem Ereignis führte die Stadt das 911-Notrufsystem ein. Die Zahl der Weißen, die in die Bezirke Nassau und Suffolk auf Long Island zogen, stieg aufgrund der vielen Schwarzen, die herüberkamen, enorm an. Das ist das Queens, das ich kenne. An alles andere kann ich mich entweder noch aus der Schulzeit erinnern, oder ich lese darüber in Zeitschriften, wenn Leute über den Ort schreiben, an dem ich aufgewachsen bin.
Den Worten meiner Mutter zufolge geschah das Unmögliche, als sie fünfzehn Jahre alt war – am 6. Juli 1975, um genau zu sein. Sie brachte mich unbefleckt zur Welt, genau so, wie es Maria mit Jesus gemacht hat. Sie nannte mich ihrem Vater zu Ehren Curtis James Jackson III., rief mich aber Boo-Boo. Der einzig wahre und echte Curtis Jackson war und ist immer noch mein Großvater; selbst mein Onkel Curtis Jr. musste sich nach einer Weile Star nennen lassen. Wenn ich meine Mutter nach meinem Vater fragte, sagte sie immer: „Du hast keinen Vater. Ich bin deine Mutter und dein Vater.“
Obwohl ich nicht wusste, was das bedeutete, wusste ich doch, was es für mich hieß. Wenn man als Kind in meinem Viertel aufwuchs, dann war es ungewöhnlich, beide Elternteile um sich zu haben. Entweder hatte man einen Elternteil, oder man hatte Großeltern. Soweit ich das beurteilen konnte, war ich ziemlich gut dran. Und wenn es darauf ankam – egal, ob es nun um Liebe, Geld oder Autorität ging –, dann war meine Mama zur Stelle. Das war alles, was für mich zählte.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mehr mit anderen Frauen ausging als mit Männern. Sie hatte da so eine Freundin namens Tammy, die immer bei uns war, also fragte ich meine Großmutter einmal: „Warum sieht man Mama immer nur mit Tammy?“ Meine Großmutter sagte: „Das solltest du besser deine Mutter fragen.“ Von da an ließ ich die Finger von dem Thema. Ich war jung, aber ich war nicht dumm. Ich hatte früh gelernt, dass es, was meine Mutter betraf, Sachen gab, über die man sprach, und Sachen, über die man nicht sprach.
Meine Mama war, mit einem Wort, hart. Sie war richtig aggressiv. Als Erziehungsberechtigte war sie stur. Wenn sie mich zu etwas motivieren wollte, war sie noch strenger. Sie ermutigte mich, Dinge zu tun, von denen ich wusste, dass ich sie ohne meine Mutter im Rücken gar nicht tun könnte. Einmal, als ich fünf Jahre alt war, kam ich weinend in das Haus meiner Großeltern gerannt, weil ich mich mit einigen Jungs aus der Nachbarschaft geprügelt hatte.
Wir hatten mit Murmeln gespielt, und als einer der Jungs einen wirklich einfachen Schuss verbockte, lachte ich ihn aus. Er muss einen schlechten Tag gehabt haben, denn er wurde richtig wütend und wollte mit mir kämpfen. Weil er viel größer war als ich, schlugen sich all die anderen Jungs auf seine Seite, um mich zu verdreschen. Ich dachte, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Dieser Junge hatte die zulässige Höchstgröße für Fünfjährige bereits überschritten. Er war so groß, dass man ihn leicht auf acht oder neun geschätzt hätte. Wenn wir an einer Boxmeisterschaft teilgenommen hätten, dann wäre er mindestens drei Gewichtsklassen über mir gewesen. Es war also nicht so, dass er Hilfe nötig gehabt hätte. Mir blieb also gar nichts anderes übrig: Ich steckte meine Prügel ein und ging weinend nachhause.
Als ich heimkam, war meine Mutter angepisst. Sie fragte: „Warum zum Teufel weinst du?“
Ich erklärte es ihr. „Da ist ein Junge“, sagte ich, „der ist so groß wie ein ganzer Block, vielleicht sogar zwei. Er hat mich verhauen und war noch nicht mal ganz fertig mit mir, als ich abhauen konnte. Wenn es dir also nichts ausmacht, würde ich gern den Rest meines fünften Lebensjahrs im Haus verbringen.“
Meine Mama fragte, wo er sei. Ich sagte: „Er ist immer noch da draußen und verdunkelt wahrscheinlich die Sonne. Man kann nicht gegen ihn an, Mama.“ Sie sah mich an, als hätte ich meinen gesunden Menschenverstand draußen auf der Straße gelassen. Ich weiß nicht, ob es sie schockierte, dass ich dachte, sie würde meinen Kampf für mich ausfechten, oder ob sie nur enttäuscht war, weil ich weggerannt war. Sie sagte: „Geh wieder raus und kämpfe mit ihm. Wenn du wieder den Arsch voll kriegst, dann fang nicht noch mal zu heulen an.“
Ich hätte geschworen, dass mit meinen Ohren etwas nicht in Ordnung war. Oder vielleicht mit ihren. Ich sagte: „Mama, dieser Junge ist groß, weißt du, ganz groß.“
„Es ist mir egal, ob er größer ist als du“, sagte sie. „Wenn es sein muss, nimm irgendwas und hau ihn damit. Aber du kommst hier nicht noch einmal heulend rein.“
Es war nun keine wirklich schwere Entscheidung mehr. Schlimmstenfalls würde mich mein Gegner töten. Aber in diesem Moment hatte ich weitaus größere Angst vor meiner Mama. Ich ging also wieder hinaus, hob einen Stein auf, den ich kaum mit einer Hand halten konnte, und prügelte damit die Scheiße aus ihm heraus. Es war das erste Mal, dass ich jemanden so hart schlug, dass er zu Boden ging. Er lag zusammengekrümmt und blutend auf dem Boden und sagte, dass er seiner Mutter von mir erzählen würde. Aber das war mir egal. Alles, was seine Mutter tun konnte, war, mit meiner Mutter zu reden, und ich hatte das starke Gefühl, dass ein Streit zwischen unseren Müttern ganz ähnlich ausgehen würde wie der zwischen ihm und mir. „Na und?“, schrie ich. „Erzähl’s doch deiner Mutter. Sie kann gern auch Prügel beziehen!“
All die anderen Jungs begannen, den Streit wieder anzufachen. „Ohhhhh! Er hat über deine Mami gesprochen!“ Ich sagte ihnen, sie sollten die Klappe halten, oder sie würden auch Prügel einstecken. Sie hielten die Klappe. Und der Junge kam nie mit seiner Mutter hierher. Im Gegenteil: Er hat mich von da an sogar ganz in Ruhe gelassen.
So war das Leben damals mit meiner Mama. Ich wusste, dass ich alles tun konnte, solange ich nur ihre Zustimmung hatte. Aber sie war nur selten da. Sie war aus dem Haus meiner Großeltern ausgezogen, als ich noch ein kleines Baby war, und hatte mich mit ihnen zurückgelassen. Aber jedes Mal, wenn sie kam, brachte sie mir etwas mit. Jeder Besuch war wie Weihnachten. Wenn es nicht Spielzeug, Kleider oder ein kleines Schmuckstück gab, dann gab es kaltes, hartes Bargeld. Als ich sechs war, schenkte sie mir ein Motocrossrad für Kinder. Es war eindeutig aus zweiter Hand, aber es war sauber, und ich bekam noch einen brandneuen Helm dazu. Damals bekam ich langsam spitz, dass sie Drogen verkaufte, also wusste ich, dass sie es vermutlich von jemandem in Zahlung genommen hatte, der nicht mehr genug Geld hatte, um seine Schulden bei ihr zu begleichen. Das war mir egal. Tatsächlich wertete es das Moped sogar noch auf, weil ich wusste, dass sie bei ihrer Arbeit an mich dachte. Und, verdammt, für mich war es ja neu. In meinen Augen war es ein neues Rad, ja, ich hatte jetzt sogar ein Motorrad. Ich konnte es kaum fassen. Ich musste nun nicht mehr meine Zeit darauf verschwenden, in die Pedale zu treten, um vorwärts zu kommen. Nein! Alles, was ich brauchte, waren ein, zwei Quarter für ein bisschen Sprit, und ich konnte den ganzen Tag herumfahren. Meine Mutter hatte eine echte Motocrossmaschine für Erwachsene, und sie erlaubte mir, neben ihr auf der Straße zu fahren. Die meisten Mütter hätten wohl gesagt: „Nein, das geht nicht, du könntest dir sonst wehtun.“ Sie aber sagte: „Hab keine Angst, du schaffst es. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dir wehtust – und Dinge, die wehtun, dauern nicht besonders lange.“ Immer wenn sie vorbeikam, brausten wir gemeinsam die Straße hinunter.
Das Rad war klein genug, dass es durch die Eingangstür im Haus meiner Großmutter passte. Also nahm ich es mit hinein und verbrachte Stunden damit, es zu polieren und die Speichen und alles andere auf Hochglanz zu bringen, bevor ich das nächste Mal damit fuhr. Ich putzte das Rad häufig, denn an vielen Tagen hatte ich nicht genug Benzingeld. Und manchmal, wenn ich das Geld hatte, konnte ich niemanden finden, der mich zur Tankstelle brachte. Freilich gab es acht Onkel und Tanten im Haus, aber die Meisten von ihnen waren noch Teenager und fühlten sich nicht für mich verantwortlich.
Mit so vielen Kindern im selben Haus mangelte es hinten und vorn an allem, was für die meisten Kinder selbstverständlich ist. Zwar war immer genug für alle da, aber es gab nie genug von den guten Sachen. Es gab genug zu essen, aber nicht genug von den Leckereien, die sie im Fernsehen zeigten, dem Zeug, welches das Leben erst lebenswert machte, dem Zeug, das einen zu einem Niemand machte, wenn man es nicht bekommen konnte. Es gab ausreichend Kleidung, aber nicht genug Sachen, die nicht schon von jemand anderem abgetragen waren, nicht genügend Kleidung, die nicht schon bis aufs Grundgewebe verwaschen war, nicht genügend Sachen mit diesen Zettelchen und Bildern dran, die einen davor schützten, dass die anderen Kinder über einen lachten. Wir hatten genug Geld zum Leben, aber doch nicht genug, um im Winter die Kälte draußen zu halten, die sich durch das Haus fraß. Es gab genügend Eimer, aber nicht genug, um die Tränen des Hauses aufzufangen, wenn es weinte, weil es den Regen nicht länger ertragen konnte.
Es war immer jemand da, was bedeutete, dass ich ständig jemandem in die Quere kommen konnte. Ich war ein vorwitziges Kind, und als Lohn für meine Neugier wurde ich bald aus der Nähe von all dem verbannt, was ich so gern belauscht hätte: „Halt dich aus den Angelegenheiten der Erwachsenen raus. Geh hinauf.“ Ich war immer der Nigger vom Obergeschoss. Ich lernte das Geschoss sehr gut kennen – ich und meine kleinen grünen Soldatenfiguren. Ich sprach mit ihnen so, als wären sie richtige Menschen. „Immer wollen sie, dass wir hinaufgehen“, sagte ich dann. Und meine Soldaten entgegneten: „Das tun sie nur, weil sie dumm sind. Sie sind nicht so schlau wie wir. Wir könnten uns ohne sie viel besser amüsieren.“ „Wisst ihr was? Ich glaube, ihr habt Recht.“ Als ich begann, allein zur Schule zu gehen, war ich nicht allein. Meine Soldaten waren bei mir. Es gab einen Hund, vor dem ich immer große Angst hatte, weil er jedes Mal, wenn ich vorbeiging, zum Tor gerannt kam und bellte, als wollte er mich fressen. Also redete ich mit meinen Soldaten. „Habt keine Angst. Der Hund wird uns nichts tun. Ich trete den Hund, wenn er durch dieses Tor kommt.“ So redete ich mir erfolgreich ein, dass ich keine Angst vor diesem Hund hatte. Ich lief immer mit einem meiner Soldaten herum und sagte ihm, dass er keine Angst haben müsse, und dann begann ich mich so zu verhalten, wie ich es dem Mann geraten hatte. „Schau, ich hab keine Angst vor dem Hund. Ich zeig’s dir.“ Dann trat ich gegen das Tor und rannte weg. „Siehst du, ich hab dir doch gesagt, ich hab keine Angst.“
Manchmal schmissen meine Tanten so genannte Dollarpartys im Hinterhof, bei denen sie von ihren Freunden für den Zugang zum Hof und zur Party einen Dollar Eintritt verlangten. Das ergab keinen Sinn für mich, denn ein andermal luden sie auch Leute in den Hinterhof ein und verlangten nichts dafür. Aber sobald sie ein bisschen Musik anwarfen und etwas zu essen auftischten, mussten dieselben Leute, die an jedem anderen Tag der Woche bei uns umsonst aßen, dafür bezahlen, wenn sie durchs Tor gehen wollten. Diese Partys waren meine frühesten Erfahrungen in Sachen Marketing. Es war außerdem das erste Mal, dass ich sah, welche Wirkung HipHop auf die Menschen hatte. Oft war es so, dass sie alte Soulnummern spielten und alle wirklich cool dazu tanzten. Wenn dann aber ein HipHop-Song kam, ging die Party erst richtig los. Die Jungs begannen, zur Musik zu rappen, und die Mädchen fingen an, kleine Tanzfiguren vorzuführen. Immer waren auch ein paar Typen dabei, die sich richtig gut auskannten und dann mit Pop-Lock und Breakdance loslegten. Ich sah von meinem Zimmerfenster im Obergeschoss einfach nur zu und dachte darüber nach, wie ich meine eigenen Partys schmeißen würde, wenn ich erst alt genug wäre. Ich malte mir aus, dass ich das ganze Geld für mich allein behalten und sogar noch mehr Geld als meine Tanten verdienen könnte, weil sie ja durch vier teilen mussten.
Ich muss ungefähr sieben gewesen sein, als mich meine Mutter einmal für einen Tag mit zu sich nahm, während sie ihren Geschäften nachging. Sie hatte eine Wohnung im Dachgeschoss eines Ladengeschäfts direkt an der Old South Road, genau gegenüber vom Baisley Pond Park. Es war das erste Mal, dass ich wirklich sah, wie sie mit Drogen handelte. Ich hatte es mir angesichts der Sachen, die sie mir schenkte, zwar bereits gedacht, aber ich hatte sie noch nie bei der Arbeit gesehen. Alle Leute, die bei ihr vorbeischauten, waren entweder Kunden oder Dealer. Ich brauchte nicht lange, um sagen zu können, wer zu welcher Kategorie gehörte. Die Dealer waren meistens ältere Männer, die schöne, große Autos wie einen Cadillac DeVille oder einen Fleetwood Brougham fuhren, mit rechteckigen Kühlergrills zwischen den glänzenden, metallenen Kotflügeln, die bis hinunter zu den Weißwandreifen blitzblank waren – oder einen Pontiac Bonneville, innen mit so viel Plüsch ausgekleidet, dass es aussah, als würde sein Besitzer im Inneren eines Kissens spazieren fahren. Die Dealer waren immer schick, von den gestärkten Kragen bis zu den frisch gebügelten Hosen. Sie fuhren heran und hüpften mit perfekt frisiertem Haar aus ihren glänzenden Autos. Ihre Kleider leuchteten förmlich, und ihr Schmuck glitzerte. Die Kunden waren die Typen, die auf sie zukamen; meistens zu Fuß.
Ich war verblüfft, wie meine Mutter mit den Typen mit den großen Autos redete. Sie behandelten sie, als wäre sie ihnen ebenbürtig. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Wenn sie sie sahen, dann machten sie ihr Komplimente und sprachen in einem Code, den ich nicht ganz verstand. Dann gaben sie ihr eine braune Plastiktüte, und sie gab ihnen ein dickes Geldbündel. Als ich ins Haus meiner Großmutter zurückkehrte, erzählte ich meinen Onkeln davon. Die lachten nur und sagten mir, dass es die Typen auf der South Road richtig draufhatten. „Hier gibt’s auch ein paar Jungs, die es draufhaben“, sagten sie, „aber nicht so wie die auf der South Road. Da drüben haben sie es richtig drauf.“
Onkel Harold erzählte mir von einem Mann namens Big Tony, der nicht allzu weit von unserem Haus entfernt lebte und der es auch draufhatte. Er sagte, dass Big Tony so dick im Geschäft sei, dass die Leute aufgehört hätten, ihn Big Tony zu rufen, und ihn mittlerweile eigentlich alle nur noch den Paten nannten. Ich war ganz außer mir. Was ich an der South Road gesehen hatte, war etwas vollkommen anderes als alles, was ich auf unserer Seite des Parks je gesehen hatte. Aber als mir Harold erzählte, dass der Pate der Typ war, der in einem großen grünen Lincoln Continental herumfuhr und allen ein Eis kaufte, wenn der Wagen vorbeikam, wusste ich, von wem er sprach. Harold muss gemerkt haben, wie beeindruckt ich war, denn er sagte: „Keine Angst, wenn ich erst mal Kasse mache, dann werde ich mich ganz sicher um meinen kleinen Neffen kümmern.“
Ich war immer noch nicht hundertprozentig sicher, was genau es war, das man draufhaben musste und das alle haben wollten, aber ich wollte es mehr, als Partys im Hinterhof zu schmeißen oder mit meinen Soldaten zu spielen. Je mehr Zeit ich an der South Road verbrachte, desto deutlicher wurde meine Vorstellung davon, was es bedeutete, es draufzuhaben. Es bedeutete, dass man an jedem Abend der Woche lange aufbleiben konnte. Ich wusste, dass die Leute, die es nicht draufhatten, früh ins Bett mussten, damit sie zur Arbeit verschwinden konnten. Als mich meine Mama dann mit ihrem neuen Auto abholte – einem schwarzen Buick Regal mit einem weißen Vinyltop – war ich mir ganz sicher, dass es nur einen Weg gab: Man musste es eben draufhaben.
Trotz alledem verbrachte ich nie gern die Nacht im Haus meiner Mutter. Es war nett dort, aber die ganze Umgebung war so anders, und ich fühlte mich einsam. Als sie ein Haus draußen auf Long Island mietete, wurde es noch schlimmer. Es war friedlicher dort, aber genau da lag das Problem. Ich hatte mich an die Dauerparty im Haus meiner Großmutter gewöhnt. Meine Onkel und Tanten waren vielleicht nicht der beste Einfluss der Welt, aber zumindest konnte ich immer meine Nase in irgendjemandes Angelegenheiten stecken. Wenn ich im Haus meiner Großmutter auf der Couch einschlief, war immer jemand da, der gerade telefonierte oder fernsah. Das Haus meiner Mutter war so einsam, dass mir die Stille Unbehagen bereitete. Als ich eine Weile dort war, sagte ich schließlich: „Ich will nachhause. Bring mich zurück zu Großmutter.“ Und das tat sie.
Nachdem sie nach Long Island gezogen war, wurden die Besuche meiner Mutter so sporadisch, dass ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern kann, wann ich sie zum letzten Mal sah. Die letzte deutliche Erinnerung, die ich an sie habe ist, wie sie bei Tante Karens Hochzeit auftauchte. Es war in dieser kleinen Kirche gleich neben der Tankstelle beim Linden Boulevard. Ich erinnere mich noch, dass meine Mutter mir etwas Geld zusteckte und wir uns gemeinsam fotografieren ließen. Das sind die letzten Bilder, die meine Familie von ihr hat.
***
Bis zum heutigen Tag ist mein Großvater ein Mann geblieben, der seinen Gedanken frei und ohne Angst vor unangenehmen Folgen Ausdruck verleiht. Er möchte niemanden verletzen, aber er sagt rundheraus, was er denkt, ohne vorher zu überlegen, wie seine Worte vielleicht wirken könnten. Er hat neun Kinder großgezogen und für sie nach besten Kräften gesorgt, also war seine Einstellung die: „Es ist mir scheißegal, was wer denkt. Haut doch alle ab. Wem es nicht passt, der kann gern mein Haus verlassen. Das habe ich mir aufgebaut. Ihr Wichser könnt abhauen.“
Mein Großvater ist nicht der Typ, der seine Gefühle offen zeigt. Er schaut einfach immer griesgrämig drein. Wenn man sein Gesicht durch ein starkes Mikroskop betrachten und mit Instrumenten vermessen würde, mit denen man gewöhnlich die Länge von Fliegenflügeln bestimmt, dann könnte man vielleicht sehen, dass sich seine Mundwinkel nach oben ziehen, wenn er sehr, sehr glücklich ist. Wenn er ärgerlich ist, sieht er ganz einfach aus wie immer. Das einzige Mal, dass ich meinen Großvater jemals außerhalb seines gewöhnlichen Gefühlsspektrums gesehen habe, war, als er erfuhr, dass meine Mutter ermordet worden war.
Meinen Großvater weinen zu sehen war, als würde man einen dieser Horrorfilme anschauen, in denen eine Statue oder ein Bild zum Leben erwacht. Es war etwas, das eigentlich nicht passieren konnte. Das war es auch, was mich so fertig machte, noch bevor mir meine Großmutter sagte, dass meine Mutter nicht wiederkäme und ich nun dauerhaft in ihrem Haus wohnen würde. Sie erklärte mir damals nicht genau, was geschehen war. Das musste sie auch nicht. Im Alter von acht Jahren begreift man schon recht gut, was es bedeutet, wenn man hört, dass seine Mutter nicht wiederkommt. Es bedeutete, dass Weihnachten vorbei war.