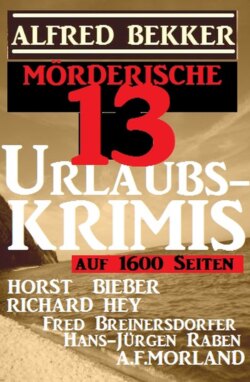Читать книгу Mörderische 13 Urlaubs-Krimis auf 1600 Seiten - A. F. Morland - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine Bombe für den Senator
ОглавлениеHans-Jürgen Raben
––––––––
POLIT-THRILLER MIT dem Geheimagenten Steve McCoy
––––––––
IMPRESSUM
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author
© Cover: Martin Kucera/123 RF mit Steve Mayer, 2018
Lektorat: Kerstin Peschel
© dieser Ausgabe 2018 by Alfred Bekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
postmaster@alfredbekker.de
––––––––
Klappentext:
NACH EINEM BOMBENANSCHLAG auf Senator Joseph Clark, den dieser sehr schwer verletzt überlebt, bedeutet dies das politische Ende des Mannes. Unter Verdacht, den Anschlag verübt oder in Auftrag gegeben zu haben, steht Kevin McLaren, ein potentieller Nachfolger des Senators. Nach einem weiteren Verbrechen sprechen alle Indizien gegen ihn, und er wird verhaftet.
Wegen der politischen Brisanz, die dieser Fall mit sich bringt, bekommt Steve McCoy, der Geheimagent und Spezialist für besonders heikle Angelegenheiten, den Auftrag, Licht in die ganze Sache zu bringen und stößt dabei auf Dinge und Menschen, die auch für ihn das Ende bedeuten können. Plötzlich wird er selber vom Jäger zum Gejagten. Und für einen Moment sieht er in Augen, die nur den Tod versprechen, Augen, die nicht lächeln können. In denen die kalte Erbarmungslosigkeit eines menschlichen Raubtiers liegt, das Menschen wie Ungeziefer auslöscht und dabei keine Gnade kennt. Kann Steve McCoy diesem Monster in Menschengestalt Einhalt gebieten?
***
1.
NEW YORK, UPPER EAST Side, September 1984
Der schlanke hochgewachsene Mann hatte sich seit einer halben Stunde nicht von der Stelle gerührt. Er stand am Fenster eines leeren Zimmers in einer verlassenen Wohnung im südlichen Manhattan und starrte durch ein Fernglas hinunter auf die Straße.
Vor ihm auf dem Fensterbrett stand ein kleiner schwarzer Kasten aus Metall. An dessen Oberseite befanden sich mehrere Knöpfe und eine dünne Antenne, die leicht hin und her schwankte. Neben dem Mann lehnte ein Gewehr an der kahlen Mauer.
Plötzlich ging ein Ruck durch die schlanke Gestalt. Die Hände in den schwarzen Lederhandschuhen krampften sich fester um das Fernglas.
Der Gegenstand, den der Mann so angestrengt betrachtete, war ein dunkelgrüner Lincoln, der seit geraumer Zeit auf der anderen Straßenseite parkte. Hinter den getönten Scheiben war die Gestalt des Chauffeurs zu erkennen. Die Limousine war ein Dienstwagen, und sie gehörte Senator Joseph Clark, der in diesem Augenblick aus dem Haus kam und auf den Wagen zuging.
Der Chauffeur sprang heraus, flitzte um den Wagen und riss die hintere Tür auf. Der Senator stieg schwerfällig ein, und mit einem dumpfen Geräusch schloss sich die Tür.
Der Mann am Fenster löste seine rechte Hand vom Fernglas und führte sie langsam zu dem Metallkasten, bis die ausgestreckten Finger über den Knöpfen schwebten. Dann hielt er wieder inne und wartete auf das Geräusch des anspringenden Motors.
Mit einer raschen Bewegung drückte er auf den roten Knopf.
Der Donner der Explosion erschütterte die ruhige Straße. Irgendwo klirrten Fensterscheiben. Der Lincoln wurde wie von einer Riesenfaust gepackt und fast einen halben Meter in die Luft geschleudert.
Splitterndes Glas, das ohrenbetäubende Kreischen des Metalls und ein lauter Schmerzensschrei zerrissen die Stille. Langsam kippte der Wagen zur Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.
Eine grelle orangerote Flamme schoss unter der Motorhaube hervor, und augenblicklich erfüllte beißender Gestank die Luft. Eine dunkle Rauchwolke wälzte sich über die Straße. Von allen Seiten liefen Leute auf den Wagen zu. Hilfreiche Hände zerrten die Insassen nach draußen.
Der Mann am Fenster musterte sein Werk mit der kühlen Sachlichkeit eines Chirurgen. Er warf einen raschen Seitenblick zu seinem Gewehr. Er würde es heute nicht mehr brauchen. Die paar Pfund Sprengstoff hatten ihren Zweck erfüllt. Der Wagen war nur noch ein Schrotthaufen, und Senator Joseph Clark würde in der nächsten Zeit nicht sehr aktiv sein können.
Er warf einen letzten Blick auf die verkrümmte blutüberströmte Gestalt. Der Senator lebte noch, aber er war mit Sicherheit schwer verletzt.
Ob der Chauffeur noch lebte, war nicht zu erkennen. Aber das war dem Mann mit den schwarzen Handschuhen völlig gleichgültig.
Er verstaute das Glas in dem eleganten Lederkoffer, der hinter ihm stand. Dann schraubte er mit sorgfältigen Bewegungen das Gewehr auseinander, nachdem er es entladen hatte. Die Objektive des Zielfernrohres versah er mit Schutzkappen. Mit seinem Handwerkszeug ging er stets pfleglich um.
Zuletzt verschwand das Gerät, mit dem er die Explosion ausgelöst hatte; in seinem Koffer. Ein letzter prüfender Blick in die Runde – er hatte nichts übersehen. Im Laufe der Zeit Er hatte sich daran gewöhnt, keine Spuren zu hinterlassen, denn das war für ihn lebenswichtig.
Als er die Treppe hinunterstieg, sah er wie ein Handelsvertreter aus. Er nickte einer älteren Frau freundlich zu, die mit schweren Paketen beladen die Treppe hinaufkeuchte.
In der Ferne klangen Sirenen auf.
––––––––
2.
KEVIN MACLAREN LEHNTE am Kamin seiner eleganten Stadtwohnung im südlichen Manhattan an der Park Avenue. In der Hand hielt er ein großes Glas Whisky, aus dem er aber bisher kaum getrunken hatte. Mit einer mechanischen Bewegung schüttelte er die Flüssigkeit. Schließlich nahm er einen winzigen Schluck.
MacLaren war mittelgroß und hatte dunkle, schon leicht schüttere Haare und ein wenig Übergewicht. Er hielt sich mit Golf und Tennis fit, trank wenig und rauchte zu viel. Er war jetzt fünfundvierzig Jahre alt und strebte in seiner politischen Karriere einen Senatorenposten an.
Er blickte zu seiner jüngeren Schwester Barbara hinüber, die in einem tiefen Sessel saß und ihn aufmerksam musterte. Vielleicht auch ein wenig missbilligend, dachte er.
„Wo ist deine Frau?“, fragte Barbara MacLaren plötzlich.
„Joan?“ Er lachte kurz auf. „Sie sagt mir selten, wo sie ist.“
Barbara zog die Augenbrauen zusammen. Sie war unverheiratet geblieben und himmelte ihren älteren Bruder an. Joan, seine Frau, konnte sie nicht ausstehen. Das beruhte allerdings auf Gegenseitigkeit. Die beiden Frauen gingen sich aus dem Weg, wo sie nur konnten, und Kevin MacLaren stand ein wenig ratlos zwischen ihnen. Er liebte seine Frau und versuchte, großzügig über ihre Fehler hinwegzusehen. Aber er schätzte auch seine Schwester. Auf ihre Ratschläge, die ihm schon oft geholfen hatten, hätte er ungern verzichtet.
„Was passiert jetzt nach dem Unfall von Senator Clark?“, erkundigte sich Barbara.
„Es war kein Unfall“, murmelte er. „Sein Wagen wurde von einer Sprengladung zerfetzt. Glücklicherweise hat er den heimtückischen Anschlag überlebt. Sein Chauffeur war sofort tot. Clark liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus. Er ist noch bewusstlos. Die Ärzte sagen, dass er für mindestens acht Wochen unter strengster Aufsicht liegen muss. Und danach werden sie ihn für drei Monate in ein Sanatorium einweisen. Das heißt, Clark kann seinen Abschied vom politischen Leben nehmen. Außerdem ist er zu alt.“
„Und wer wird sein Nachfolger?“ Barbara blieb bei diesem Thema hartnäckig, obwohl sie merkte, dass ihm das unangenehm war.
Kevin zuckte mit den Schultern. „Der Unfall, wie du das nennst, kam für uns alle überraschend. Natürlich arbeite ich seit Jahren darauf hin, Clarks Nachfolger zu werden. Aber ich bin nicht der einzige Kandidat. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie ich mich jetzt verhalten soll.“
Sie beugte sich vor. „Du hast doch nur einen einzigen Konkurrenten für die Nachfolge. Ist es denn so schwer, ihn abzuhängen?“
MacLaren nahm einen kräftigen Schluck von seinem Whisky. „Du meinst John Carruthers? Er kämpft seit fast fünf Jahren gegen mich. Dabei waren wir einmal Freunde! Aber seit Joan damals mich geheiratet hat, hasst er mich. Und jetzt wird er versuchen, mich bei der Bewerbung um den Posten auszuschalten. Ich kenne ihn. Er beherrscht eine Menge schmutziger Tricks, und er wird sie auch anwenden.“
„Aber du kannst doch nicht aufgeben, nur weil du einen Gegner hast, der ernst zu nehmen ist!“
„Wer spricht von aufgeben? Es ist nur die Frage, ob ich überhaupt noch will! Seit dem Attentat auf den Senator bin ich mir nicht sicher, ob diese Karriere erstrebenswert ist.“
Barbara kam auf ihn zu und legte ihm eine Hand auf den Arm. Ihre Stimme klang sanft und leise. „Seit Jahren hast du nur dieses Ziel. Und jetzt zuckst du zurück. Es gab nie eine so günstige Gelegenheit! Der Posten, den du haben willst, muss neu besetzt werden. Das ist doch eine einmalige Chance!“
MacLaren stellte sein Glas hart ab. „Es passt mir nicht, auf diese Weise mein Ziel zu erreichen. Ich wollte regulärer Nachfolger von Senator Clark werden – und er hätte mich auch dazu gemacht. Aber dieser Anschlag hat alles über den Haufen geworfen.“
„Hat man schon eine Ahnung, wer dahintersteckt?“
„Bis jetzt gibt es keine Spur. Man hat nur einige verformte Reste der Sprengladung und des Zünders gefunden. Wie ich aus dem Polizeihauptquartier erfahren habe, hat man aber noch keine Anhaltspunkte.“
Barbara ging zum Fenster hinüber.
„Ich meine, du solltest dich nicht von diesen Dingen beeinflussen lassen. Du hast jetzt deine Chance, und du musst kämpfen. Denk noch einmal darüber nach.“
MacLaren klammerte die Hand um sein Whiskyglas und starrte auf die bernsteingelbe Flüssigkeit.
„Hoffentlich habe ich den Kampf nicht schon verloren, bevor er begonnen hat.“
––––––––
3.
POLIZEI-SERGEANT MASTERS schüttelte fassungslos den Kopf. Vor ihm lag ein aufgeschlagener Aktenordner mit einem Bericht aus dem Labor.
„Lieutenant! Kommen Sie doch bitte mal herüber!“, rief er.
Sein Vorgesetzter, Lieutenant Anderson, walzte seine zweihundertzwanzig Pfund Lebendgewicht an den Schreibtisch heran.
„Was gibt’s?“, knurrte er ungnädig.
„Sehen Sie sich das an!“, sagte Masters aufgeregt. „Das Labor hat Fingerabdrücke identifizieren können. Die Funkzündung, die Senator Clarks Wagen hochgehen ließ, besteht aus Teilen einer Fernsteuerungsanlage für ein Modellflugzeug. Und daran waren deutlich Fingerabdrücke zu erkennen.“
„Na, und? Weiß man auch, wem sie gehören?“
„Das ist es ja! Sie gehören zweifelsfrei Kevin MacLaren. Das ist einer der Vertrauten des Senators. Vielleicht wird er sogar sein Nachfolger.“
„Ja, ich weiß. Ich habe ihn schließlich selbst verhört, und das ist erst ein paar Stunden her. Woher wissen die Jungs denn so genau, dass es sich um seine Abdrücke handelt? Wir haben ihm doch keine abgenommen.“
Masters fuhr mit dem Finger über den Bericht. „Er war bei der Armee. Und in den Militärakten werden alle Abdrücke gespeichert.“
Anderson nagte an seiner Unterlippe. Seine Augen waren halb geschlossen, und er machte einen schläfrigen Eindruck. Langsam schüttelte er den Kopf.
„Das passt nicht zusammen. Aber wenn sich das bestätigt, werden wir der Sache wohl nachgehen müssen. Suchen Sie alle Unterlagen heraus, die wir in unseren Archiven über diesen MacLaren haben. Erkundigen Sie sich auch beim FBI und beschaffen Sie seine Militärakte.“
Masters blickte erstaunt auf. „Wollen wir ihn nicht gleich verhaften? Die Fingerabdrücke sind doch ein klarer Beweis. Und ein Motiv hat er auch, wenn er Nachfolger des Senators werden will.“
Anderson blinzelte. „Dass man euch auf der Polizeischule das Nachdenken nicht beibringt, ist bedauerlich. Sergeant Masters, dies kann ein politischer Fall werden, und daran kann man sich verdammt leicht die Finger verbrennen. Sie können nicht einfach hingehen und MacLaren verhaften. Entweder müssen die Beweise so hieb- und stichfest sein, dass wir keine andere Wahl haben, oder wir riskieren einen Skandal ersten Ranges. Die Presse zerreißt uns in der Luft.“
„Aber Fingerabdrücke sind doch klare Beweise“, wandte Masters ein.
„Wissen Sie so genau, wo Sie Ihre Fingerabdrücke überall gelassen haben, Sergeant?“ Anderson legte die Stirn in Falten. „Das reicht mir nicht. Ich will erst alles wissen, was man über den Mann wissen kann.“
„Na gut.“ Masters zuckte mit den Schultern. Sie müssen wissen, was Sie tun. Soll ich MacLaren überwachen lassen?“
Anderson schüttelte wieder den Kopf. „Das ist nicht nötig. Er wird weder fliehen noch sich sonst verdächtig machen. Dazu wäre er viel zu schlau. Eine Überwachung können wir uns sparen.“
„Aber so schlau kann er nicht sein, wenn er seine Fingerabdrücke an Beweisstücken hinterlässt.“
Anderson lächelte. „Eben. Das ist es ja, was mich so stört. Denken Sie mal darüber nach.“
Sergeant Masters klappte den Ordner zu. Der Lieutenant hielt offenbar nicht viel vom raschen Zugreifen. Dabei wusste doch jedes Kind, dass man Verdächtige beschatten musste.
––––––––
4.
DER SCHLANKE, HOCHGEWACHSENE Mann mit den schwarzen Handschuhen und der Sonnenbrille saß auf dem Rücksitz eines Dodge. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und scharf geschnittene Gesichtszüge. Ein gepunkteter Schal war um seinen Hals geschlungen, und ein weicher Hut verdeckte seine Stirn.
Auf den Knien lag ein schwarzer Diplomatenkoffer mit einem Zahlenschloss. Er starrte auf die Hinterköpfe der beiden Männer, die vor ihm auf den Vordersitzen saßen. Niemand sprach ein Wort.
Harvey Atkins und Bill Ellison fühlten sich immer ein wenig unbehaglich, wenn sie ihren Auftraggeber in der Nähe wussten. Der schlanke Mann strahlte Kälte aus und sagte wenig. Sie wussten, in welchem Geschäft er tätig war, aber da er sie für ihre Handlangerdienste gut bezahlte, störte es sie nicht weiter.
Sie waren Schlägertypen, die nicht clever genug waren, selber einen Coup zu landen. Wenn sie es versuchten, ging es unweigerlich schief. Und sie hatten es schon mehrfach versucht. Nach jedem Unternehmen waren sie im Gefängnis gelandet, bevor sie einen Dollar der Beute ausgeben konnten. Daher hatten sie eines Tages beschlossen, nur noch Auftragsdienste zu erledigen. Sie brauchten jemand, der für sie dachte.
Und genau das tat ihr Boss. Sie konnten sich nicht beklagen. Noch nie war ihr Risiko so gering gewesen.
Atkins, der am Steuer saß, warf einen flüchtigen Blick in den Rückspiegel. Für Sekundenbruchteile blickte er in die kalten Augen, und er bemühte sich, seine Furcht zu unterdrücken.
Rasch wandte er den Blick ab und blickte wieder zum Eingang des modernen Appartementhauses hinüber, den sie seit einer halben Stunde beobachteten. Dort herrschte reges Kommen und Gehen, aber das Wild, das sie erwarteten, war noch nicht aufgetaucht. Sie wussten nur, dass sie auf eine Frau warteten, die sie verfolgen sollten.
Ellison reinigte sich mit einer schmalen Messerklinge die Fingernägel. Seine Einstellung zu den Dingen des Lebens war sehr unkompliziert. Er machte sich nicht viel Gedanken. Sein Boss hatte ihm gesagt, was zu tun war, und so tat er es, ohne darüber nachzudenken.
Atkins blickte leicht irritiert auf die Klinge, die gewöhnlich in Ellisons Ärmel steckte. Er konnte sehr gut mit der Waffe umgehen. Als sie sich eine Zeit lang als Zuhälter versucht hatten, hatte das Messer als Instrument der Überredung gute Dienste geleistet. Atkins erinnerte sich an manch blutiges Gesicht, das Ellison mit Schnittwunden verunziert hatte.
„Da ist sie!“
Die Stimme klang scharf wie ein Peitschenhieb, und die beiden auf den Vordersitzen zuckten zusammen. Blitzschnell verschwand das Messer in Ellisons Ärmel. Atkins schluckte und fuhr sich mit der Zunge über die Mundwinkel.
Er folgte mit seinem Blick dem ausgestreckten Arm und nickte. Sie sah genauso aus, wie sie der Boss beschrieben hatte. Vielleicht noch hübscher!
Barbara MacLaren kam aus der Wohnung ihres Bruders und wollte nach Hause fahren. Sie besaß eine eigene kleine Wohnung auf der anderen Seite des East River. Mit schnellen Schritten ging sie zu einem Taxistand, der etwa hundert Meter entfernt war.
„Sie will zum Taxistand“, stellte Harvey Atkins fest und drehte sich halb herum.
Der Mann auf dem Rücksitz antwortete nicht. Er schien nachzudenken und strich mit den Händen sanft über seinen Koffer.
Bill Ellison holte ein Päckchen Kaugummi aus seiner Tasche und schob sich gleich zwei der dünnen Streifen in den Mund. Befriedigt mahlte er darauf herum.
„Tatsächlich, sie geht zu den Taxis“, meinte er.
Atkins knurrte unwillig. „Das habe ich ja eben gesagt. Sollen wir ihr nachfahren?“, fragte er über die Schulter.
„Natürlich!“ Die Stimme klang jetzt sanft, und sie vibrierte vor innerer Spannung. „Ich will, dass die Frau in jeder Minute beschattet wird. Ich muss wissen, was sie tut und wann sie es tut. Ich treffe euch morgen zur selben Zeit am üblichen Treffpunkt.“
Der Mann drückte die Tür auf und verschwand geräuschlos aus dem Wagen. Atkins dachte an eine Katze – oder eine Schlange. Sie sahen ihm nicht nach, denn das hatte er ihnen ausdrücklich verboten. Als er ihnen den ersten Auftrag gegeben hatte, waren sie ihm nachgegangen. Aber er hatte auf sie gewartet und sie mit wenigen präzisen Schlägen, die höllisch schmerzten, zu Boden geschickt.
„Wenn ihr das noch mal versucht, bekommt ihr eine Kugel verpasst“, hatte er dann ohne jede Emotion gesagt und war gegangen.
Atkins ließ den Motor an und legte den ersten Gang ein. Im Rückspiegel beobachtete er die Straße. Als sie frei war, wendete er und hielt auf der anderen Seite wieder an. Barbara MacLaren stieg gerade in ein Yellow Cab.
„Dann wollen wir uns mal dranhängen“, meinte Atkins. Der Dodge rollte langsam vorwärts.
Ellison spuckte den Kaugummi aus dem Seitenfenster und schob sich gleich einen Neuen in den Mund.
„Sabato!“, murmelte er. „Hat er eigentlich auch einen Vornamen?“ Atkins wandte flüchtig den Kopf, während er das Taxi im Auge behielt.
„Unser Boss? Ich kenne nur diesen Namen. Und kein Mensch weiß, ob das ein Vorname oder ein Familienname ist. Und vor allen Dingen: Ich will es gar nicht wissen.“
„Aber ein merkwürdiger Name ist es doch“, sagte Ellison. „Es klingt nach Mexiko. Dabei sieht er nicht aus wie ein Mexikaner.“
„Jetzt halt mal die Luft an. Dieser Name klingt auch nach Tod. Und darüber will ich nicht reden.“
„Ist ja schon gut. Pass lieber auf, dass du das Taxi nicht verlierst!“
„Den gibt’s nicht, der mich abhängt“, murmelte Atkins und gab Gas.
Der Mann, der sich Sabato nannte, hatte dem Dodge aus schmalen Augenschlitzen noch ein paar Sekunden nachgeblickt. Nun ging er in entgegengesetzter Richtung weiter. Er trat in eine Telefonzelle und wählte eine Nummer in Manhattan. Als sich der Teilnehmer meldete, sagte er nur: „Sie wissen, dass der erste Teil erledigt ist. Die nächste Zahlung ist fällig. Ich erwarte den Betrag heute Abend an der vereinbarten Stelle.“
Er wartete nicht auf die Antwort seines Gesprächspartners, sondern legte abrupt auf und verließ die Telefonzelle. Er hielt sich nicht gerne lange an einem Ort auf.
––––––––
5.
JOAN MACLAREN RAUCHTE hastig eine Zigarette und drückte die Kippe mit einer fahrigen Bewegung im Aschenbecher aus. Der Mann, der ihr gegenübersaß, lächelte amüsiert.
„Bist du nervös? Wartet dein Mann auf dich? Es ist schon spät. Vielleicht solltest du jetzt besser gehen.“
„Behandle mich nicht immer wie ein Kind, John. Du weißt genau, weshalb ich nervös bin. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“
Sie blickte John Carruthers fragend an. Er sah gut aus und war im gleichen Alter wie ihr Mann, wirkte aber jünger. Er tat auch mehr für seine Gesundheit und war weitaus ehrgeiziger.
Joan hatte sich schon oft gefragt, warum sie damals eigentlich MacLaren geheiratet hatte. Aber sie kannte die Antwort. Damals sah es so aus, als würde Kevin schneller Karriere machen. Aber er war ein Schwächling, nicht hart genug für das Geschäft eines Politikers.
John Carruthers war ein ganz anderes Kaliber. Er hatte keine Hemmungen und beherrschte perfekt den intrigenreichen Tanz um die Macht. Wer weiß, vielleicht würde er eines Tages noch ins Weiße Haus einziehen. Deshalb hatte sie die Beziehungen zu ihm auch nie abgebrochen. Sie wusste, dass Carruthers sie nach wie vor begehrte. Es würde sein größter Triumph sein, wenn er seinem Rivalen auch noch die Frau ausspannen konnte.
Sie zündete sich eine neue Zigarette an und sagte: „Einer von euch beiden wird Clarks Nachfolger werden. Ich möchte wissen, wer es sein wird. Dann erst kann ich mich entscheiden.“
Carruthers lächelte. „Dein Mann hat keine Chance, glaube mir. Ich habe die besseren Karten. Mach Schluss mit ihm und komm zu mir. Hier liegt die Zukunft.“
Sie schüttelte den Kopf. „Das ist nicht so einfach. Gib mir noch ein paar Tage Zeit. Ich muss darüber nachdenken.“
„Aber nicht zu lange. Ich weiß nicht, was du noch bei ihm willst. Er wird den Zweikampf mit mir verlieren, das steht fest. Damit ist seine politische Karriere beendet. Über viel Kapital verfügt er auch nicht. Das Vermögen gehört seiner Schwester, und die ist geizig. Sie wird ihn finanziell nicht unterstützen. Und bis er an dieses Vermögen herankommt, bist du alt und grau.“
Joan zitterte. „Warum sagst du mir das alles? Ich weiß es ja selbst. Aber ich kann mich trotzdem nicht so schnell entscheiden.“
„Was macht Delmonte?“, wechselte er plötzlich das Thema.
„Sein Assistent? Er ist hinter dem Geld her, und ein bisschen auch hinter mir. Er wird keinen Erfolg haben. Dafür ist er nicht der richtige Typ.“
„Man kann einen Menschen nicht so schnell beurteilen“, sagte er leise und hob sein Glas. „Cheers, mein Liebling!“
––––––––
6.
DER SCHLANKE HOCHGEWACHSENE Mann streifte sich die schwarzen Handschuhe sorgfältig über die Finger, bevor er die gläserne Schwingtür aufstieß.
Der Mann, den man Sabato nannte, sah sich aufmerksam in der Halle des Apartmenthauses um. Der Portier war nicht da. Durch einen fingierten Anruf war er für einige Minuten weggelockt worden.
Mit raschen Schritten ging Sabato auf den Lift zu. Die Tür des Mittleren stand auf. Er ging hinein und drückte auf den Knopf für das achtzehnte Stockwerk. Mit sanftem Surren setzte sich der Lift in Bewegung. Ohne Halt erreichte er sein Ziel. Sabato stieg aus und ging zwei Stockwerke zu Fuß wieder hinunter.
Auf solche Kleinigkeiten legte er großen Wert. Sollte der Portier wieder in der Halle sein, würde er nur feststellen können, dass jemand ins achtzehnte Stockwerk gefahren war.
Aber sein Ziel lag im Sechzehnten.
Sabato hätte sein Ziel auch im Dunkeln gefunden. Er warf einen Blick auf seine teure Armbanduhr. Es war zehn Minuten nach Mitternacht. Sein Zeitplan stimmte auf die Minute. Der breite Korridor wurde von indirektem Licht nur schwach erleuchtet.
Vor einer Tür blieb er stehen. Mit einer gemessenen Bewegung zog er einen Schlüssel aus der rechten Manteltasche. Er schob ihn lautlos in das Sicherheitsschloss und öffnete die Tür.
In der Wohnung war es dunkel. Er wartete einen Augenblick, bis sich seine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Sein Atem ging ruhig. Er wandte den Kopf und orientierte sich. Links lag eine kleine Küche, dahinter ein winziges Gästezimmer. So hatte man es ihm jedenfalls beschrieben.
Vorn lag ein geräumiges Wohnzimmer mit einem Balkon. Auf der rechten Seite befanden sich Bad und Schlafzimmer. Dort lag sein Ziel. Er machte noch einige Schritte und legte sein Ohr an die Tür. Schwache Geräusche verrieten, dass dort jemand schlief.
Er drückte die Tür zum Wohnzimmer lautlos auf, sodass mehr Licht in den Flur fiel. Dann zog er aus seiner linken Manteltasche einen schweren Gegenstand, der in ein Tuch gewickelt war. Vorsichtig ließ er ihn in seine Hand gleiten. Es war eine Armeepistole.
Er griff wieder in die Tasche, holte einen röhrenförmigen Gegenstand heraus und schraubte ihn auf den Lauf der Pistole. Mit einem festen Griff prüfte er den Sitz des Schalldämpfers.
Ganz langsam spannte er die Waffe, bis die erste Patrone in die Kammer glitt. Er schob den Sicherungshebel zurück, und die Pistole war schussbereit. Er nahm sie in die linke Hand und drückte mit der Rechten die Klinke der Schlafzimmertür herunter. Auch diese Tür ließ sich geräuschlos öffnen.
Deutlich hörte er die flachen Atemzüge eines schlafenden Menschen. Sacht tastete seine Hand zum Lichtschalter. Er konnte nichts sehen. Nur die Geräusche verrieten, wo sich das Bett befand.
Er schloss die Augen zu schmalen Schlitzen und drückte auf den Schalter. Eine Deckenleuchte flammte auf und tauchte das Schlafzimmer in helles Licht. Mit zwei, drei schnellen Schritten stand er vor dem breiten französischen Bett und riss die Decke zur Seite.
Er hatte keinen Blick für den halb entblößten Frauenkörper, sondern suchte nur sein Ziel. Mit einer fließenden Bewegung setzte er die Waffe genau auf das Herz der Frau, die schlaftrunken hochfuhr und nicht begriff, was mit ihr geschah.
Dreimal drückte er ab, und jedes Mal klang es wie ein dumpfer Schlag aus weiter Ferne. Der Körper der Frau bäumte sich auf und sackte haltlos zusammen. Aus ihrem Mund kam ein gurgelndes Geräusch. Dann herrschte wieder Stille. Aus Nase und Mund flossen dünne Blutfäden. Das Laken färbte sich langsam rot. Er kannte die Wirkung der Waffe aus dieser Entfernung und brauchte die Frau deshalb nicht herumzudrehen, um zu sehen, wo die Kugeln ausgetreten waren.
Barbara MacLaren war tot. Und sie hatte nicht einmal mitbekommen, dass sie sterben sollte.
Sabato schraubte den Schalldämpfer ab und ließ ihn in die Tasche gleiten. Anschließend legte er die Waffe auf den Teppich und kickte sie mit dem Fuß weit unter das Bett. Er zog die Decke über die Tote, löschte das Licht und verließ das Zimmer.
Er blickte wieder auf die Uhr. Der Zeitplan stimmte immer noch. Diesmal ging er zu Fuß drei Stockwerke tiefer und ließ einen Lift kommen. Als er in die Halle trat, nickte er befriedigt. Vom Portier war noch nichts zu sehen.
Sabato trat in die Nacht hinaus und ging mit schnellen Schritten die Straße hinunter, bis er seinen dort geparkten Wagen erreichte.
Erst als er eingestiegen war, zog er die Handschuhe aus.
––––––––
7.
STEVE MCCOY WAR IN die Betrachtung seiner neuen Schreibtischlampe versunken, die er sich am Vormittag in einem sündhaft teuren Geschäft an der Madison Avenue gekauft hatte. Schließlich nickte er befriedigt. Die Lampe passte zu der übrigen modernen Einrichtung.
Auf der Madison Avenue war es so laut gewesen, dass er nur ein paar Dinge gekauft und dann den Rückweg nach Brooklyn angetreten hatte. In seinem Haus, das er von seinen inzwischen verstorbenen Eltern geerbt hatte, fühlte er sich wohl. Wenn er paar Tage frei hatte, wie jetzt nach einem anstrengenden Job, kehrte er gern dorthin zurück.
Sein Arbeitgeber war das Department of Social Research in Washington, die Tarnbezeichnung einer geheimen Abteilung des Justizministeriums, die sich mit dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen befasste. Dessen Feldagenten wie Steve McCoy auch arbeiteten meistens unter einer Tarnidentität, und sie besaßen zusätzlich einen größeren Handlungsspielraum als beispielsweise die Kollegen vom FBI.
Das Telefon klingelte. Er ließ es klingeln, doch als der Anrufer nicht aufgab, nahm er seufzend den Hörer auf. Er ahnte, dass dieser Griff zum Telefon eine Menge Unannehmlichkeiten bringen würde. Aber das war nun mal sein Beruf.
„Hier McCoy“, meldete er sich.
„Greene“, kam es kurz und knapp aus dem Hörer.
Steves Aufmerksamkeit war sofort geweckt. Colonel Alec Greene war Chef des Departments und damit sein Boss. Wenn er an einem seiner freien Tage anrief, konnte es sich nur um etwas Schwerwiegendes handeln. „Ich höre!“
„Es tut mir leid, dass ich Sie ausgerechnet heute stören muss, doch ich bin in New York. Wir treffen uns in einer Stunde in dem Restaurant am Bryant Park. Wir haben uns dort schon einmal getroffen.“
Er hatte aufgelegt, bevor Steve reagieren konnte. Und Leid tut es dir ganz bestimmt nicht!, dachte Steve.
Er brauchte mit dem Taxi eine knappe Stunde bis zu ihrem Treffpunkt. Das Restaurant befand sich am Ende des Bryant Park, direkt hinter dem Prachtbau der Bibliothek. Sein Boss war schon da. Steve erkannte von Weitem die breitschultrige Gestalt mit den eisengrauen Haaren. Und er war nicht allein!
„Nehmen Sie Platz, Steve.“ Der Colonel deutete auf seinen Gast. „Das ist Dr. Highwood, ein recht bekannter Anwalt in dieser Stadt. Er vertritt Kevin MacLaren, und der wiederum hat uns über das Justizministerium gebeten, seinen Fall zu untersuchen.
„Seinen Fall?“, fragte Steve mit hochgezogenen Augenbrauen.
Alec Greene nickte. „Er gilt als Nachfolger von Senator Clark und ist gestern verhaftet worden. Warum, wird Ihnen Dr. Highwood gleich erläutern. Der Fall ist jedenfalls politisch brisant und kann hohe Wellen schlagen. Man hat uns um Hilfe gebeten, da bei uns keine Informationen an die Medien durchsickern, die schon wie die Mücken um das Licht kreisen.“
Der Colonel winkte einen Kellner heran, und sie bestellten Kaffee.
Der Anwalt räusperte sich und begann: „Mein Name ist Highwood, und ich vertrete einen Klienten, der in einer bösen Klemme steckt.“
Steve betrachtete den Anwalt aufmerksam. Für seine Größe hatte Highwood eine Spur zu viel Fett angesetzt. Er sah nicht so aus, als sei er ein Anhänger von viel Bewegung an frischer Luft. Auch sein schwarzes dichtes Haar war für einen Anwalt etwas zu lang. Sein Blick hinter der dicken Hornbrille jedoch war scharf und durchdringend. Ein Mann, den man nicht unterschätzen durfte.
Steve lehnte sich zurück. „Erzählen Sie mir ihre Geschichte – oder den Fall, wenn es überhaupt ein Fall ist.“
Dr. Highwood lächelte schwach. „Ein Fall wird es ganz bestimmt. Ein Teil davon steht schon in der Zeitung.“
Er griff in seine Brusttasche und zog eine zerdrückte Zeitung hervor. „Die ist von heute Morgen. Lesen Sie selbst!“
Steve griff nach dem Blatt, das der Anwalt ihm hinhielt. Er las die klotzige Überschrift:
„Politiker unter Mordverdacht verhaftet!“
Rasch überflog er den Text:
„Unter dem dringenden Verdacht, seine Schwester ermordet zu haben, ist gestern der Politiker Kevin MacLaren verhaftet worden. MacLaren ist einer der Anwärter auf den Posten von Senator Clark, der vor wenigen Tagen bei einem Sprengstoffanschlag schwer verletzt wurde und sich seitdem im Krankenhaus befindet. Wie die Polizei mitteilt, gibt es Hinweise darauf, dass MacLaren an diesem Attentat beteiligt war. Auf dem elektrischen Zünder wurden seine Fingerabdrücke gefunden. Gestern Morgen wurde seine Schwester Barbara MacLaren tot aufgefunden. Sie wurde durch drei Schüsse aus unmittelbarer Nähe getötet. Die Tatwaffe, eine Armeepistole, lag unter dem Bett. Sie gehört ihrem Bruder, dessen Fingerabdrücke ebenfalls auf der Waffe sichergestellt wurden.
Der Verhaftete bestreitet in beiden Fällen energisch seine Schuld. Die Ermittlungen dauern an. Es wird erwartet, dass der Beschuldigte nur gegen eine sehr hohe Kaution auf freien Fuß gesetzt wird.“
Steve ließ das Blatt sinken.
„Kevin MacLaren“, murmelte er.
„Richtig.“ Der Anwalt nickte bekräftigend. „Die Sache sieht sehr mies aus, noch schlimmer, als aus diesen paar Zeilen hervorgeht. Es gibt für beide Fälle ein handfestes Motiv, und mein Mandant hat in beiden Fällen kein Alibi.“
„Reden Sie weiter. Das scheint in der Tat ein interessanter Fall zu sein“. Steve McCoy beugte sich vor. „Ich nehme an, dass Polizei und FBI ebenfalls ermitteln. Gibt es dort schon Erkenntnisse, die nicht in der Zeitung stehen?“
Der Anwalt hob die Schultern. „Das weiß ich nicht. Mein Klient hatte nur einen erlaubten Anruf, und er bat mich, das Justizministerium einzuschalten. Das habe ich getan, und wenig später hat mich Colonel Greene angerufen. Wir haben ein Treffen verabredet, und jetzt sitzen wir gemeinsam hier. Mit der Polizei habe ich noch nicht gesprochen.“
„Zu diesem Zeitpunkt gibt es eigentlich nur eine wichtige Frage“, mischte sich der Colonel ein. „Hat MacLaren die beiden Verbrechen begangen oder nicht? Die bisher vorliegenden Beweise sprechen nicht gerade für ihn.“
Highwood blickte ihn ernst an. „Ich kenne ihn sehr gut, und ich bin der festen Überzeugung, dass er es nicht getan hat.“
„Wann kann ich mit ihm reden?“, fragte Steve.
Highwood zuckte mit den Schultern. „Wann Sie wollen. Heute noch! Ich habe im Untersuchungsgefängnis jederzeit Zutritt. Außerdem will ich versuchen, ihn gegen Kaution freizukriegen. Vielleicht gelingt es mir, den Richter davon zu überzeugen, dass bei ihm keine Fluchtgefahr besteht.“
„Wieso können Sie so sicher sein, dass MacLaren die ihm zur Last gelegten Verbrechen nicht begangen hat?“
„Finden Sie es heraus. Mir scheint, dass man eine teuflische Falle aufgebaut hat, in die er ahnungslos hineingelaufen ist. Sie werden schon dahinterkommen, was ich damit meine.“
Steve sah den Anwalt nachdenklich an. „Sie sind sich Ihrer Sache ziemlich sicher, wie?“
„Allerdings.“
„Dann werden wir Ihren Mandanten gleich besuchen.“
„Ich danke Ihnen.“
––––––––
8.
NICHOLAS DELMONTE SAß in dem bequemen Drehsessel hinter dem Schreibtisch seines Arbeitgebers. Irgendwann, vielleicht schon sehr bald, würde er auch in so einem Sessel sitzen können. Er würde wie MacLaren mit vielen wichtigen Leuten reden und sich näher an die Schalthebel der Macht heranarbeiten können.
Delmonte kaute auf seiner Unterlippe. Dass man MacLaren verhaftet hatte, hatte ihm einen Schock versetzt. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass ein so wichtiger Mann mit gewöhnlichen Verbrechern Verbindung aufnehmen könnte. Aber offensichtlich galten in diesem Land auch für die wichtigeren Leute keine besonderen Regeln. Wenn sie es versuchten, fielen sie sehr tief, wie der Fall Watergate bewies.
Delmonte war MacLarens Assistent. Gleich nach seinem College Abschluss hatte er beschlossen, die politische Laufbahn einzuschlagen. Er hatte sich alles viel einfacher vorgestellt, und dass seine Karriere nicht schneller verlief, machte ihm schwer zu schaffen. Nach sechs Jahren war er immer noch Assistent, und MacLaren war noch nicht Senator. Washington und das Weiße Haus waren weit. Wenn beides nicht in zu weite Ferne rücken sollte, musste bald etwas geschehen.
Eine Bewegung an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Er blickte auf und erkannte Joan MacLaren. In einem bis zur Hüfte geschlitzten Kaminkleid lehnte sie an der Tür und betrachtete ihn spöttisch.
„Der Sessel ist noch viel zu groß für Sie“, sagte sie langsam.
Delmonte lief rot an, und sein pickliges Gesicht zuckte nervös. Er stand hastig auf und stolperte beinahe über die Beine des Sessels.
„Ich habe nur nachgesehen, ob etwas auf dem Schreibtisch liegt, das unbedingt erledigt werden muss.“
Sie lächelte und fixierte den schmächtigen kleinen Kerl, den sie wegen seiner kümmerlichen Figur und seines unsicheren Blicks verachtete. Sie wusste genau, dass er sie heimlich mit seinen Blicken verschlang. Es machte ihr Spaß, ihn aufzuregen, denn er würde es nie wagen, sie zu belästigen.
Mit leichten Schritten kam sie näher und beugte sich vor. Ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf, als ihre festen Brüste vor ihm schwebten.
„Sie haben wieder geschnüffelt“, sagte sie leise. „Weder mein Mann noch ich schätzen das. Selbst wenn Kevin zurzeit nicht da ist, sollten Sie vorsichtig sein. Sie werden nie so sein wie er. Sie werden immer ein kleines Licht bleiben.“
Aufreizend langsam drehte sie sich um und ging wieder zur Tür. Delmonte starrte ihr nach, wobei er sich an der Schreibtischplatte festklammerte. Er wusste nicht, genau, ob er sie liebte oder hasste. Nur eines wusste er genau: Eines Tages würde er sie kriegen, ob sie wollte oder nicht.
Er ließ sich wieder in den Sessel sinken und dachte nach. Sie liebte ihren Mann nicht besonders, das war klar. Und dass sie engen Kontakt zu Carruthers hatte, war offensichtlich. Er musste unbedingt mehr darüber erfahren, denn eines Tages würde er dieses Wissen gebrauchen können.
Aber zuerst kam die Arbeit. Er zog die mittlere Schreibtischschublade auf und wühlte in den Papieren herum. Da war es!
Er legte die grüne Mappe auf den Schreibtisch und schlug sie auf. Kevin MacLaren hatte das Memorandum vor einigen Monaten verfasst. Darin war sein Programm für den Fall festgelegt, dass er Senator Clarks Nachfolger werden würde.
Delmonte hatte keine Ahnung, warum sein Auftraggeber gerade dieses Papier brauchte. Aber man hatte ihm genaue Instruktionen gegeben. Und vor allem hatte man ihm tausend Dollar versprochen. Es war ein großer Betrag für die lächerliche Aufgabe, diese grüne Mappe aus dem Schreibtisch zu holen, zumal MacLaren jetzt im Untersuchungsgefängnis saß. Er schloss die Schublade wieder und blickte auf seine Uhr. In wenigen Stunden würde er die Mappe übergeben und sein Geld erhalten.
Delmonte grinste verschlagen.
––––––––
9.
STEVE MCCOY SCHÜTTELTE dem Mann wortlos die Hand und setzte sich auf den Stuhl neben Dr. Highwood. Das Besuchszimmer im Untersuchungsgefängnis bot einen tristen Anblick: grau gestrichene Wände, eine von Kratzern übersäte Tischplatte und die typischen Metallstühle der staatlichen Institutionen.
Kevin MacLaren sah schlecht aus. Sein Gesicht war blass, und er hatte tiefe Ringe um die Augen. Er wirkte müde und erschöpft.
„Sie wollen mir helfen?“, begann er.
Steve nickte. „Erzählen Sie, was passiert ist. Dann werde ich Ihnen sagen, wie wir weiter verfahren.“
„Ich fürchte, in meinem Fall stehen Chancen nicht sehr gut. Alle Indizien sprechen gegen mich, und die Polizei wird das Verfahren bald abschließen.“
Steve lehnte sich zurück. „Hören Sie zu, Mister MacLaren. Es interessiert mich nicht, was die Polizei in Ihrem Fall zu tun gedenkt. Ich will mir mein eigenes Urteil bilden, und das kann ich nur, wenn Sie alle meine Fragen wahrheitsgetreu beantworten, auch dann, wenn Sie sich vielleicht durch die Antworten belastet fühlen.“
MacLaren zuckte mit den Schultern. „Nun gut, fragen Sie.“ Er warf einen schnellen Seitenblick zu seinem Anwalt, aber Highwood nickte nur leicht mit dem Kopf.
„Welchen Nutzen haben Sie von den beiden Verbrechen, für die man Sie verantwortlich macht?“, fragte Steve.
MacLaren zögerte einen Moment und erklärte mit leiser Stimme: „Motive gibt es genug. Durch die Ausschaltung von Senator Clark wird die Nachfolgefrage akut. Jeder weiß, dass ich mich seit Jahren darum bemühe. Durch den Tod meiner Schwester erbe ich ein nicht unbeträchtliches Vermögen. Es ist allgemein bekannt, dass ich selbst nicht gerade reich bin.“
„Wie kommt Ihre Pistole in das Zimmer Ihrer ermordeten Schwester?“, unterbrach ihn Steve McCoy. „Und wie kommen Ihre Fingerabdrücke an die Zündanlage der Sprengladung in Senator Clarks Wagen?“
MacLaren blickte ihn unbewegt an. „Wenn ich das wüsste! Ich fasse täglich so viele Dinge an, dass es kein Problem ist, mir bei irgendeiner politischen Veranstaltung einen bestimmten Gegenstand in die Hand zu drücken, an den ich mich später nicht erinnern kann. Und die Pistole? Ich habe sie seit Wochen nicht in der Hand gehabt. Aber meine Fingerabdrücke sind natürlich drauf. Sie liegt normalerweise in einer Schublade in meinem Schlafzimmer.“
„Das heißt, diese sogenannten Beweisstücke können ohne große Schwierigkeiten manipuliert worden sein?“
MacLaren nickte entschlossen. „Der Meinung bin ich allerdings. Auch der Polizei-Lieutenant scheint sich seiner Sache nicht ganz sicher zu sein. Bei den Verhören zog er diese Möglichkeit in Betracht.“
„Dann ergeben sich als Nächstes zwei Fragen“, stellte Steve fest. „Erstens: Wer hat ein Interesse daran, Sie zu belasten. Und zweitens: Wer hatte die Möglichkeit, Ihre Fingerabdrücke zu beschaffen und an Ihre Pistole heranzukommen?“
„Ich habe eine Menge politischer Gegner. Es ist durchaus möglich, dass mich der eine oder andere aus dem Verkehr ziehen will. An meine Pistole konnte jeder heran, der in meinem Haus verkehrte. Und das sind eine ganze Menge Leute.
„Sie haben also keinen bestimmten Verdacht?“
„Nein. Ich möchte niemanden belasten, wenn ich es nicht beweisen kann.“ MacLaren sah etwas hilflos aus.
„Wie stehen Sie zu Ihrer Frau?“, fragte Steve weiter.
Dr. Charles Highwood sog scharf die Luft ein, sagte aber nichts. MacLaren schien irritiert und zögerte.
Ehe er den Mund aufmachte, erklärte Steve: „Danke, diese Antwort genügt mir schon. Also werde ich mich auch mit Ihrer Frau gründlich unterhalten müssen.“
„Heißt das, Sie werden weiter ermitteln?“, fragte der Anwalt.
„Ja. Das heißt es“, antwortete Steve. „Wer hält sich außerdem noch ständig in Ihrem Haus auf?“
„Mein Assistent. Nicholas Delmonte. Ich habe ihn schon seit vielen Jahren und kann mich nicht beklagen.“
„Und er ist immer noch Assistent?“
MacLaren sah ihn erstaunt an. „Natürlich! Er wird es auch nie weit bringen. Dazu fehlt ihm zu viel. Er ist ein guter Assistent, aber mehr nicht.“
Steve erhob sich. „Gut. Weitere Fragen habe ich zurzeit nicht. Einiges kann ich sicher auch von Ihrem Anwalt erfahren.
Sie verabschiedeten sich, und Highwood begleitete ihn nach draußen.
„Ich bin sicher, dass er die Wahrheit sagt. Ich kenne MacLaren schon seit vielen Jahren. Er kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Deswegen wird er allerdings auch nie ein erfolgreicher Politiker werden. Ich bitte Sie, tun Sie alles, was möglich ist.“
„Das tue ich immer“, antwortete Steve kurz.
––––––––
10.
DER VERKEHR WAR ABGEFLAUT, und ein leichter Nebel hatte sich über die Straße gelegt. Steve schaltete das Licht im Wagen an und betrachtete noch einmal die Fotos, die ihm der Anwalt zur Verfügung gestellt hatte. Er würde Joan MacLaren und auch Delmonte danach sofort wiedererkennen. Er schob die Bilder in die Tasche und stieg aus.
Delmonte hatte eine winzige Wohnung in einer ziemlich miesen Gegend in der Nähe der Piers. Steve sah auf seine Uhr. Um diese Zeit müsste der Sekretär eigentlich zu Hause sein. Steve schlenderte langsam auf das Haus zu, die Hände in den Taschen vergraben. Vorübergehende Passanten drückten sich scheu vorbei. Es war eine Gegend, in der man sich nachts nicht allein auf den Straßen aufhalten sollte.
Als er das baufällige Mietshaus erreicht hatte, blieb er plötzlich stehen. Im Hausflur war das Licht angegangen. Steve wich in den Schatten zurück. Nach ein paar Sekunden öffnete sich die Haustür. Ein junger Mann erschien, ein schmales Päckchen unter dem Arm.
Steve erkannte ihn sofort. Delmonte!
MacLarens Assistent ging zielstrebig die Straße hinunter. Steve folgte ihm in einigem Abstand. Die Verfolgung war nicht schwierig, da Delmonte damit überhaupt nicht rechnete. Nach etwa fünfhundert Metern bog der junge Mann in eine breitere Straße ein, in der mehr Betrieb war. Steve vergrößerte den Abstand, denn Delmonte ging jetzt langsamer und blickte sich manchmal um.
Schließlich blieb der Assistent vor einem Lokal stehen, musterte den Eingang und verschwand plötzlich darin.
Steve wich zwei Pennern aus, die ihn sonst angerempelt hätten, und betrachtete die Kneipe. „Bills Tavern“ stand in nur noch teilweise aufleuchtenden Buchstaben über der Tür. Die Fenster waren mit schmutzigen Vorhängen dekoriert. Entschlossen drückte Steve die Tür auf und trat ein.
Ein Schwall von warmer abgestandener Luft schlug ihm entgegen. Er verzog angewidert die Nase, als er den Geruch von schalem Bier, vollen Aschenbechern und angebranntem Essen wahrnahm.
Mit einem raschen Blick erfasste er die Szene. Niemand beachtete ihn. Rechts befand sich eine lange Theke, die dicht besetzt war. Einzelheiten waren bei der trüben Beleuchtung und der rauchigen Luft nur schwer zu erkennen.
Links befand sich eine Reihe Nischen mit Sitzecken, die nur zum Teil besetzt waren. In einer saß Delmonte, das Päckchen immer noch unter dem Arm. Vor ihm stand ein Kellner in einer ehemals weißen Schürze. Offenbar nahm er gerade die Bestellung auf.
Delmonte war allein und schien sich nicht besonders wohlzufühlen. Er sah sich in dem Raum unsicher um, als befürchte er, von irgendjemandem angegriffen zu werden.
Steve wandte sich zur Seite und ließ sich an einem kleinen runden Tisch nieder. Er musterte flüchtig den übervollen Aschenbecher und die Bierlache – aber die anderen Tische sahen nicht besser aus. Außerdem hatte er hier einen guten Überblick. Der Kellner brachte Delmonte gerade seinen Drink.
Steve bestellte ein Bier und wartete. Delmonte war mit Sicherheit kein Stammgast in diesem Lokal. Er schien herbestellt worden zu sein, und Steve wollte gerne wissen, mit wem sich der junge Mann hier treffen wollte.
Steve McCoy brauchte nicht lange zu warten. Er hatte gerade den ersten Schluck von seinem Bier genommen, als die Tür aufging und zwei weitere Gäste das Lokal betraten.
Es waren zwei Gangstervisagen. Sie sahen sich kurz um und gingen dann zielstrebig auf Delmonte zu, der ihnen ein wenig ängstlich entgegensah. Steve konnte zwar nicht hören, was gesprochen wurde, aber das, was er sah, sprach für sich selbst.
Das Päckchen, das Delmonte bei sich hatte, wurde geöffnet. Eine grüne Mappe kam zum Vorschein. Einer der beiden Neuankömmlinge blätterte darin herum, zog dann einen Zettel aus der Tasche und verglich damit irgendetwas. Steve lächelte. Man hatte dem Mann offenbar aufgeschrieben, worauf er achten sollte.
Die Prüfung fiel offensichtlich befriedigend aus. Die Mappe wurde wieder eingewickelt und wechselte ihren Besitzer. Anschließend zog einer der beiden einen Umschlag aus der Tasche und schob ihn über den Tisch. Delmonte griff gierig danach und riss ihn auf.
Durch die heftige Bewegung wurden einige der Geldscheine, die darin waren, über den Tisch verstreut. Schnell sammelte Delmonte sie wieder ein, zählte sie hastig durch und schob sie in seine Tasche. Er nickte. Das Geschäft war zur beiderseitigen Zufriedenheit abgewickelt worden.
Die beiden Ganoven standen auf. Delmonte blieb sitzen und nippte ein weiteres Mal an seinem Glas.
Steve warf ein paar Dollar auf den Tisch und stand ebenfalls auf. Die beiden anderen Typen waren jetzt wichtiger als Delmonte. Der Vorgang, den er eben verfolgt hatte, ließ keinen Zweifel zu. Material hatte gegen Bezahlung seinen Besitzer gewechselt. MacLarens Assistent war käuflich. Steve würde sich mit ihm noch näher befassen müssen.
Er sah sich um. In der Kneipe achtete immer noch niemand auf ihn. Delmonte stierte vor sich hin. Die beiden Ganoven waren bereits wieder draußen.
Schnell drückte er die Tür auf und atmete gierig die frische Luft ein. Die beiden waren noch keine zehn Schritte entfernt. Er hatte sich die Gesichter gut eingeprägt und würde sie jederzeit wiedererkennen. Langsam folgte er ihnen.
Plötzlich verschwanden sie in einer dunklen Toreinfahrt. Steve zögerte. Sie hatten sich nicht umgedreht, dennoch schien der Richtungswechsel unmotiviert. Aber Steve hatte keine Wahl. Er ging auf die Einfahrt zu.
Obwohl er mit einer Falle rechnete, kam der Angriff überraschend. Eine massige Gestalt stürzte sich auf ihn, und ein gewaltiger Hieb in die Herzgegend nahm ihm den Atem. Er taumelte zurück.
Schon tänzelte der andere heran und versetzte Steve einen Schlag gegen die Schulter. Steve wurde herumgeworfen. Der Erste hatte darauf gewartet. Steve glaubte, von einer Dampframme getroffen zu werden, als ihn der Hieb voll erwischte.
Er knurrte wütend, kam wieder auf die Beine und ging in Abwehrstellung. Die beiden wollten ihn fertigmachen. Aber Steve war entschlossen, jetzt die Initiative zu ergreifen.
Er wich dem nächsten Schlag durch einen Sidestep aus und schlug selbst zu. Der Angreifer lief direkt in seine Faust und heulte auf, als ihn der rechte Haken am Ohr erwischte. Der andere warf sich auf Steve McCoy. Er war größer und schwerer – aber auch unbeherrschter.
Steve hatte keine Schwierigkeiten, ihm auszuweichen. Er tänzelte zur Seite. Sein gestrecktes rechtes Bein schoss vor und traf die Kniescheibe des anderen. Zugleich fuhr seine Handkante gegen den Hals des Gegners. Er wurde gegen die Hauswand geschleudert, wo er wimmernd stehenblieb und seine Knie umklammerte.
Doch Steve war mit ihm noch nicht fertig. Er wollte nachsetzen, um ihn endgültig auszuschalten. In diesem Augenblick erwischte ihn der andere von hinten zwischen den Schulterblättern. Steve wirbelte herum und wich dem nächsten Schlag aus. Er hörte nur das Keuchen des anderen.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass der Erste sich wieder von der Mauer löste und auf ihn zu humpelte. So leicht gaben die beiden nicht auf. Aber auch Steve hatte noch ein paar Tricks in Reserve. Er wich zurück, als der Kleinere angriff. Sie versuchten, ihn in die Zange zu nehmen.
Steve grinste. Solche Situationen waren ihm vertraut, sodass er mechanisch reagieren konnte. Er schlug eine Finte und drehte sich dann blitzschnell um seine Achse. Einer der beiden Gegner stöhnte laut auf, als ihn Steves Faust voll traf.
Sofort wich Steve wieder zurück und ließ den Zweiten auflaufen. Nun hatte er von der Schlägerei genug. Er wollte gerade nach seiner Waffe greifen, um der Auseinandersetzung ein Ende zu machen, als er das Blitzen einer dünnen Klinge bemerkte. Er hatte keine Zeit mehr, die Beretta zu ziehen und ging rasch in Abwehrhaltung.
Die scharfe Klinge zischte vor. Sie hätte ihm das Gesicht zerschnitten, wenn er nicht im letzten Augenblick zur Seite ausgewichen wäre. Er legte alle Kraft in die ausgestreckten Finger der rechten Hand, um einen Karatestoß anzubringen. Aber es gelang ihm nicht ganz. Der Gegner wich ebenfalls zurück, wechselte das Messer in die andere Hand und griff erneut an. Diesmal versuchte er es mit einem Stoß von unten.
Steve wusste, wie gefährlich ein erfahrener Messerkämpfer war. Er blockte die Aufwärtsbewegung mit seinem Unterarm ab und spürte, dass der Stoff seines Ärmels aufgerissen wurde. Gleichzeitig hieb seine Hand durch die Luft wie eine Axt. Nun kannte er keine Rücksicht mehr.
Er traf das Jochbein des anderen und hörte das Knirschen des Knochens. Der fürchterliche Hieb riss den Kopf des anderen herum. Der Gangster schrie laut auf. Mit einem zweiten Hieb traf Steve das Handgelenk des Gangsters, und das Messer klirrte zu Boden.
Der Zweite blieb stehen und wich langsam zurück, als Steve auf ihn zuging. Er hob abwehrend die Hand.
„Hören Sie, können wir uns nicht anders einigen?“, fragte er.
Steve zog seine Pistole, und der andere starrte entsetzt auf die dunkle Mündung.
„Sie – Sie wollen doch nicht schießen?“, stammelte er ängstlich.
Steve ließ die Waffe kreisen, und die beiden stolperten zurück. Sie gehörten zu den kleinen Ganoven, die sich nur stark fühlten, wenn sie die Oberhand hatten. Sobald sie einem Stärkeren gegenüberstanden, waren sie feige und ängstlich. Steve kannte diesen Typ gut. Kanalratten, dachte er.
„Wo ist die grüne Mappe?“, herrschte er sie an.
Einer von ihnen griff unter seine Jacke. Steve hob die Pistole, aber der andere holte tatsächlich den Umschlag heraus und warf ihn mit einem ärgerlichen Grunzen auf den Boden.
„Und jetzt verschwindet!“, sagte Steve. „Aber schnell, ehe ich es mir anders überlege!“
„Wir sehen uns noch“, knurrte einer der beiden, ehe sie im Dunkeln verschwanden.
Steve McCoy bückte sich und hob die Mappe auf. Dann ließ er seine Waffe wieder im Holster verschwinden und trat den Rückweg zu seinem Wagen an.
––––––––
11.
JOAN MACLAREN SAß VOR dem Spiegel und bürstete ihr Haar. Sie starrte ihr Ebenbild an und verzog das Gesicht. Die ersten Falten zeigten sich. Sie wurde nicht jünger. Es wurde Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
Sie hielt erschrocken inne, als das Klingeln des Telefons sie aus ihren Gedanken riss. Wer konnte das jetzt noch sein? Um diese Zeit hatte früher höchstens Kevin angerufen, um ihr mitzuteilen, dass er noch irgendwo aufgehalten wurde. Aber im Untersuchungsgefängnis würde man ihm das kaum erlauben. Sie lächelte.
Sie erhob sich, schlenderte zum Nachttisch hinüber und nahm den Hörer ab. „Ja?“
Sie erkannte die leise drängende Stimme am anderen Ende sofort.
„Hör zu, da ist etwas passiert, das unsere Pläne beeinflussen kann. Ich muss wissen, ob dein Mann jemanden mit der Aufklärung seines Falles beauftragt hat. Das ist sehr wichtig.“
Sie tat erstaunt. „Die Polizei beschäftigt sich ausführlich mit dieser Angelegenheit. Und der Staatsanwalt auch, nehme ich an. Aber das solltest du eigentlich wissen.“ Sie lachte leise.
„Das meine ich nicht.“ Seine Stimme wurde beschwörend. „Kümmert sich ein Außenstehender um Kevin? Gibt es jemanden, der außerhalb der offiziellen Stellen Ermittlungen anstellt?“
Joan runzelte die Stirn. „Er hat natürlich seinen Anwalt. Dr. Highwood. Das ist ein alter Schulfreund, der seine Verteidigung übernehmen will. Aber das ist doch ganz normal. Ich verstehe nicht, wieso du so daran interessiert bist.“
Die fremde Stimme unterbrach sie ungeduldig. „Ich weiß, dass er einen Anwalt hat. Aber gibt es außer ihm jemanden? Das muss ich herauskriegen.“
Joan zögerte einen Moment und dachte nach. Die Sache erschien ihr mysteriös. „Mir ist nicht bekannt, dass außer seinem Anwalt noch jemand für ihn arbeitet. Delmonte vielleicht?“
Der Mann am anderen Ende lachte. „Nein, der bestimmt nicht!“
„Wenn du schon so genau Bescheid weißt, warum fragst du mich dann noch?“
„Nun sei nicht gleich beleidigt. Ich bitte dich nur um eine kleine Gefälligkeit.“
„Diese Gefälligkeiten kenne ich. Na schön, was soll ich für dich tun?“, fragte Joan MacLaren mit sarkastischem Unterton.
„Geh morgen zu deinem Mann und frage ihn, ob er selbst irgendjemanden beauftragt hat. Du musst es aber so geschickt anstellen, dass er nicht argwöhnisch wird.“
„Danke für die Belehrung. Ich weiß, wie ich mit meinem Mann umgehen muss. Ich bin schließlich schon ein paar Jahre mit ihm verheiratet.“
Wieder ertönte ein leises Lachen. „Hoffentlich nicht mehr allzu lange!“
„Das lass nur meine Sorge sein!“ Wütend knallte sie den Hörer auf die Gabel.
Sie setzte sich wieder vor den Spiegel und versuchte, sich zu beruhigen. Ihre Hände zitterten leicht. Sie streckte sie aus und betrachtete die schlanken Finger. Dann blickte sie wieder in den Spiegel. Noch war sie schön, und die Männer drehten sich auf der Straße nach ihr um. Aber schon jetzt mussten die Erzeugnisse der kosmetischen Industrie in erheblichem Maße dazu beitragen. Eines nicht allzu fernen Tages würde es auch damit vorbei sein. Und bis dahin musste sie erreicht haben, dass es darauf nicht mehr ankam.
––––––––
12.
STEVE MCCOY BLICKTE an der Fassade des Hauses hinauf. Es lag in einem guten Viertel und sah noch relativ neu aus. Hier also wohnte Kevin MacLaren, von Beruf Politiker und zurzeit unter Mordverdacht Untersuchungsgefangener der Stadt New York.
Steve war schon früh hergekommen. Er hoffte, MacLarens Frau anzutreffen, ehe sie das Haus verließ. Denn mit ihr musste er unbedingt sprechen. Er studierte die Tafel mit den Namen der Mieter und ließ sich dann vom Lift nach oben tragen.
Er drückte auf die Klingel, und es dauerte fast dreißig Sekunden, bis sich die Tür langsam öffnete. Es war nicht Joan MacLaren, die ihm öffnete. Delmontes käsiges Gesicht sah ihm ängstlich entgegen.
„Wir kaufen nichts“, sagte er missmutig.
Steve machte einen Schritt nach vorn und legte eine Hand auf die Tür.
„Ich will Ihnen nichts verkaufen.“ Er drückte Delmonte mit Leichtigkeit von der Tür weg und drängte in die Wohnung.
„He! Was erlauben Sie sich? Verlassen Sie sofort diese Wohnung!“ Delmonte gab sich empört, konnte seine Furcht aber nicht verbergen. Er war das personifizierte schlechte Gewissen. Ohne weitere Gegenwehr trat er zurück und ließ Steve McCoy nähertreten.
Steve beschloss, gleich aufs Ganze zu gehen. Mit Überraschung und Einschüchterung kam man bei diesen Typen am weitesten.
„Sind Sie allein?“
Delmonte nickte überrascht. „Ja. Mister MacLaren ist – äh ...“
„Ich weiß, wo er ist. Und seine Frau?“
„Sie ist bei ihm. Sie ist heute schon sehr früh zu ihm gefahren. Und sonst ist niemand hier. Was wollen Sie denn von mir?“
Steve betrachtete ihn abschätzend, und der andere wurde nervös.
„Verdammt noch mal, so antworten Sie doch endlich. Das ist Hausfriedensbruch!“
Plötzlich schien ihm eine Idee zu kommen, und er wurde ganz kleinlaut. „Polizei?“, fragte er leise.
Steve antwortete nicht und ging ins Wohnzimmer. Er stellte sich ans Fenster und blickte auf die Straße hinunter.
„Mister Delmonte, Sie haben merkwürdige und außerdem gefährliche Bekannte“, bemerkte er sanft.
Er spürte, dass der andere den Atem anhielt.
„Wie meinen Sie das?“
Steve fuhr herum. „Lassen Sie das alberne Spiel. Wer hat Sie beauftragt, die grüne Mappe aus MacLarens Unterlagen zu nehmen, und wie viel haben Sie dafür bekommen? Diese Papiere sind in den falschen Händen ein weiterer Beweis für MacLarens Schuld, das ist Ihnen doch klar? Also? Antworten Sie!“
Delmonte wurde wachsbleich. Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Er wich langsam zurück, bis er sich an einem Tisch festhalten konnte.
„Ich weiß nicht, wovon Sie reden“, flüsterte er.
Steve McCoy trat einen Schritt auf ihn zu und packte ihn an den Aufschlägen. „Sie wissen sehr genau, wovon ich rede. Gestern Abend haben Sie eine bestimmte Mappe an zwei Typen übergeben, die man unschwer als Gangster übelster Sorte erkennen konnte. Dafür haben Sie einen Umschlag mit Geld bekommen.“
„Ja, ja, aber das ist doch harmlos“, stammelte Delmonte. „Das war eine kleine Gefälligkeit. Das hat nichts zu bedeuten! Das waren Parteifreunde von MacLaren, die sich für ein Referat interessierten. Da ist doch nichts dabei! Und das Geld waren Schulden, die mir bei dieser Gelegenheit zurückgezahlt wurden.“
„Mit Ausreden sind Sie ja schnell bei der Hand.“ Steve schüttelte den anderen leicht und ließ ihn schließlich los. Er konnte ihm nichts beweisen, und Delmonte hatte überraschend schnell reagiert.
„Ihr Boss wird sich wahrscheinlich für diese Art von Parteifreunden bedanken“, sagte Steve. „Solche merkwürdigen Geschäfte zahlen sich selten aus. Daran sollten Sie denken, wenn Sie das nächste Angebot dieser Art bekommen. Und das kommt bestimmt, denn leider haben Ihre Parteifreunde die Mappe wieder verloren, und das ist sicher sehr ärgerlich für sie.“
Delmonte bewegte den Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er wollte etwas sagen, brachte aber nichts heraus.
In diesem Moment ging die Tür auf. Joan MacLaren stand auf der Schwelle. Langsam zog sie ihre Handschuhe aus und betrachtete die beiden Männer von oben bis unten.
„Ich wusste nicht, dass Sie Ihren Besuch in unserer Wohnung empfangen, Delmonte.“ Ihre Stimme klirrte wie Eis.
„Das ist nicht mein Besuch“, antwortete Delmonte hastig. „Er wollte eigentlich zu Ihnen. Ich habe ihm ja gesagt, dass niemand hier ist. Er hat sich noch nicht mal vorgestellt.“ Langsam zog er sich zurück.
Die Frau gab die Tür frei und ließ Delmonte durch. Er schien erleichtert, als er den Raum verlassen konnte.
Sie musterte Steve abschätzend, warf Handschuhe und Tasche auf einen Stuhl und setzte sich auf eine zierliche Couch.
„Dort drüben stehen Getränke“, sagte sie und deutete auf die Bar.
Steve rührte sich nicht und betrachtete sie schweigend.
„Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind“, sagte sie schließlich. „Sie arbeiten für meinen Mann, um seine Unschuld zu beweisen, was nicht ganz einfach sein dürfte. Er scheint großes Vertrauen zu Ihnen zu haben.“
Steve verriet sein Erstaunen nur mit einem leichten Runzeln der Stirn. Ihr Mann hatte ihr offenbar einiges erzählt – wenn auch nicht alles. Er verspürte kein Bedürfnis, ihr die ganze Wahrheit mitzuteilen. Sollte sie ihn einfach für einen Privatdetektiv oder etwas Ähnliches halten.
„Wundern Sie sich darüber, dass ich alles weiß?“ Sie lächelte überlegen und arrogant. „Sie müssen wissen, dass mein Mann mir alles erzählt, wenn ich ihn danach frage. In dieser Beziehung ist er ganz anders als ich.“
Steve nickte leicht. „Das ist wohl so.“
Er wandte sich ab und ging zur Bar. „Was wollen Sie trinken?“
„Einen Bourbon mit Soda, bitte. Nehmen Sie sich, was Sie mögen.“
Steve mixte ihr den Drink. „Um diese Zeit trinke ich noch nichts. Ich muss tagsüber arbeiten.“
Sie sah ihn spöttisch an und hob ihr Glas.
„Auf Ihren Erfolg, Mister McCoy!“
Er nickte ihr zu. „Ich habe eine interessante, wenn auch einseitige Unterredung mit Mister Delmonte gehabt. Immerhin hat er ein schlechtes Gewissen.“
Sie fuhr hoch. „Was wollen Sie damit sagen? Meinen Sie etwa, ich sollte auch ein schlechtes Gewissen haben? Ich habe weder Sprengladungen versteckt noch jemanden umgebracht. Ich ahnte nicht, dass mein Mann solche Dinge tun könnte.“
„Sie glauben also an seine Schuld?“
Sie nagte an ihrer Unterlippe. „Ich weiß es nicht. Und jetzt gehen Sie. Ich möchte dieses Gespräch mit Ihnen nicht fortsetzen. Denken Sie daran, dass mein Mann Sie beauftragt hat, nicht ich. Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen.“
Steve stand auf. Seine Stimme blieb ruhig. „Ich werde sicher noch mal wiederkommen. Sie haben mir noch eine ganze Menge zu sagen. Über die Kanzlei von Dr. Highwood können Sie mich erreichen. Mein Name ist Steve McCoy.“
Mit ein paar schnellen Schritten war er an der Tür und riss sie auf. Delmonte stand auf der anderen Seite, hob abwehrend die Hände und wollte zu einer Erklärung ansetzen.
Steve McCoy schnitt ihm mit einer unwilligen Handbewegung das Wort ab. „Wir sprechen uns noch!“
Joan MacLaren krampfte ihre Hand um das Glas und starrte noch lange auf die Tür.
Dann erhob sie sich und ging zum Telefon.
––––––––
13.
DER SCHLANKE HOCHGEWACHSENE Mann mit der dunklen Gesichtsfarbe zog sorgfältig die Handschuhe straff. Anschließend stieg er aus dem Wagen und öffnete den Kofferraum. Er warf einen prüfenden Blick nach allen Seiten, aber niemand achtete auf ihn. Die Leute in dieser Gegend hatten genug mit ihren eigenen Problemen zu tun.
Er nahm den langen Gegenstand, der in einer braunen Segeltuchhülle steckte, heraus und knallte den Kofferraum wieder zu. Langsam ging er auf einen Hauseingang zu und trat ein. Er machte kein Licht im Hausflur. Er war es gewohnt, sich im Dunkeln zurechtzufinden.
Er brauchte drei Minuten, bis er das oberste Stockwerk erreicht hatte. Ohne Schwierigkeiten öffnete er die Klappe, die auf das Dach führte. Mit einem eleganten Satz schwang er sich hoch und stemmte sich durch die Luke. Leise fiel die Klappe wieder zurück.
Er brauchte ein paar Sekunden, um sich auf der abschüssigen Fläche zu orientieren. Er ging nach vorn zur Straßenfront und riskierte einen Blick. Das Haus auf der gegenüberliegenden Seite war etwa gleich hoch. Er musterte die Fenster im oberen Stockwerk. Die Wohnung, die er suchte, war erleuchtet. Er bemerkte einen flüchtigen Schatten, der sich hinter den Fenstern bewegte.
Der Mann, den man Sabato nannte, verzog keine Miene. Er wusste, dass er sein Wild um diese Stunde antreffen würde. Er pflegte seine Aktionen gründlich vorzubereiten. Deswegen war sein Preis auch ziemlich hoch – und das Risiko seiner Auftraggeber gering. Das wusste man in den Kreisen, wo sein Name hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurde.
Sabato sah sich auf dem Dach um, bis er einen geeigneten Platz gefunden hatte. Hinter einem Schornstein kauerte er sich nieder. Er zog ein Gewehr aus der Segeltuchhülle. Es war ein Präzisionsgewehr von Browning, Marke Safari Grade.
Er strich kurz mit der Hand über den Walnussschaft und überprüfte den Verschluss. Danach schraubte er das Weaver-Zielfernrohr auf und nahm die Schutzkappen an den Objektiven ab.
Schließlich holte er ein Magazin aus der Tasche und füllte es mit fünf H&H .375 Magnum-Patronen. Er drückte das Magazin in die Kammer, bis der Riegel einrastete. Dann zog er den Verschlusshebel zurück, und die erste Patrone glitt in den Lauf.
Er richtete sich auf und stützte den Gewehrlauf gegen die Schornsteinmauer. Er presste sein Auge gegen das Okular des Zielfernrohrs und schwenkte den Lauf langsam herum, bis er sein Ziel im Visier hatte. Er überprüfte noch einmal die Entfernung und drehte an der entsprechenden Schraube.
Das Gewehr war auf das mittlere der drei erleuchteten Fenster gerichtet. Dort lebte der Mann, den er in dieser Nacht töten wollte. Für ihn war das eine Arbeit wie jede andere. Es gab nur einen Unterschied. Er durfte sich keine Fehler leisten. Er war ein Spezialist und machte keine Fehler. Das überließ er den Amateuren. Zum Beispiel solchen Dummköpfen wie Atkins und Ellison.
Sein rechter Zeigefinger erreichte kurz den Druckpunkt und entspannte sich gleich darauf wieder. Noch war es nicht soweit.
Der Mann dort drüben lief unruhig im Zimmer hin und her. Durch das hochwertige Zielfernrohr waren alle Einzelheiten gut zu erkennen. Die Wohnung war nicht besonders geschmackvoll ausgestattet. Zur Straße hin lagen ein winziges Schlafzimmer mit einem Fenster und das Wohnzimmer mit zwei Fenstern.
Der Mann stand jetzt in der Mitte des Zimmers vor einem runden Tisch. Er hielt etwas in der Hand, das nicht genau zu erkennen war. Der Vorhang verdeckte ihn zum Teil.
Sabato hielt das Gewehr völlig ruhig auf die Stelle gerichtet, wo der Mann wieder vorbeikommen musste. Im Fadenkreuz war eine hässliche Vase, die auf einem Schrank stand.
Als sich nach dreißig Sekunden immer noch nichts rührte, schwenkte Sabato den Lauf herum. Das Fadenkreuz wanderte mit. Irgendetwas schien die Aufmerksamkeit des Mannes erregt zu haben. Er stand in merkwürdig gespannter Haltung da.
Plötzlich war er aus Sabatos Gesichtsfeld verschwunden. Rasch schwenkte Sabato den Lauf herum, aber hinter keinem der Fenster tauchte der Mann auf. Dann atmete er auf. Das Opfer war wieder ins Zimmer getreten.
Aber es war nicht allein, ein zweiter Mann folgte ihm.
Sabato stieß einen Fluch aus. Er musste seinen Plan ändern. Jetzt hatte er keine Zeit mehr zu verlieren.
Er sah, dass der andere zur Zimmermitte zurückwich. Schnell richtete er das Gewehr wieder auf die alte Stelle. Die Vase erschien im Fadenkreuz.
Und dann, ganz langsam, schob sich ein Hinterkopf vor die Vase. Noch einmal korrigierte Sabato die Richtung, bis der Schnittpunkt der beiden dünnen Fäden genau hinter dem linken Ohr lag.
Dann drückte er ab.
––––––––
14.
STEVE MCCOY ERSTARRTE, bis er den Schock überwunden hatte. Dann warf er sich zu Boden, robbte zur Tür und löschte das Licht.
Aber es fiel kein weiterer Schuss.
Steve blieb einige Minuten bewegungslos liegen. Danach kroch er zum Fenster und blickte vorsichtig hinaus. Es war niemand zu sehen. Er musterte die Fenster und das Dach des Hauses auf der anderen Straßenseite. Dann wandte er den Kopf und versuchte, die Schussbahn zu bestimmen. Der Schütze musste auf dem gegenüberliegenden Dach hocken. Wenn er noch dort war.
Er zog die Jalousien an den beiden Fenstern herunter und machte wieder Licht. Übelkeit stieg in ihm auf.
Er hatte sich vorgenommen, an diesem Abend mit Delmonte ernsthaft zu sprechen. Er war sicher, dass er ihn zum Reden bringen würde.
Die Geschichte mit der grünen Mappe stank zum Himmel. Delmonte hatte Dreck am Stecken.
Doch er konnte ihm nun nicht mehr weiterhelfen.
Steve McCoy hatte geklingelt und MacLarens Assistent einfach ins Zimmer geschoben, als ihm geöffnet worden war. Delmonte hatte ihn nur fassungslos angestarrt und war zurückgewichen.
Steve hatte gerade den Mund aufgemacht, als die Scheibe ein Loch bekommen hatte, eine Vase klirrend zerplatzt war – und Delmonte plötzlich kein Gesicht mehr gehabt hatte. Für einen Sekundenbruchteil stand er reglos da – dann war er wie vom Blitz getroffen zusammengesackt, ohne jeden Laut. Das Geschoss aus dem Hinterhalt war in seinen Hinterkopf gedrungen und hatte ihm den halben Schädel weggerissen, bevor es die Vase zersplittert hatte und in der Wand steckengeblieben war.
Delmonte war sofort tot gewesen. Überall war Blut. Hier konnte Steve nichts mehr tun.
Er blickte auf seine Uhr. Seit dem Schuss war noch nicht viel Zeit vergangen. Vielleicht hatte er noch eine Chance, den heimtückischen Schützen zu erwischen. Jedenfalls war dieser Mord für ihn der letzte Beweis, dass im Fall MacLaren die Dinge anders lagen als sie zu liegen schienen. Irgendjemand spielte hier ein teuflisches Spiel.
Steve rannte die Treppe hinunter, da es in diesem alten Haus keinen Fahrstuhl gab. Er überquerte mit raschen Schritten die Straße und verschwand in dem Hauseingang auf der anderen Seite.
Obwohl er selbst den Schuss nicht gehört hatte, hätte irgendjemand etwas bemerken müssen. Aber in dieser Gegend würde sich vermutlich niemand darum kümmern.
Steve lauschte. Im Haus rührte sich nichts. Er stieg langsam hinauf. Unter dem Dach blieb er stehen. Es war keine Schwierigkeit, die Luke vom Boden aus zu erreichen.
Er zog sich hoch. Sekunden später stand er auf dem Dach. Er ging nach vorn und sah die Fenster von Delmontes Wohnung. Hier musste der Schütze gestanden haben. Steve sah sich suchend um und musterte das Dach.
Keine Patronenhülse blinkte verräterisch. Das war auch nicht zu erwarten, wenn es ein professioneller Schütze gewesen war. Solche Leute pflegten ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Und eine Patronenhülse war eine Spur, für die jedes Polizeilabor der Welt überaus dankbar war.
Steve trat ein paar Schritte nach links. Hier war der ideale Platz. Er beugte sich suchend vor, doch bei der schwachen Beleuchtung war nichts zu erkennen. Seufzend richtete er sich wieder auf. Da bemerkte er den Schatten, der auf ihn zusprang.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass ein länglicher Gegenstand auf ihn zuschoss. Steve wollte ausweichen, aber es war zu spät. Ein mörderischer Schlag traf ihn in die Seite und nahm ihm den Atem. Er taumelte nach hinten und prallte gegen die Mauer des Schornsteins.
Ein höllischer Schmerz zuckte durch seinen Körper, und vor seinen Augen flimmerte es. Er krallte sich mit einer Hand an den Steinen fest, um sich wieder hochzuziehen. Doch er erhielt einen Tritt gegen den Kopf.
Kraftlos rollte er zur Seite. Er hörte sich stöhnen und spürte, dass ihm die Sinne schwanden. Dass er von flinken Händen durchsucht wurde, spürte er schon nicht mehr.
Als Steve wieder zu sich kam, war fast eine halbe Stunde vergangen. Er richtete sich auf und betastete seinen Kopf. Wieder fuhr der Schmerz durch seinen Körper als er die blutverklebte Stelle an seiner linken Schläfe berührte.
Er hatte sich wie ein Anfänger überrumpeln lassen. Der Mörder hatte hier oben gewartet und darauf gelauert, dass ein Neugieriger kam, um nachzusehen. Vielleicht war er auch nicht sicher gewesen, ob er Delmonte getötet hatte, oder er hatte es nicht riskieren wollen, zu schnell auf der Straße gesehen zu werden. Der unbekannte Mörder hatte schließlich nicht wissen können, dass Delmonte an diesem Abend Besuch bekommen würde.
Steve stand schwankend auf und hielt sich an der Ziegelmauer fest. Diese Runde war eindeutig an den Gegner gegangen.
Er verließ das Dach auf demselben Weg, den er gekommen war, und überlegte, ob er noch einmal in Delmontes Wohnung gehen sollte. Aber das erschien ihm zu riskant. Wenn er Pech hatte, nahm man ihn noch als Mörder fest.
Er suchte seinen Wagen und ließ sich dankbar in die Polster des Camaro sinken. Dann ließ er den Motor an. Für heute hatte er genug. Er war wütend auf sich selbst und schwor sich, dass er den unbekannten Gegner stellen und mit ihm abrechnen würde.
Die zweite Runde würde anders enden!
––––––––
15.
DR. CHARLES HIGHWOOD rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her.
„Haben Sie vielleicht einen Schluck zu trinken? Wenn ich reden muss, ist meine Kehle immer wie ausgedörrt.“
Joan MacLaren warf den Kopf zurück und lachte laut auf. „Wie machen Sie das eigentlich vor Gericht, lieber Freund? Dort werden hochprozentige Getränke selten gereicht, soviel ich weiß.“
Der Anwalt lächelte zerknirscht. „Ich habe eine kleine Taschenflasche. Sie stammt noch aus der Prohibitionszeit und gehörte meinem Vater. Das ist meine eiserne Reserve. Ein kleiner Schluck zwischendurch beruhigt die Nerven.“
„Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie Nerven haben?“
Highwood stand auf und ging zur Hausbar. „O doch! Gerade jetzt, in diesem Fall, merke ich es wieder. Man ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Und Ihr Mann ist in einer verdammt heiklen Lage. Ich weiß nicht, ob wir ihn da herauspauken können. Jedenfalls ist noch keine Anklage erhoben worden, sodass wir noch ein wenig Zeit haben.“
Er wandte sich rasch um. „Interessiert Sie das überhaupt?“ Seine Stimme klang ein wenig schärfer, und Joan zuckte zusammen.
Auf ihrer Stirn bildete sich eine tiefe Falte.
„Seien Sie nicht albern. Aber was kann ich schon tun? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin mir nicht sicher, was ich glauben soll. Hat er’s getan, oder hat er’s nicht getan? Soll das doch die Polizei herausfinden. Die wird schließlich dafür bezahlt.“
Highwood spritzte Sodawasser aus einem Siphon in sein Glas und nahm einen kräftigen Schluck. „Ich glaube, Sie könnten sich etwas mehr um Ihren Mann kümmern. Seine Situation ist scheußlich. Er braucht Sie jetzt.“
Joan trommelte mit ihren Fingern auf dem Tisch.
„Mein lieber Doktor, Sie mischen sich wieder in Angelegenheiten ein, die Sie nichts angehen. Ich habe Sie noch nie sonderlich leiden können, und jetzt finde ich, dass Sie ein bisschen zu weit gehen. Sorgen Sie dafür, dass mein Mann die denkbar beste Verteidigung erhält, aber zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf.“
Dr. Highwood sah sie ernst und ein wenig traurig an.
„Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun.“ Er stellte sein Glas mit einem heftigen Ruck auf die polierte Glasplatte der Hausbar und marschierte mit großen Schritten hinaus, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
Sie blickte ihm unbewegt nach.
„O ja, ich weiß sehr gut, was ich tue“, sagte sie schließlich leise.
––––––––
16.
STEVE MCCOY RÄUSPERTE sich ein zweites Mal, diesmal lauter. Aber der Sergeant hinter dem riesigen Schreibtisch nahm ihn noch immer nicht zur Kenntnis.
Sergeant Masters hatte heute seinen schlechten Tag. Den hatte er mindestens einmal im Monat. Seine Kollegen hatten sich daran gewöhnt und machten an diesen Tagen einen weiten Bogen um ihn. Nur ein Erdbeben oder der Besuch des Polizeipräsidenten hätten ihn aus dieser Stimmung gerissen. Man munkelte, dass seine schlechte Laune irgendwie mit seiner Frau zusammenhing, aber so genau wusste es natürlich niemand.
Steve ergriff die Initiative. „Hören Sie, Sergeant, ich möchte mit jemandem sprechen, der ...“
„Aber ich nicht“, unterbrach ihn der Sergeant.
Jetzt wurde es Steve McCoy zu bunt. Er knallte die Faust auf den Tresen, der Besucherraum und Büro trennte, und rief: „Wollen Sie mir jetzt endlich zuhören?“
Masters zuckte unwillkürlich zusammen. Das hatte in seiner Gegenwart noch niemand gewagt, schon gar nicht an einem Tag wie diesem. Er blickte irritiert auf und nahm seinen Besucher zum ersten Mal bewusst zur Kenntnis. Sorgfältig legte er den Kugelschreiber, mit dem er in irgendwelchen Aktenstücken Notizen gemacht hatte, zur Seite, und lehnte sich zurück. Sein Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
„Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber wenn Sie hier randalieren wollen, kann ich Sie gern in unsere Ausnüchterungszelle sperren.“
Steve wäre am liebsten über den Tresen gesprungen, um diesem unhöflichen Polizisten eine aufmunternde Ohrfeige zu verpassen. Er nahm sich zusammen.
„Ich möchte jetzt sofort Ihren Vorgesetzten sprechen.“
„Das geht leider nicht“, antwortete Masters ungerührt.
„Und warum nicht?“
„Weil ich Sie nicht anmelden kann.“
„Und warum können Sie mich nicht anmelden?“ Steve konnte sich nur noch mühsam beherrschen.
Sergeant Masters sah ihn fast mitleidig an.
„Erstens haben wir jetzt keine Sprechstunde, und zweitens darf ich meinen Platz hier nicht verlassen. Wenn Sie sich ein wenig gedulden, haben Sie vielleicht Glück, und der Lieutenant kommt aus seinem Zimmer. Dann können Sie gern mit ihm reden.“
Steve sah, dass der Sergeant sich wieder über seine Akten beugte und zum Kugelschreiber griff. Aber so leicht gab Steve nicht auf.
Er griff nach dem internen Telefonbuch, das in seiner Reichweite auf dem Tresen lag. „Darf ich mal telefonieren?“
Der Sergeant brummte etwas, das man mit viel gutem Willen als Zustimmung auslegen konnte, und fügte hinzu: „Ortsgespräche kosten zehn Cent.“
Steve blätterte schnell die Seiten durch, bis er den Namen entdeckte, der ein paar Schritte weiter an der Tür stand: Lieutenant Anderson. Er wählte die dreistellige Nummer und wartete, bis sich eine freundliche Stimme meldete.
„Ja?“
„Lieutenant Anderson? Hier ist Steve McCoy. Ich bin in Ihrem Vorraum und möchte mich gern ein paar Minuten mit Ihnen unterhalten.“
„Und warum kommen Sie dann nicht herein?“, fragte Anderson und legte auf.
Verwirrt ließ Steve den Hörer auf die Gabel gleiten. Das war schon eine merkwürdige Truppe in diesem Revier. Der Sergeant hatte den kurzen Dialog offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Jedenfalls reagierte er nicht, als Steve die Schranke hochklappte und auf die Tür zuging, hinter der der Lieutenant residierte.
Steve bemerkte zunächst einen fetten Mann, der in einer nicht mehr ganz neuen und auch nicht ganz sauberen Uniform hinter einem fast leeren Schreibtisch hockte und ihm freundlich entgegensah.
„Guten Tag, Mister ... Wie war gleich Ihr Name?“
Steve deutete eine knappe Verbeugung an.
„McCoy ist mein Name. Ich bin Ermittler für MacLarens Anwalt Dr. Highwood.“ Diese Tarnung schien ihm am Glaubhaftesten, und sie war nicht einmal ganz falsch.
Lieutenant Anderson wies mit einer vagen Geste auf einen wackligen Stuhl vor dem Schreibtisch und knöpfte sich einen weiteren Knopf seiner Uniformjacke auf. Er schwang sich mit seinem Stuhl herum und starrte auf die gegenüberliegende Hauswand.
„MacLaren“, sagte er schließlich mit leiser Stimme. „Das ist ein merkwürdiger Fall. Ich weiß nicht, ob ich darüber mit Ihnen sprechen möchte.“
Steve beugte sich vor. „Warum finden Sie den Fall merkwürdig? Sehen Sie, ich ermittle im Interesse meiner Klienten, um die Wahrheit herauszufinden. Und Sie mussten den Fall übernehmen, weil die Verbrechen in Ihrem Revier geschehen sind. Warum sollen wir nicht ein paar Informationen austauschen?“
Der Lieutenant schwenkte wieder in seinem Drehstuhl herum.
„Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mister McCoy, und deshalb können Sie nicht erwarten, dass ich Sie jetzt mit dem Stand meiner Ermittlungen vertraut mache.“
„Davon kann auch keine Rede sein“, wandte Steve ein. „Ich habe nur den Verdacht, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Mit anderen Worten, ich glaube, da ist eine Schweinerei im Gange.“
Anderson blinzelte und rieb sich mit dem Handrücken über seine Knollennase.
„Das ist schon möglich. Aber haben Sie auch Beweise dafür?“
Steve zuckte mit den Schultern. „Sie wissen so gut wie ich, dass man in einem solchen Fall nicht über Nacht Beweise finden kann. Aber wenn man erst mal weiß, in welcher Richtung man zu suchen hat, steht man dicht vor dem Erfolg.“
„Bis jetzt haben wir nur Indizien dafür, dass Kevin MacLaren das getan hat, was man ihm zur Last legt. Aber ich gebe zu, dass es einige Ungereimtheiten gibt. Trotzdem kann ich ihn nicht laufen lassen. Es geht schließlich um einen Mord – von dem Attentat auf den Senator gar nicht zu reden.“
Ja, es geht um Mord“, sagte Steve. Er wusste, dass es in diesem Fall sogar um zwei Morde ging, aber das wollte er dem Lieutenant nicht gleich auf die Nase binden. Er wollte zwar Informationen holen, aber keine peinlichen Fragen beantworten. „Sind Sie denn sicher, dass es MacLaren war?“
Der Lieutenant sah ihn lange schweigend an. Dann schüttelte er langsam den Kopf. „Ich bin meiner Sache nie ganz sicher, und in diesem Fall schon gar nicht. Aber ich finde noch heraus, was da stinkt.“
Steve erhob sich. „Danke. Mehr wollte ich nicht wissen.“
An der Tür drehte er sich noch einmal um. „Sie haben einen merkwürdigen Sergeant da draußen. Er ist nicht geradezu hervorragend für den Posten eines Empfangschefs geeignet.“
Anderson lächelte schwach. „Sergeant Masters ist eine Seele von Mensch, aber er hat an einem Tag im Monat schlechte Laune. Wir haben uns daran gewöhnt und nehmen Rücksicht auf ihn. Das sollten Sie auch tun. Auf Wiedersehen, Mister McCoy.“
Steve drückte die Tür hinter sich leise ins Schloss. Masters saß immer noch über seine Akten gebeugt und blickte nur kurz auf, als Steve so behutsam wie möglich an ihm vorbeiging.
„Lassen Sie sich nicht stören, Sergeant, ich finde schon allein raus“, bemerkte er grinsend. „Und wenn Sie wieder Ihren Anfall haben, versuchen Sie’s doch mal mit einem Mickey-Mouse-Film.“
Er war draußen, ehe der verblüffte Sergeant antworten konnte.
––––––––
17.
JOAN MACLAREN ZÖGERTE, blickte sich schnell nach allen Seiten um und trat dann entschlossen auf den Eingang des Lokals zu. Mit einer heftigen Bewegung stieß sie die Tür des „Pentangle“ auf und ging hinein. Sie war zum ersten Mal in dieser verräucherten Kneipe in der winzigen Straße parallel zur Pearl Street, ein paar hundert Meter von den Piers am East River entfernt, fast an der südlichen Spitze Manhattans.
Sie hatte sich lange umhören müssen, bevor sie die Adresse erfahren hatte, und den Namen des Mannes, an den sie sich wenden konnte.
Nach einigen Sekunden hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Nur ein paar trübe Funzeln erhellten den langgestreckten Raum. Rechts erhob sich eine hohe Theke aus Holz, vor der eine Reihe Barhocker standen. Links standen kleine, runde Tische in Nischen.
Es waren nicht viele Gäste anwesend. An der Bar lümmelten einige junge Burschen in Lederkleidung, und an den Tischen saßen ein paar Männer und Frauen, die bestimmt nicht zur besseren New Yorker Gesellschaft gehörten.
In der Mitte tanzte ein Paar eng umschlungen zu den hämmernden Klängen einer Music-Box. Sie zeigten wenig Verständnis für den Rhythmus. Sie tanzten offenbar nach einer ganz anderen Melodie und hatten nur Interesse an sich selbst.
Joan MacLaren wandte ihren Blick ab und ging langsam zur Bar. Niemand nahm sie zur Kenntnis. Einerseits empörte sie das, andererseits war sie froh darüber.
Sie schwang sich auf einen Barhocker und legte die Beine übereinander. Ein unglaublich fetter Barkeeper watschelte auf sie zu. Vor dem Bauch trug er eine schmierige Schürze, die wohl schon der Küchenjunge der „Mayflower“ getragen hatte, mit der die ersten Siedler aus England kamen.
Er grinste sie unverschämt an, wobei einige schwärzliche Zahnstummel sichtbar wurden. „Was darf’s denn sein?“
„Einen Gin-Tonic, bitte.“
„Häh?“ Er beugte sich vor, und sein schlechter Atem kam wie eine Wolke zu ihr herüber. Auch die ledergekleideten Burschen hatten sich umgedreht und beobachteten sie mit gierigen Augen.
„Ich möchte einen Gin-Tonic“, wiederholte Joan lauter und zündete sich mit zitternden Fingern eine Zigarette an.
Der fette Barkeeper nahm ihre Bestellung wortlos entgegen und hatte sich bereits wieder entfernt, ehe sie ihm sagen konnte, weswegen sie hergekommen war. Jetzt hielt sie das Ganze für keine gute Idee mehr. Sie sog hastig an ihrer Zigarette und senkte den Blick.
Sie zuckte zusammen, denn plötzlich erklang eine seidenweiche Stimme dicht hinter ihrem Ohr. Sie fuhr entsetzt herum und starrte in ein dunkles Gesicht, das mit Narben und Pickeln übersät war. Einer der Lederfetischisten war von seinem Hocker geglitten und lautlos auf sie zugekommen.
Er merkte wohl, dass sie nicht verstanden hatte, und wiederholte: „Wollen wir nicht nach hinten gehen? Dort ist ein schönes ruhiges Zimmer.“
Er grinste hässlich und streckte den Arm aus.
In diesem Moment knallte der Barkeeper den Gin-Tonic auf den Tresen, sodass ein Großteil der Flüssigkeit überschwappte, und sagte: „Hau ab, Freddy, sonst gibt’s Ärger.“
Der jugendliche Ganove grinste noch stärker und wich ein paar Schritte zurück. Er hob beschwichtigend die Hand.
„Ist ja schon gut, Slim. Man wird wohl noch einen kleinen Scherz machen dürfen. Die Dame versteht das schon. Vielleicht treffen wir uns dann draußen?“
Sein Grinsen war wie weggefegt, und er blickte sie lauernd an. Ein kalter Schauerlief ihr über den Rücken.
Sie sah dankbar zu dem fetten Barkeeper. Er wischte mit einem Tuch über den Tresen und verteilte den Schmutz. Die übervollen Aschenbecher wurden wohl nur einmal täglich geleert. Der Lederjüngling hatte sich wieder unter seine Kumpane gemischt und flüsterte mit ihnen.
Sie hörte Fetzen dieser Unterhaltung und spürte plötzlich Furcht. Die Music-Box spielte nicht mehr, aber das Paar tanzte immer noch.
Der Barkeeper spülte seine Gläser, aber sie merkte, wie er sie dabei aus den Augenwinkeln beobachtete. Sie gab sich einen Ruck und winkte ihn wieder heran.
Zögernd kam er näher und blickte sie fragend an.
„Sind Sie Slim Tucker?“, fragte sie.
Auf seiner Stirn bildete sich eine steile Falte. Er wandte sich halb ab und wischte wieder über den Tresen.
„Und wenn schon. Das steht schließlich draußen an der Tür. Was wollen Sie von mir? Und wer hat Ihnen etwas von mir erzählt?“
„Sie brauchen keine Angst zu haben“, sagte sie schnell.
Er fuhr herum und lachte kurz. Dabei musterte er sie von oben bis unten. Ihr wurde im selben Augenblick bewusst, wie blödsinnig diese Bemerkung gewesen war.
„Ich meine“, fuhr sie fort, „man hat mir einen Tipp gegeben, dass Sie mir helfen können.“
„Was für einen Tipp?“, fragte er misstrauisch.
„Sie können mir Rico Manzini vermitteln“, sagte sie entschlossen und nippte an ihrem Gin-Tonic.
Slim Tucker schnippte mit den Fingern zur Music-Box, und einer der Lederjünglinge warf Münzen ein. Laute Rockmusik dröhnte durch den Raum und übertönte die Gespräche. Der Barkeeper wandte sich Joan MacLaren zu.
„Was wollen Sie denn von Rico?“, fragte er.
„Ich habe einen kleinen Job für ihn, bei dem er ein paar hundert Dollar verdienen kann.“
„Was für einen Job?“ Er grinste listig. „Rico übernimmt nur ehrliche Aufträge. Er muss auf sich aufpassen.“
„Er soll einen Mann ein paar Tage beobachten. Weiter nichts. Nur beobachten und mir dann erzählen, was dieser Mann macht. Und er soll sich dabei nicht erwischen lassen.“
„Das ist alles?“, fragte Tucker. Er wischte seine Hände an der schmutzigen Schürze ab und betrachtete sie abschätzend. „Wir lieben nämlich keine krummen Dinger.“
Sie hatte inzwischen ihre Sicherheit wiedergefunden. „Das ist alles. Bringen Sie mich nun mit Manzini zusammen oder nicht?“
Er zögerte noch einen Moment bis er sagte: „Die Vermittlungsgebühr beträgt fünfzig Dollar. Dafür, dass ich Sie mit Rico bekanntmache. Ob er dann den Job übernimmt, muss er selbst entscheiden.“
Sie biss sich auf die Lippen. Dieser Halsabschneider, dachte sie. Sie öffnete ihre Handtasche und zog fünf Zehn-Dollarnoten heraus.
Mit einem flinken Griff ließ er die Scheine unter seiner Schürze verschwinden.
„Und vier Dollar für den Drink“, sagte er und sah sie ungerührt an.
Mit einem Seufzer gab sie ihm das Geld, was ihm ein beifälliges Grinsen entlockte. Dann wandte er sich zur Seite und deutete mit der Hand in eine der dunklen Nischen.
„Dort sitzt Rico.“ Damit schlurfte er zurück zum Gläserspülen.
Joan MacLaren rutschte von ihrem Hocker und steuerte die Nische an. Sie war empört, dass Tucker ihr für eine Handbewegung fünfzig Dollar abgenommen hatte, wusste jedoch, dass es besser war, nichts zu sagen. Sie presste ihre Handtasche fest an sich, als sie die lauernden Blicke der Männer an der Bar bemerkte.
Der Mann, der an dem kleinen Tisch in der Nische saß, blickte ihr entgegen, machte aber keine Anstalten aufzustehen. Mit einem kurzen Kopfnicken deutete er auf einen der Stühle und nahm dann einen kräftigen Schluck aus seinem Bierglas.
Sie setzte sich und betrachtete Rico Mazini. Er war gewiss keine Schönheit, wenn er auch einen gewissen südländischen Charme hatte. Eine lange Narbe zog sich von seiner rechten Schläfe fast bis zum Mundwinkel hinunter. Das Nasenbein schien mehrmals gebrochen zu sein, und zwei seiner Vorderzähne fehlten. Messerstiche und Boxhiebe hatten ihn gezeichnet.
Rico Manzini war Anfang Dreißig. Sein schwarzes gelocktes Haar fiel ihm tief in die Stirn. Er trug einen relativ modischen Anzug und ein knallgelbes Halstuch.
„Sie übernehmen manchmal kleine Jobs, die vertraulich behandelt werden müssen“, begann sie.
Er winkte ab. „Ist schon gut. Wenn Slim Sie herüberschickt, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich verlasse mich auf ihn. Wir sind nämlich Partner. Was wollen Sie also von mir?“
„Ich möchte, dass Sie einen Mann beobachten. Beschatten, sagt man wohl in Fachkreisen. Nur für ein paar Tage. Ich will wissen, mit welchen Leuten er zusammenkommt und was er sonst macht, besonders am Abend.“
„Warum nehmen Sie nicht einen Privatdetektiv? Die haben feste Preise, und außerdem machen die das beruflich.“
„Ich habe meine Gründe“, sagte sie. „Im Übrigen kann ich die Plattfüße nicht leiden. Ich zahle Ihnen hundert Dollar pro Tag.“
Manzini schüttelte den Kopf. „Hundertfünfzig Dollar am Tag. Darunter mache ich es nicht. Zahlbar im Voraus.“
Joan MacLaren zögerte.
„Na gut“, sagte sie schließlich. „Ich gebe Ihnen zweihundert Dollar im Voraus und den Rest nach Erledigung des Auftrags. Das ist ein faires Angebot.“
Er nickte. „In Ordnung.“
Dann beugte er sich plötzlich vor und packte sie so hart an der Schulter, dass sie kurz aufschrie. „Was steckt dahinter, Lady? Sie brauchen keinen Mann wie mich, nur um einen anderen beobachten zu lassen.“
Er hatte sie wieder losgelassen, und sie rieb die schmerzende Stelle.
„Es kann sein, dass der betreffende Mann nicht sehr begeistert ist, wenn er merkt, dass er überwacht wird. Vielleicht versucht er, Sie unter Druck zu setzen und herauszubekommen, wer ihr Auftraggeber ist. Und das darf auf keinen Fall herauskommen. Deshalb komme ich zu Ihnen.
Manzini lehnte sich zurück und lächelte.
„So ähnlich habe ich es mir vorgestellt. Sie sind eine reizende Dame. Wenn ich nicht gefragt hätte, wären mir diese Feinheiten entgangen. Aber ich bin ein misstrauischer Mensch. Ich rieche unangenehme Dinge auf hundert Meter. Gut, kommen wir zum Geschäft. Wer ist der Mann?“
Sie kramte wieder in ihrer Handtasche und zog ein Hochglanzfoto heraus. Der Mann auf dem Bild lächelte freundlich in die Kamera. Manzini nahm das Foto in die Hand und betrachtete es lange.
„Der Mann weiß, was er will. Aber er weiß noch nichts von mir. Ich übernehme den Job.“
Fordernd streckte er die Hand aus. „Die Anzahlung, bitte.“
Sie schob das Geld über den Tisch. Anschließend nahm sie einen Zettel aus der Tasche.
„Der Name des Mannes ist John Carruthers. Hier ist die Adresse. Ich möchte, dass Sie ihn beobachten und feststellen, mit wem er sich trifft“
Manzinis Augen verengten sich. Er steckte das Geld und den Zettel ein. „Wie kann ich Sie erreichen?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich rufe Sie an. Geben Sie mir eine Nummer. In drei oder vier Tagen treffen wir uns wieder. Dann geben Sie mir einen Bericht, und Sie bekommen das restliche Geld.“
„In Ordnung. Rufen Sie bei Slim an. Nicht zu früh am Abend, denn ich bin schließlich hinter diesem Mann her. Aber Sie können mich täglich hier erreichen.“
Sie stand auf. „Es wäre natürlich gut, wenn Sie nicht auffallen. Dann wird auch nichts passieren.“
„Ich werde nicht auffallen, und ich kann mich auch wehren.“
„Dem Mann darf nichts geschehen“, sagte sie schnell. „Sie sollen ihn nur beobachten, nichts weiter. Wenn Sie entdeckt werden, beenden Sie die Überwachung sofort.“
Er grinste unverschämt. „Ist gut, Lady. Sie nehmen die Dienste eines zuverlässigen Fachmanns in Anspruch. Empfehlen Sie uns weiter.“
Sie nickte nur, drehte sich abrupt um und ging zur Tür. Sie bemühte sich, nicht zu den Männern an der Bar hinüberzusehen, deren Blicke sie in ihrem Rücken spürte. Einer glitt von seinem Hocker, aber ein scharfer Zuruf von Manzini stoppte ihn sofort.
Joan MacLaren atmete auf, als sie wieder auf der Straße stand. Sie hatte einen weiteren Zug in ihrem Spiel gemacht. Einen gefährlichen Zug.
––––––––
18.
STEVE MCCOY ERHÖHTE das Tempo. Auf dem Union Square hielt er sich rechts und bog in die Park Avenue ein. Nach einigen Querstraßen erreichte er die East 20th Street. Hier, in einem der alten Häuser am Gramercy Park, wohnte Dr. Charles Highwood.
Die alten roten und braunen Backsteinhäuser wirkten wie eine Oase der Ruhe in der hektischen Stadt. Sie umgaben den winzigen Park mit dem hohen Eisenzaun auf allen vier Seiten. Steve warf einen Blick zu Nummer 28 hinüber. Das war Theodore Roosevelts Geburtshaus. Jetzt war ein kleines Museum darin untergebracht.
Ein paar Häuser weiter wohnte der Anwalt. Steve hatte Glück und fand unmittelbar vor dem Haus einen Parkplatz. Er stieg aus, schloss ab und ging die Stufen zum Hauseingang hinauf.
Die Haustür war nicht verschlossen. Einen Portier gab es auch nicht, ebenso wenig wie einen Fahrstuhl. Man musste die ausgetretenen Treppenstufen benutzen.
Der Anwalt wohnte im ersten Stock. Steve wusste nicht, ob Highwood da war, aber er hatte sich in der Nähe aufgehalten und konnte einen nicht angekündigten Besuch riskieren.
Hinter der Wohnungstür ertönten gedämpfte Stimmen. Plötzlich hörte Steve klatschende Geräusche und einen erstickten Schmerzensschrei.
Steve erstarrte. Da stimmte etwas nicht. Er griff zum Kolben der Beretta und beugte sich zum Schlüsselloch hinunter. Es war nichts zu erkennen. Auch die Stimmen waren nicht zu verstehen. Es war nur ein undeutliches Gemurmel. Auf jeden Fall waren es mehrere Stimmen. Wieder ertönte das klatschende Geräusch. Steve hörte, dass jemand aufstöhnte.
Vorsichtig prüfte er das Türschloss – es gab nicht nach. Es war ein Sicherheitsschloss, und er hatte nichts bei sich, womit er es hätte öffnen können. Da half nur ein Trick.
Er zog die Pistole aus dem Holster, klingelte mehrmals kurz hintereinander und trat dann zur Seite, sodass man ihn nicht auf den ersten Blick entdecken konnte.
Nach dem Klingeln wurde es in der Wohnung schlagartig still. Steve hörte schleichende Schritte hinter der Tür. Der Fremde atmete rasch. Steve McCoy schob sich lautlos an der Wand nach vorn und klingelte erneut.
Er hörte die Schritte wieder in die Wohnung zurückkehren. Dann klang leises Stimmengemurmel auf. Wer auch immer in der Wohnung von Charles Highwood war – man war sich nicht einig, was geschehen sollte. Steve hoffte, dass die Leute dort drinnen glaubten, dass jemand an der Haustür klingelte.
Steve drückte wieder auf den Knopf.
Nach wenigen Sekunden war wieder jemand hinter der Tür. Steve hielt den Atem an. Er spürte, dass sich ein Schweißfilm zwischen Handfläche und Kolben bildete, und entkrampfte die Hand.
Ein schwaches Geräusch verriet, dass die Tür geöffnet wurde. Steve sah, dass sich der schmale Spalt langsam verbreiterte. Jetzt war die Zeit zum Handeln gekommen.
Mit einem gewaltigen Satz sprang Steve McCoy nach vorn und warf sich gegen die Tür. Sie wurde gegen die Wand geschmettert. Steve starrte in das verblüffte Gesicht eines der beiden Gangster, mit denen er erst kürzlich eine Auseinandersetzung gehabt hatte. Dem anderen war die Klinke aus der Hand gerissen worden, und er hatte noch nicht begriffen, was mit ihm geschah.
Steve ließ ihm keine Zeit zum Überlegen. Er holte mit dem rechten Arm aus und schlug zu. Der Lauf der Waffe traf die Schläfe des Gangsters. Die Haut platzte auf, und ein dünner Blutfaden lief über das Gesicht.
Der wuchtige Hieb hatte den Gangster gegen die Wand geschleudert, und seine Abwehrreaktion ging ins Leere.
„Bill!“, brüllte er.
Steve schlug ihm die Linke in die kurzen Rippen, und der andere rutschte zu Boden.
Zu spät sah Steve die Bewegung hinter sich. Ein Schatten warf sich auf ihn. Mit abgewinkeltem Arm fing Steve den Fausthieb ab, drehte sich um seine Achse und ließ wieder seine Linke kommen. Sie traf nicht den Punkt, verschaffte ihm aber Luft.
Den nächsten Angriff stoppte er, indem er den Pistolenlauf dem Gangster gegen den Kehlkopf hielt.
„Schluss jetzt!“, rief er. „Sonst knallt’s.“
Für einen Sekundenbruchteil achtete er nicht auf den Ersten. Er spürte einen harten Schlag gegen seinen Unterarm. Die Beretta flog in die Garderobe, und die beiden Gangster huschten flink wie die Wiesel aus der Wohnung.
Steve hörte sie die Treppe hinunterpoltern. Er hob seine Waffe auf und lief nach hinten.
Mitten im Wohnzimmer saß Dr. Charles Highwood auf einem kostbaren Holzstuhl, an den er mit einem dicken Strick gefesselt war. Seine rechte Augenbraue war aufgeplatzt, und aus seiner Nase lief Blut. Die beiden hatten ihn fachmännisch zusammengeschlagen.
Steve lief zum Fenster und blickte die Straße entlang. Die zwei laufenden Gestalten waren nicht zu übersehen. Sie stiegen in einen Dodge und fuhren hastig aus der Parklücke, wobei sie wenig Rücksicht auf die Stoßstangen der vor und hinter ihnen parkenden Wagen nahmen.
Steve prägte sich das Kennzeichen ein und nickte nachdenklich. Die beiden würde er wiederfinden.
Er steckte die Pistole ein und trat zu dem Anwalt. Er beugte sich über ihn und löste die Fesseln. Highwood sah ihn aus geschwollenen Augen deprimiert an.
„Wie ist das passiert?“, erkundigte sich Steve.
Highwood massierte sich die Handgelenke, nachdem die Fesseln gefallen waren. Er zuckte mit den Schultern. „Die beiden haben geklingelt, und ich habe aufgemacht. So einfach war das.“
Er ging zu seiner Hausbar hinüber, goss sich Whisky ein und schüttete ihn hinunter. „Das tut gut. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Ich weiß nicht, was die beiden sonst noch mit mir angestellt hätten. Ich hatte Angst.“
Steve nickte. „Das kann ich verstehen. Aber die müssen doch irgendwas von Ihnen gewollt haben.“
Highwood goss sich noch einen Drink ein. „Das haben sie auch. Aber ich habe es nicht begriffen. Einer von ihnen sagte ständig, dass ich mir einen Urlaub verdient hätte und dringend die Stadt verlassen müsste. Am besten schon morgen. Sie wollten mich dazu überreden, für einige Wochen aus New York zu verschwinden. Und der Aufforderung haben sie Nachdruck verliehen.“
„Das verstehe ich schon“, meinte Steve. „Ich bin mit den beiden bereits einmal zusammengestoßen. Es sind zwei primitive Schläger. Ich werde sie wiederfinden und aus dem Verkehr ziehen. Hat man Ihnen gedroht?“
Der Anwalt tupfte sich mit einem Taschentuch über das Gesicht, doch die Blutung hatte bereits aufgehört.
„Sie haben gesagt, dass sie morgen wiederkommen wollen, um festzustellen, ob ich noch da bin. In diesem Zusammenhang haben sie finstere Drohungen ausgestoßen.“
„Die waren auch ernstgemeint“, erläuterte Steve. „Der Auftraggeber der beiden muss sehr daran interessiert sein, Sie aus dem Verkehr zu ziehen.“
„Aber warum?“, fragte Highwood.
„Das ist doch nicht so schwer zu begreifen“, meinte Steve. „Es hängt alles mit dem Fall MacLaren zusammen. Ihre Theorie ist richtig. Hier versucht irgendein unangenehmer Zeitgenosse, unseren Freund zu belasten und aus dem Weg zu räumen. Auf sehr elegante Art und Weise. Da aber bei der Polizei noch gewisse Zweifel bestehen, versucht der Unbekannte, MacLarens Verbündete auszuschalten. Denn ohne Unterstützung von außen ist der Politiker natürlich hilflos.“
Highwood nickte. „Das scheint mir eine plausible Theorie zu sein. Das heißt mit anderen Worten, der Unbekannte wird nervös. Sein raffinierter Plan ist durchkreuzt worden. Er wird Fehler machen.“
„Ja. Und er ist nicht allein. Da sind diese beiden kleinen Ganoven. Außerdem mischt noch ein Dritter mit, mit dem ich einmal aneinandergeraten bin. Er ist gefährlich, wahrscheinlich ein Berufskiller. Aber eine dieser Spuren wird uns zu dem Unbekannten führen. Was wir brauchen, ist Zeit.“
„Die kann ich Ihnen verschaffen“, sagte der Anwalt. „Ich kenne eine Menge Tricks, um die Anklageerhebung hinauszuzögern. In diesem Fall, in dem die Gegenseite nur über Indizien verfügt, ist das keine große Schwierigkeit.“
„Gut!“ Steve nickte. „Ich glaube, unsere Marschrichtung ist jetzt klar. Ich kümmere mich um unsere Gegner, und Sie sorgen dafür, dass ich nicht gegen die Zeit kämpfen muss. Ich muss mich auch noch mit MacLarens Frau und seinen Bekannten und Freunden unterhalten. Irgendwo werde ich Hinweise finden. Hinter allem steckt jemand, der MacLaren genau kennt und der vor allem ein gutes Motiv hat.“
Highwood lächelte. „Sie sollten sich intensiver um seine Frau kümmern. Ich bin sicher, dass sie mehr weiß, als sie Ihnen bisher gesagt hat. Sie spielt ihr eigenes Spiel.“
Steve sah den Anwalt nachdenklich an. „Sie verschweigen mir doch nichts, oder etwa doch?“
Highwood schüttelte den Kopf. „Nein. Ich habe nur einen gewissen Verdacht. Aber Sie müssen selbst dahinter kommen. Das ist mir lieber.“
„Das werde ich. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Rufen Sie mich an, wenn Sie irgendetwas erfahren. Und lassen Sie niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen.“
„Wird schon gutgehen. Viel Erfolg.“
Sie schüttelten sich die Hände.
––––––––
19.
RICO MANZINI STARRTE auf den Zettel und runzelte die Stirn. Er stand vor einem gepflegten Brownstone-Haus in der 63th Street East. Ein Baldachin war über den Bürgersteig gespannt, und zu beiden Seiten des Eingangs standen hohe Blumenkübel.
Rico marschierte auf den Eingang zu und studierte die Namensschilder an der Seite. John Carruthers wohnte tatsächlich hier. Vorsichtig warf er einen Blick in das Foyer des Hauses. Hinter einem kleinen Tresen saß ein Pförtner und blätterte in einer Zeitschrift.
„Wissen Sie zufällig, ob Mister Carruthers im Haus ist?“
Der Portier ließ die Zeitschrift sinken und starrte ihn an. „Was wollen Sie denn von ihm?“
Rico lächelte böse. „Das geht wohl nur ihn und mich etwas an.“
„Wir dürfen niemanden hereinlassen, den wir nicht kennen oder der nicht angemeldet ist. Wenn Sie einen Termin hätten, würden Sie auf meiner Liste stehen. Wenn nicht ...“ Der Portier machte eine unbestimmte Handbewegung.
Manzini wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Schließlich hatte seine Auftraggeberin verlangt, dass er sich unauffällig verhalten sollte. Also dreht er sich um und marschierte wieder aus der Tür.
Der Portier sah ihm kurz nach und griff zum Telefon.
Manzini stieg in seinen Wagen, der er schräg gegenüber geparkt hatte. Zu dieser späten Stunde gab es immerhin einige freie Plätze. Er schwang sich hinter das Steuer und richtete sich auf eine längere Wartezeit ein. Vielleicht hatte der Mann, den er beobachten sollte, noch eine Verabredung zum Essen. Ein mögliches Treffen in einer Bar wäre ihm allerdings lieber gewesen, denn er verspürte das Verlangen nach einem ordentlichen Drink.
Die leichte Bewegung hinter dem Vorhang an einem der Fenster des zweiten Stockwerks bemerkte er nicht.
––––––––
20.
SABATO, DER KILLER, dessen richtigen Namen niemand kannte, lag lang ausgestreckt auf seinem Bett in dem kleinen schmutzigen Hotel in der Nähe des Grand Central Terminal. Er hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt und dachte nach.
Es gab einige Dinge, die ihn irritierten. Dinge, die sich anders entwickelten, als es vorgesehen war.
Und das liebte er nicht. Seine Spezialität waren Jobs, bei denen es keine Spuren gab und keine Mitwisser außer dem Auftraggeber. Doch diesmal war alles anders. Es gab eine ganze Menge Leute, die mit dieser Sache zu tun hatten. Jeder einzelne von ihnen erhöhte das Sicherheitsrisiko.
Sabato machte sich keine Illusionen. Sein Beruf war gefährlich. Eines Tages machte er vielleicht einen Fehler. Aber dieser Tag sollte so weit wie möglich in der Zukunft liegen.
Das Schrillen des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. Er zögerte einen Moment, ehe er den Hörer abnahm und sich mit einem halblauten „Hallo“ meldete.
„Sind Sie das, Sabato?“, fragte eine Stimme am anderen Ende, die er genau kannte.
„Ja. Wer sonst?“, knurrte er unwillig. „Sie wissen genau, dass Sie mich unter dieser Nummer nur in Notfällen anrufen dürfen.“
„Der Notfall ist eingetreten“, sagte die Stimme am anderen Ende hastig. „Ich werde seit kurzer Zeit beobachtet. Ich weiß nicht, wie lange das schon geht, aber heute habe ich es bemerkt. Ein einzelner Mann. Südländischer Typ.“
„Was hat er getan?“, fragte Sabato.
„Er hat in meinem Haus nach mir gefragt, und jetzt sitzt er in einem Auto auf der anderen Straßenseite.“
„Ist er wirklich allein?“
„Ja. Ganz bestimmt. Ich hätte es gemerkt, wenn noch ein anderer in der Gegend herumschleichen würde.“
„Beschreiben Sie ihn näher“, sagte Sabato.
Die Stimme am anderen Ende zögerte. „Na, ja. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich sagte schon, dass er ein südländischer Typ ist. Schlank, dunkle Gesichtsfarbe, schwarze Haare. Auffällig ist ein grellgelbes Halstuch. Er ist mittelgroß und sonst nicht sehr auffällig.“
„Was für einen Wagen hat er?“
„Sein Wagen? Ach ja. Ein Chevrolet, ein ziemlich altes Modell. Dunkelgrün. Die Nummer habe von hier oben nicht sehen können.“
Sabato lächelte schwach, „Ihre Angaben sind äußerst präzis. Sie treffen wahrscheinlich auf einige tausend New Yorker zu.“
„Ach, Quatsch!“, sagte sein Gesprächspartner. „Schaffen Sie mir den Kerl vom Hals, und zwar schnell. Sie wissen genau, dass ich zurzeit keine Beobachter gebrauchen kann. Und berechnen Sie mir für einen solchen Fall nicht gerade den Höchstsatz.“
Damit legte er auf.
Sabato behielt den Hörer noch ein paar Sekunden in der Hand. Seine Wangenmuskeln zuckten, und seine Augen hatten sich dunkel gefärbt. Da waren sie schon wieder, diese unerwarteten Schwierigkeiten in diesem Fall! Sein ungutes Gefühl verstärkte sich immer mehr.
Er musste noch vorsichtiger werden und sich seine Schritte sehr genau überlegen. Es interessierte ihn wahrlich nicht, ob er einen Mann mehr oder weniger ausschaltete. Den unbekannten Beobachter aus dem Verkehr zu ziehen, traute er sich ohne Weiteres zu.
Aber was ihm gar nicht gefiel, war, dass sein Auftraggeber offenbar nicht völlig abgeschirmt war. Irgendjemand hatte Verdacht geschöpft. Und wenn sein Auftraggeber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen entlarvt wurde, war auch er, Sabato, nicht mehr sicher. Das musste um jeden Preis verhindert werden.
Er ließ den Hörer auf die Gabel sinken und stand auf. Es war Zeit, seinen Entschluss in die Tat umzusetzen.
Er nahm seinen alten abgewetzten Lederkoffer aus dem Schrank und klappte ihn auf, nachdem er ihn auf das Bett gelegt hatte. Das Geheimfach war für einen Nichteingeweihten nicht zu erkennen. Oft musste er den Inhalt des Geheimfachs vor neugierigen Augen schützen. Zum Beispiel beim Übertreten einer Grenze. Oder bei Kontrollen in Flughäfen.
Er löste die unsichtbaren Verschlüsse, griff in das Fach und holte einige Gegenstände heraus, die er auf dem Bett ausbreitete: eine automatische FN-Pistole, Kaliber 9 mm Para, einen Schalldämpfer, ein Reservemagazin, eine Schulterstütze, die am Kolben befestigt wurde, und eine Schachtel Patronen.
Sorgfältig lud er das dreizehnschüssige Magazin. Danach schraubte er den Schalldämpfer auf und überprüfte die Waffe. Die Mechanik funktionierte einwandfrei. Er schob das Magazin in das Griffstück und lud die Pistole durch.
In einer Spezialtasche seines Sakkos verschwand die Waffe. In einer anderen Tasche versenkte er Schulterstütze und Ersatzmagazin.
Er war bereit.
Er verschloss den Koffer wieder und schob ihn in den Schrank. Anschließend nahm er den Mantel über den Arm, setzte eine Mütze auf, trank noch einen Schluck Milch aus dem Glas auf seinem Nachttisch, löschte das Licht und verließ das Zimmer.
Sorgfältig schloss er ab.
Absichtlich nahm er die Treppe. Unten überprüfte er kurz seinen Pulsschlag, aber er war völlig ruhig. Er hätte sich gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Schnell verschluckte ihn die Nacht.
––––––––
21.
STEVE MCCOY STAND AM Fenster seines Arbeitszimmers und blickte auf die Straße unter ihm. Selbst zu dieser späten Stunde flutete der Verkehr in beiden Richtungen.
Er drehte sich um und ging zu seinem Schreibtisch, auf dem ein Stapel Zeitungsausschnitte lag. Ein alter Freund in der Redaktion der New York Times hatte sie ihm heute besorgt. Eines hatten all diese Berichte gemeinsam: Sie beschäftigten sich mit Kevin MacLaren.
Steve hatte zwei Stunden gebraucht, bis er alle Artikel durchgesehen hatte. Er wusste jetzt eine Menge über den Politiker, der wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft saß und von dessen Unschuld er überzeugt war. Denn beim Lesen hatte er einige bemerkenswerte Informationen erhalten.
Kevin MacLaren war nicht der Einzige, der Nachfolger von Senator Joseph Clark werden wollte. Er hatte seit Jahren einen politischen Gegner, der bei jeder Gelegenheit gegen MacLaren antrat. Dabei waren die beiden vor langer Zeit Freunde gewesen.
Außerdem kannte MacLarens Frau seinen Gegenspieler gut. Beide hatten sich damals um sie beworben – MacLaren hatte das Rennen gemacht.
Steve nahm einen der Ausschnitte in die Hand. Da war er!
John Carruthers. Etwa im selben Alter wie MacLaren. Ein wenig bulliger und kräftiger. Steve prägte sich das Bild gut ein. Das entschlossene Gesicht mit dem kantigen Kinn wirkte selbstbewusst. Ein Mann, der seinen Weg ging.
Steve beschloss, sich diesen Carruthers näher anzusehen. Er musste sich von diesem Mann ein Bild machen, um ihn in das Puzzle, das allmählich entstand, einordnen zu können.
Nachdem, was er über ihn gelesen hatte, konnte Carruthers der Mann sein, der ungewöhnliche Wege ging, um sein Ziel zu erreichen.
Allerdings, Mord gehörte bisher nicht unter die Methoden, die dieser Mann anwandte. Aber Methoden konnten sich ändern.
Steve sah auf seine Uhr. Es war noch Zeit für einen späten Besuch. Die Adresse hatte er bereits herausgesucht. Von seinem Haus aus konnte er es über die Brooklyn-Bridge in einer guten halben Stunde schaffen Er warf einen letzten Blick auf das Foto in der Zeitung und verließ den Raum.
––––––––
22.
RICO MANZINI KLAPPTE den Kragen hoch. Es wurde allmählich kühl. Auch die Dunkelheit behagte ihm nicht. In dieser ruhigen Wohngegend brannten die Straßenlaternen nur in größeren Abständen. Das hatte zwar gewisse Vorteile, aber dennoch beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl.
Seit zwei Stunden stand er nun hier, und es hatte sich nichts ereignet. Der Mann, den er beobachten sollte, war offensichtlich zu Hause und hatte sich noch nicht gezeigt. Als es dunkel wurde, war hinter einigen Fenstern Licht angeschaltet worden. Das war alles.
Rico überlegte, ob es eine Möglichkeit gab, in das Haus einzudringen. Schließlich verwarf er diesen Gedanken wieder und beschloss, sich eine Zeitlang die Beine zu vertreten. Der Verkehr war abgeflaut, und nur noch wenige Fahrzeuge fuhren durch die Straße.
Plötzlich hörte er das Geräusch eines näherkommenden Wagens, der ziemlich langsam fuhr. Rico blieb stehen und starrte dem Auto entgegen. Er wich langsam zurück, bis er im Schatten eines Baumes stand. Der Wagen, ein Camaro, kam immer näher.
Rico hielt den Atem an, als das Fahrzeug vor dem Haus, in dem sein Zielobjekt wohnte, stehenblieb. Jetzt wurde es endlich interessant. Er drückte sich tiefer in den Schatten und bedauerte, dass er nicht näher herangehen konnte. Aber er dachte nicht daran, das kleinste Risiko einzugehen. In diesem Fall hielt er sich strikt an die Vorschriften seiner Auftraggeberin.
Aus dem Wagen stieg ein hochgewachsener und gut gekleideter Mann von schlanker Statur. Rico kannte ihn nicht und versuchte, sich das Bild des Fremden einzuprägen. Vielleicht konnte seine Auftraggeberin etwas damit anfangen.
Der Fremde ging auf den Eingang zu, zögerte und blickte sich nach allen Seiten um. Schließlich bewegte er sich weiter und stieß die Eingangstür auf. Rico sah, dass der Fremde durch das hell erleuchtete Foyer ging und mit dem Pförtner sprach. Es dauerte einige Minuten und einen längeren Wortwechsel, bis der der Neuankömmling die breite Treppe emporstieg.
Rico stieß den Atem aus und ging auf den Camaro zu und beschloss, die Nummer zu notieren. Auf diese Weise konnte er vielleicht feststellen, wer der Fremde war.
Als er sein Notizbuch herauszog, hörte er die Schritte. Langsam und gemessen kam jemand die Straße entlang. Rico blickte sich um – und erkannte die Umrisse einer dunklen Gestalt, die keine dreißig Meter entfernt war. Die Schritte waren verstummt, und der drohende Schatten rührte sich nicht.
Rico spürte, dass eine eisige Hand nach seinem Herzen griff, und ihn plötzlich eine entsetzliche Angst überkam.
Einige Sekunden konnte er sich kaum rühren, und diese Zeit erschien ihm wie eine Ewigkeit. Er verfluchte seinen Leichtsinn. Er hatte keine Waffe bei sich. Dann versuchte er, sich wieder zu beruhigen. Der Schatten dort drüben bewegte sich überhaupt nicht!
Vielleicht hatte die Person genauso viel Angst wie er. In dieser stillen Straße um diese Zeit! Rico bemühte sich zu grinsen, er brachte jedoch nur eine Grimasse zustande. Er war ein Feigling, und er wusste es.
Langsam trat er den Rückweg an. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er musste nur seinen Wagen erreichen, dann war er in Sicherheit. Verdammt noch mal, diese paar Meter musste er schaffen, ohne dass er einen Herzschlag bekam.
Rico riskierte einen vorsichtigen Blick über die Schulter. Der Schatten folgte ihm in gleichmäßigem Abstand.
Er begann zu laufen, stolperte und fing sich ab. Sein Verfolger – er zweifelte nicht mehr daran, dass es ein Verfolger war – hatte die Distanz verringert.
Gehetzt blickte Rico sich um. Als sein Verfolger in den Schein einer Laterne kam, erkannte er, dass es ein Mann war. Ziemlich groß und sehr schlank. Er trug nichts bei sich und hatte die Hände in den Taschen vergraben.
Rico war nur noch zehn Meter von seinem Wagen entfernt. Er würde es schaffen. Sein Verfolger war immer noch ein ganzes Stück hinter ihm.
In diesem Augenblick hatte er noch genau dreiundzwanzig Sekunden zu leben, aber das wusste er natürlich nicht.
Rico Manzini hatte den Wagen erreicht und bemühte sich mit zitternden Fingern, das Türschloss aufzubekommen. Er riskierte noch einen ängstlichen Blick zurück.
Sein Verfolger war stehengeblieben. Rico sah, dass er mit irgendeinem Gerät hantierte, dass er auf diese Entfernung nicht erkennen konnte.
Endlich hatte er die Tür geöffnet. Als er sich in den Wagen schwingen wollte, sah er das Aufblitzen des Mündungsfeuers. Und das war so ziemlich das Letzte, was er in seinem Leben sah.
Für den Bruchteil einer Sekunde wunderte er sich darüber, dass er keinen Schuss hörte. Den Schalldämpfer sah er schließlich nicht.
Dann registrierte er den Schmerz in seiner Brust. Er spürte ein Frösteln und gleichzeitig Hitze, ausgehend von der Stelle über seinem Herzen, wo ihn die Kugel getroffen hatte.
Er schwankte, und seine Hand löste sich langsam vom Wagendach. Für einen Moment stand sein Körper noch aufrecht, gehalten von der geöffneten Tür. Dann rutschte er langsam in den Straßenstaub.
Auf diese Entfernung mit einer Pistole, dachte er. Ein guter Schütze. Schwarzer Nebel hüllte ihn ein. Ein letztes Zittern durchlief seine verkrümmte Gestalt. Rico Manzini, ein kleiner Ganove mit großen Träumen, war tot.
––––––––
23.
JOHN CARRUTHERS ÖFFNETE selbst. Steve erkannte ihn selbst nach den schlechten Zeitungsbildern sofort.
Carruthers sah seinen späten Besucher erstaunt an.
„Ja?“, fragte er vorsichtig und höflich. „Man hat mir gesagt, dass es außerordentlich wichtig sei. Es ist schon ziemlich spät für einen Besuch.“
„Mein Name ist Steve McCoy. Ich bearbeite einen Mordfall und würde gern ein paar Worte mit Ihnen wechseln.“
„Polizei?“
„Nein.“
„Dann weiß ich nicht, über welchen Mordfall wir uns unterhalten sollten.“ Die Stimme war etwa zehn Grad kälter geworden und lag jetzt kurz über dem Gefrierpunkt.
„Barbara MacLaren“, sagte Steve langsam.
Mit dem Gesicht von John Carruthers ging eine Veränderung vor. Seine Verbindlichkeit war wie weggeblasen. Er musterte Steve drohend und öffnete die Tür ein Stück weiter.
„Kommen Sie herein, wenn es nicht zu lange dauert. Meine Zeit ist sehr begrenzt, wie Sie sich vielleicht denken können.“
„O, es liegt an Ihnen, wie lange es dauert“, sagte Steve lächelnd und betrat die Wohnung.
Sie war mit Geschmack und viel Geld eingerichtet worden. Das große Wohnzimmer an der Rückfront schien dem Katalog eines teuren Einrichtungshauses nachgestaltet worden zu sein. Alle Einzelheiten waren aufeinander abgestimmt. Nur eines vermisste Steve: Die persönliche Note. Alles wirkte ein bisschen kalt. Aber damit passt sie zu dem Bewohner, dachte er.
Carruthers deutete mit einer kreisenden Handbewegung auf die zahlreichen Sitzgelegenheiten.
„Nehmen Sie Platz, wo Sie wollen. Einen Drink?“
Steve schüttelte den Kopf. „Nein, danke. Es wird nicht lange dauern, und ich muss auch noch fahren.“ Er ließ sich in einen lederbezogenen Sessel englischer Herkunft sinken.
Carruthers zündete sich eine Zigarette an. Er blickte an Steve McCoy vorbei.
„Wie war das mit Barbara MacLaren, Mister McCoy? Ich nehme an, Sie wollten mich mit diesem Namen neugierig machen.“
„Sie wissen sicher, dass Kevin MacLaren in Untersuchungshaft sitzt“, begann Steve. „Es gibt viele Anzeichen, dafür, dass man ihn zu Unrecht verdächtigt.“
Carruthers fuhr herum.
„Wer sagt das? Die Polizei? Oder ist das Ihre persönliche Ansicht? Im Übrigen möchte ich wissen, weshalb Sie darüber mit mir sprechen wollen.“
„Das hat einen plausiblen Grund“, meinte Steve. „Sie stehen sowohl mit MacLaren als auch mit seiner Frau in enger Beziehung. Die eine Beziehung ist mehr beruflicher Natur, die andere mehr – nun ja, ich glaube, das brauchen wir nicht im Einzelnen zu erörtern. Da Sie aber die einzige Person sind, auf die das zutrifft, wollte ich gern mit Ihnen reden.“
„Und was haben Sie davon?“, fragte Carruthers mit leiser Stimme.
„Ich kann mir ein besseres Bild machen“, antwortete Steve.
Carruthers drückte mit einer heftigen Bewegung seine Zigarette in einem Aschenbecher aus.
„Sie haben jetzt lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Sagen Sie mir endlich, was Sie eigentlich von mir wollen. Sie sind doch sicher nicht hergekommen, um dunkle Andeutungen zu machen.“
„Ich glaube“, sagte Steve langsam, „dass Sie in irgendeiner Weise mit dieser Sache zu tun haben.“
Carruthers erstarrte und sah ihn lange an.
„Wollen Sie damit behaupten, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Kevin MacLaren im Gefängnis sitzt?“, fragte er schließlich.
Steve McCoy zuckte leicht mit den Schultern und stand auf. „Das kann ich im Augenblick nicht sagen, da ich es nicht beweisen kann. Aber Sie können sicher sein, dass ich die Zusammenhänge noch aufdecken werde.“
Carruthers war ebenfalls aufgestanden. Seine Stimme zitterte vor unterdrückter Wut.
„Diese ungeheuerliche Anschuldigung werden Sie noch bereuen. Ich werde alles in Bewegung setzen, um Sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und Sie können mir glauben, dass ich als Politiker ausgezeichnete Verbindungen zu allen Behörden habe. Sie werden in dieser Stadt keine Chance mehr haben.“
Steve verbeugte sich leicht. „Tun Sie, was Sie für richtig halten. Aber seien Sie vorsichtig in der Auswahl Ihrer Mittel.“
Carruthers folgte Steve zur Tür.
„Ich finde schon allein hinaus“, sagte Steve und zog die Tür auf. Er wandte sich noch einmal halb um. „Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Mister Carruthers. Wir werden uns aber sicher noch begegnen.“
Der Politiker antwortete nicht und starrte ihn mit gerunzelter Stirn an. Dann schmetterte er die Tür ins Schloss.
––––––––
24.
STEVE GING LEISE PFEIFEND auf die Straße. Der Besuch hatte sich gelohnt. Carruthers war jetzt so verunsichert, dass er handeln musste. Und dabei würde er Fehler machen. Der Fuchs war aus seinem Bau gelockt. Steve war überzeugt davon, dass der Politiker sehr tief in den Fall verwickelt war, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass Carruthers ein Killer war.
Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Von fern drang Straßenlärm herüber, wie durch Watte gefiltert.
Steve sah sich schnell nach beiden Richtungen um. Als er das Haus betrat, hatte dort ein Mann gestanden, der ihn aufmerksam beobachtet hatte. Steve hatte ihn sofort bemerkt, bevor der andere sich in den Schatten eines Baumes gedrückt hatte.
Er blickte zu seinem Camaro, der wenige Schritte entfernt an der Bordsteinkante stand. Es war nichts Verdächtiges zu sehen. Aber Steve war vorsichtig. Es war schließlich nicht auszuschließen, dass ihn ein unangenehmer Zeitgenosse aus dem Weg räumen wollte. Er dachte an die Bombe im Wagen des Senators Joseph Clark.
Vorsichtig näherte er sich dem Wagen und inspizierte ihn von allen Seiten. Türen, Kofferraum und Motorhaube waren intakt. Er beugte sich hinunter und blickte unter den Wagenboden. Auch hier war alles in Ordnung. Die Zeit war zu kurz gewesen, als dass jemand eine Sprengladung an die Zündvorrichtung hätte koppeln können.
Steve sah sich wieder nach allen Seiten um. Er hatte ein unbehagliches Gefühl, ohne zu wissen, warum. Und das störte ihn.
Schließlich heftete sich sein Blick auf das Heck des Wagens, der in einiger Entfernung stand, dort, wo der Beobachter gestanden hatte. Plötzlich wusste er, was ihn störte.
Die Fahrertür stand offen, und außerdem brannte die Innenbeleuchtung. Das war vorhin nicht der Fall gewesen. Und er wusste genau, dass der Wagen schon dort gestanden hatte, als er angekommen war.
Langsam ging er die Straße hinunter. In dem Fahrzeug war niemand zu sehen. Steve blieb stehen und lockerte die Beretta im Holster an der Hüfte, ohne sie herauszuziehen.
Es blieb alles ruhig. Er ging weiter.
Dann beschleunigte er seine Schritte plötzlich. Neben der geöffneten Autotür lag jemand auf der Straße.
Steve beugte sich über den Liegenden. Der Mann war tot, daran gab es keinen Zweifel. Der Oberkörper war halb unter den Wagen gerutscht und lag in einer riesigen Blutlache.
Steve hob den Körper ein Stück an, bis er das Gesicht sehen konnte. Der Mann war ihm völlig unbekannt. Vorsichtig ließ er ihn wieder zurücksinken und trat zurück.
Direkt an der Ecke stand eine Telefonzelle. Er rief das Police Department an und verlangte die zuständige Mordkommission. Schließlich hatte er einen mürrischen Beamten in der Leitung, der versprach, sofort alles in die Wege zu leiten.
„Und schicken Sie bitte Lieutenant Anderson hierher“, sagte Steve vorsichtshalber ein zweites Mal.
„Der ist für diesen Bezirk nicht zuständig“, antwortete der Beamte nach einer kurzen Pause.
„Das weiß ich“, sagte Steve. „Aber ich glaube, dass dieser Mord mit einem anderen Fall zusammenhängt, den der Lieutenant gerade bearbeitet.“
„Woher wollen Sie das so genau wissen?“ Die Stimme klang plötzlich sehr misstrauisch.
„Ich bin Hellseher“, erklärte Steve kurz und hängte ein. Er war sicher, dass der Lieutenant kommen würde.
Wenig später wurde die Straße von den kreisenden Rotlichtern der Polizeifahrzeuge auf gespenstische Art erleuchtet. Zwei Scheinwerfer wurden angeschlossen, und deren gleißendes Licht verwandelte die unwirkliche Szene in einen richtigen Tatort.
Ein halbes Dutzend Kriminalbeamte bewegten sich um den Wagen mit dem Toten und suchten nach Spuren. Ein Fotograf machte seine Aufnahmen, und über der Leiche hockte der zuständige Pathologe.
Ein paar Schritte abseits stand Steve McCoy, die Hände in den Taschen vergraben. Er hatte sich gegenüber Lieutenant Anderson mit seinem Ausweis des Justizministeriums ausgewiesen, den er für solche Fälle bei sich trug. Anderson kaute genüsslich an einem dick belegten Sandwich.
„Sie hätten mir bei unserem ersten Treffen schon sagen können, für wen sie ermitteln. Dann hätte ich nicht so lange über Sie nachdenken müssen.“
„Etwas Nachdenken kann ja nicht schaden“, bemerkte Steve etwas spitz.
Neben dem Wagen stand der Leiter der zuständigen Mordkommission, dessen Namen Steve nicht verstanden hatte. Er gab seine Anweisungen und fuchtelte mit den Armen.
„Bitte?“, fragte Steve irritiert. Er hatte nicht zugehört.
„Haben Sie den Mann gekannt?“, wiederholte Anderson.
„Nein.“ Steve schüttelte den Kopf. „Ich glaube nur, dass dieser Mann nicht zufällig an dieser Stelle ermordet wurde.“
„So? Und weshalb glauben Sie das?“ Anderson biss wieder ein großes Stück von seinem Sandwich ab.
„Als ich kam, um Carruthers zu besuchen, war er schon hier. Der Wagen parkte an derselben Stelle, und der Mann beobachtete das Haus des Politikers – und mich natürlich auch. Ich kann es nicht beschwören, dass der Tote dieser Mann war, aber der Verdacht liegt nahe.“
„Haben Sie Carruthers besucht?“, fragte Anderson freundlich, ohne den Blick von der erleuchteten Szene zu wenden.
„Warum nicht? Es gibt nicht allzu viele Spuren in diesem Fall.“
„In welchem Fall?“ Anderson wandte ruckartig den Kopf und hörte auf zu kauen.
„Lieutenant Anderson“, sagte Steve. „Die Polizei hat ihre Methoden, und ich habe meine. Und ich glaube, dass dieser Mord mit einem Fall zusammenhängt, den ich gerade bearbeite. Da die Polizei in dieser Sache anderer Ansicht ist, habe ich gewisse Hemmungen, mich Ihnen anzuvertrauen.“
„Sie sprechen von MacLaren“, sagte Anderson langsam. „Und Carruthers. So weit, so gut. Aber was hat dieser Tote damit zu tun?“
Steve zuckte mit den Schultern. „Überlassen Sie Ihrem Kollegen doch den Fall. Er ist schließlich der Boss hier. Ich kann nicht beweisen, dass der Tote der Mann ist, der mich beobachtet hat. Und ich weiß auch nicht, weshalb man ihn ermordet hat. Aber ich bin mir sicher, dass es Zusammenhänge zwischen Kevin MacLaren, Carruthers und diesem Toten gibt.“
Anderson sah ihn ernst an. „Und weiter?“
„Nichts weiter. Deswegen habe ich Sie herbitten lassen. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.“ Er ließ den Lieutenant stehen und trat zu dem Wagen.
Der Tote wurde gerade in einen Zinksarg gehoben, und die Polizisten standen in einem dichten Pulk zusammen.
Steve stellte sich einfach zu der Gruppe, was niemanden zu stören schien. Die Leute hatten sich an seine Anwesenheit am Tatort bereits gewöhnt. Er merkte, dass auch Anderson nähertrat.
„Fassen wir zusammen“, sagte der Leiter der Mordkommission gerade. „Der Tote heißt Rico Manzini und wurde durch einen einzigen Schuss aus mittlerer Entfernung getötet. Die Tat geschah erst kürzlich. Er wurde getroffen, als er in seinen Wagen steigen wollte. Ansonsten haben wir weder einen Hinweis auf den Täter noch auf das Motiv. Oder gibt es irgendwelche Spuren?“
„Keine Patronenhülsen oder weitere Einschüsse“, sagte einer der Polizisten. „Es muss sich um einen sehr guten Schützen handeln.“
„Dann müssen wir die Ergebnisse des Labors abwarten. Fragen Sie jetzt die Leute in den benachbarten Häusern, ob sie den Schuss gehört oder sonst irgendetwas bemerkt haben.“
„Das hat keinen Sinn“, sagte Steve zu Anderson. „Den Schuss hat mit Sicherheit niemand gehört. Ich war schließlich auch nicht weit weg und hätte bestimmt reagiert. Außerdem kann ich genau die Tatzeit bestimmen. Ich war höchstens eine Viertelstunde bei Carruthers.“
Anderson winkte ab. „Verwirren Sie meinen Kollegen nicht mit Ihren Vermutungen. Er hat’s schon so schwer genug.“
Steve verstand den Hinweis und lächelte leicht. Mit diesem dicken Polizisten ließ sich zusammenarbeiten.
„Sind Sie der Mann, der den Toten gefunden hat?“
Steve drehte sich um. Der Leiter der Mordkommission stand vor ihm und wippte auf den Fußspitzen. Er hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
„Ja, ich habe ihn gefunden.“
„Ihren Namen und Ihre Anschrift bitte!“
Steve sagte es ihm und zeigte seinen Ausweis.
„Haben Sie etwas gesehen oder gehört, das uns weiterhilft?“
Steve schüttelte den Kopf. „Nein, nichts. Ich war zu Besuch bei einem Bekannten – mein Wagen parkt noch vor der Tür – und sah den erleuchteten Wagen stehen. Ich bin darauf zugegangen und habe ihn gefunden.“
Der Polizist betrachtete den Ausweis, als sei er ein gefährliches Insekt. Er hatte seinen Namen erneut genannt, aber Steve hatte ihn wieder nicht verstanden.
„Haben Sie eine Waffe?“
„Ja.“ Steve griff zum Holster und holte die Beretta heraus. Die Lizenz reichte er gleich nach.
Der Beamte prüfte alles gründlich und musterte ihn misstrauisch.
„Vielleicht ist es doch besser, wenn Sie mit auf’s Revier kommen“, sagte er schließlich.
Anderson mischte sich ein. „Das ist sicher nicht notwendig. Ich kenne den Mann. Er wird morgen freiwillig zu Ihnen kommen, um seine Aussage zu Protokoll zu geben.“
„Na gut. Auf Ihre Verantwortung.“ Er trat zurück und wandte sich wieder an seine Leute.
„Danke“, sagte Steve und nickte Anderson zu.
„Keine Ursache“, meinte der Lieutenant. „Sie werden sicher eine Gelegenheit bekommen, sich zu revanchieren.“ Er drehte sich auf dem Absatz um und marschierte zu seinem Wagen.
Steve sah ihm ein paar Sekunden nach, ehe er ebenfalls zu seinem Camaro ging.
Am Tatort waren die Scheinwerfer inzwischen wieder ausgeschaltet worden, und nur noch die Rotlichter flackerten.
––––––––
25.
SABATO ÖFFNETE DEN Verschluss und löste die Schraube, die den Ladeschlitten festhielt. Schließlich war die Waffe in ihre Einzelteile zerlegt. Mit Pinsel, Bürste und Waffenöl reinigte er die Pistole gründlich. Sie war fast neu und zu kostbar zum Wegwerfen. Er hatte sich an die präzise Waffe gewöhnt. Umso gründlicher musste er die Spuren des Schusses beseitigen.
Zwar wusste er genau, dass die Polizei anhand des Geschosses jederzeit beweisen konnte, dass dies eine Mordwaffe war. Aber dazu mussten sie die Pistole erst einmal in die Hand bekommen und zweitens mussten sie den Verdacht haben, dass damit ein unbekannter Gauner irgendwo in New York erschossen worden war.
Er trank einen Schluck Milch und hob anschließend den Lauf gegen das Licht. Zufrieden nickte er. Sein Handwerkszeug musste in Ordnung sein. Darauf legte er großen Wert. Er setzte die Pistole wieder zusammen und versteckte sie mit dem Zubehör in dem Geheimfach im Koffer.
Es war schon spät. Er spürte, dass er plötzlich müde wurde.
Er erstarrte und war hellwach, als das Telefon klingelte. Erst nach dem dritten Mal hob er ab. Er nannte seinen Namen nicht, aber er erkannte die Stimme sofort, die sich am anderen Ende meldete.
„Hat alles geklappt? Die Polizei war hier und hat gefragt, ob ich etwas gehört oder gesehen habe. Das habe ich natürlich nicht. Meinen Glückwunsch.“
„Sie sollen mich doch hier nicht anrufen, Mister“, sagte Sabato mit harter Stimme. „Das ist für uns beide viel zu gefährlich.“
„Es ist ein weiterer Notfall eingetreten“, entgegnete der andere hastig. „In der Zeit, in der der Beobachter ausgeschaltet wurde, war ein richtiger Schnüffler bei mir zu Besuch. Er weiß für meinen Geschmack zu viel und muss aus dem Wege geräumt werden.“
„Ich glaube, ich habe bald keine Lust mehr, für Sie zu arbeiten“, sagte Sabato. „Entweder sehen Sie Gespenster, oder die halbe Stadt weiß bereits, was Sie treiben.“
„Hören Sie zu!“ Die Stimme wurde drängend. „Ich bezahle gut. Aber dieser Mann muss weg. Er ist gefährlich. Und ich habe den Eindruck, dass er die Wahrheit kennt.“
„Ich bin an Ihrem Geld nicht mehr interessiert“, antwortete Sabato. „Sehen Sie doch selbst zu, wie Sie sich die Mitwisser vom Hals schaffen.“
„Ich lasse Sie hochgehen“, drohte der andere. „Ich weiß genug über Sie, die Polizei wird sich über einen solchen Fang freuen. Sie wissen, dass ich in dieser Stadt eine Menge Beziehungen habe.“
Sabato schwieg ein paar Sekunden, aber seine Augen hatten einen Ausdruck angenommen, bei dessen Anblick anderen ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen wäre.
„Das würden Sie nicht wagen“, sagte er schließlich. „Sie hängen mit drin, wenn Sie gegen mich etwas unternehmen.“
Sein Gesprächspartner am anderen Ende lachte.
„Wer wird Ihnen glauben? Bei dem Job, den Sie haben? Ich bin in New York ein bekannter und wichtiger Mann. Ihr Wort gilt absolut nichts gegen meins. Also, tun Sie es oder nicht?“
Sabato nagte an seiner Unterlippe. „Ja. Wie heißt der Mann?“
„Er heißt Steve McCoy und ist irgendein Schnüffler. Die MacLarens müssten ihn kennen, vielleicht auch ihr Anwalt. Außerdem habe ich vom Fenster aus gesehen, wie er sich mit der Polizei unterhalten hat. Irgendjemand wird schon wissen, wie Sie ihn finden. Aber beeilen Sie sich, ehe er weitere Schritte unternehmen kann.“
„Ich werde mich darum kümmern“, sagte Sabato und legte auf. Er ließ sich auf das Bett sinken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
Der Auftrag wurde lästig wie ein Klumpfuß und der Kreis der Beteiligten immer größer. Damit wurde der Sicherheitsfaktor unberechenbar. Er befand sich in einer Situation, in der er nie zuvor gewesen war. Sein eigener Auftraggeber erpresste ihn. Und dagegen war Sabato allergisch.
Es war höchste Zeit, eine Lösung zu finden, die ihn von allen Schwierigkeiten befreite.
Er stand auf und öffnete den Koffer, der immer noch auf dem Tisch lag. Es roch leicht nach Waffenöl.
––––––––
26.
STEVE MCCOY WACHTE mühsam auf. Er blinzelte, als ein Sonnenstrahl in seine Augen blendete. Er schwang die Beine aus dem Bett und reckte sich.
Die Nacht hatte er in seinem Haus in Brooklyn verbracht. Er wollte heute Morgen sehr früh beginnen.
Er sah auf seine Uhr. Es war in der Tat noch früh.
Eine kalte Dusche und ein kräftiges Frühstück brachten ihn auf die Beine.
Sein erster Weg führte ihn zu dem zuständigen Polizeirevier, wo er seine Angaben über den Mord vom Vorabend protokollieren ließ. Das Ganze dauerte knapp zwanzig Minuten. Endlich konnte er gehen. Die Polizisten hatten zu dieser frühen Stunde offensichtlich auch noch keine Lust zu längeren Verhören. Zudem hatte niemand Interesse an dem kleinen Ganoven, der von einem anderen Ganoven erschossen worden war.
Anschließend führte Steve mehrere Telefongespräche. Seine Dienststelle hatte schließlich jede Menge gute Verbindungen zu allen Bereichen der Verbrechensbekämpfung. Danach hatte er einen Namen und eine Adresse. Sie gehörte einem der Gangster, die Dr. Charles Highwood zusammengeschlagen hatten. Der Name lautete Harvey Atkins und die Adresse East 31. Straße.
Das Haus hätte bei einer Schönheitskonkurrenz keinen Preis gewonnen. Steve blickte die Fassade hinauf. Der Putz war zum größten Teil abgeblättert, und die Fenster hätten dringend einen Anstrich gebraucht. Vor dem Eingang lärmten Kinder. Es roch nach Abfällen.
Steve schüttelte den Kopf. Immer mehr New Yorker mussten in solcher Umgebung leben. Die Slums breiteten sich aus wie Krebsgeschwüre – Brutstätten des Verbrechens. Und es sah nicht so aus, als könnte diese Entwicklung in der nächsten Zeit aufgehalten werden. Das hatte nur einen Vorteil: Steve McCoy würde sich über Arbeitsmangel nicht zu beklagen haben.
Er drückte die Tür auf und ging in den dämmerigen Hausflur. Rasch überflog er die Namen auf den Briefkästen. Er hatte keine großen Schwierigkeiten gehabt, den Besitzer des Wagens festzustellen, mit dem die Gangster vor Dr. Highwoods Haus geflohen waren. Ein zweiter Anruf hatte ihn über einen Auszug aus dem Strafregister informiert. Dort war auch der Komplice von Atkins registriert: Bill Ellison. Solche kleinen Gangster änderten ihre Gewohnheiten selten. Deshalb kam die Polizei ihnen auch immer wieder auf die Spur. Sie hatten einfach kein Format.
Steve stieg die baufälligen Treppen hinauf, nachdem er den Namen entdeckt hatte, mit krakeliger Schrift auf einen winzigen Zettel geschrieben. Harvey Atkins wohnte im dritten Stock.
Je weiter Steve nach oben kam, desto undefinierbarer wurden die Gerüche. Er hätte es hier nicht einen Tag ausgehalten. Schließlich stand er im dritten Stock, in der Hand die Werbedrucksache, die er aus Atkins Briefkasten gefischt hatte.
Die Klingel an der Tür, an der unter anderen auch der Name von Harvey Atkins stand, funktionierte nicht. Steve klopfte.
Es dauerte nur Sekunden, bis die Tür geöffnet wurde. Eine alte Frau in einem schmutzigen Kittel starrte ihn wortlos an.
„Ich möchte zu Mister Atkins“, sagte Steve.
Sie verzog das Gesicht zu einem Grinsen, wobei eine prächtige Reihe von Zahnlücken sichtbar wurde.
„Sie können ja mal versuchen, ihn wachzukriegen. Er schläft ziemlich lange, weil er sich am Abend volllaufen lässt. Aber wenn Sie zu seinen Freunden gehören, wissen Sie das sicher.“
Sie betrachtete ihn abschätzend. „Und wenn Sie nicht dazugehören, wird er Sie gleich rausschmeißen.“
Sie zog die Tür auf und ließ Steve eintreten.
„Dritte Tür rechts. Gehen Sie ruhig rein.“
Sie sah ihm nach, als er auf die Tür zuging. Im Gesicht hatte sie immer noch ihr Grinsen, das immerhin für eine Nebenrolle in einem Gruselfilm gereicht hätte.
In dem Zimmer roch es nach abgestandenem Fusel und Zigarettenrauch. Die Einrichtung war dürftig. Das einzig Neue war ein Telefon auf dem Nachttisch.
Atkins lag in voller Kleidung auf dem Bett und schlief. Als Steve weiter ins Zimmer trat, schlug er plötzlich die Augen auf und sah den Eindringling fassungslos an.
Steve warf den Werbebrief aufs Bett. „Ich bringe die Post.“
Erst beim Klang der Stimme schien der Gangster zu begreifen, was vorging. Blitzschnell warf er sich herum, riss die Schublade des Nachttisches auf und griff hinein.
Mit einem großen Schritt war Steve heran und trat mit dem ausgestreckten Fuß hart gegen die Schublade. Atkins heulte auf, da seine Hand eingeklemmt wurde. Hastig zog er sie zurück. In der Schublade lag ein Revolver.
Den nächsten Angriff konnte Steve McCoy leicht abwehren. Der Gangster versuchte, vom Bett hochzukommen und dabei einen Schwinger zu landen. Eine rechte Gerade schickte ihn zurück, und sein Kopf prallte gegen die Wand.
„Können wir uns jetzt unterhalten?“, fragte Steve mit ruhiger Stimme.
Aber Atkins gab noch nicht auf. Er stieß einige unzusammenhängende Worte aus und ging erneut auf Steve los. Dieser wich tänzelnd einige Schritte zurück und ließ seinen Gegner kommen. Der Gangster war wütend und stürmte los wie ein Stier.
Steve machte es wie ein Torero und ließ ihn ins Leere laufen. Atkins fuhr wieder herum und versuchte, alle Kraft in einen mörderischen Hieb zu legen. Steve fing die Faust mit dem Unterarm ab, machte wieder eine Drehung und rammte Atkins den Ellbogen in die Herzgrube. Der Gangster stöhnte und taumelte zurück.
Steve setzte nach und zog Atkins hoch. Jeden weiteren Widerstand erstickte er mit einem platzierten Schlag auf das Jochbein. Das tat höllisch weh, wie er aus eigener schmerzhafter Erfahrung wusste. Damit war Atkins Kraft gebrochen. Er blieb auf dem wackligen Stuhl liegen, auf den ihn Steve geschleudert hatte.
„Jetzt reicht’s aber“, sagte Steve und massierte sich die Knöchel der rechten Hand. „Ich wollte nur ein paar Fragen stellen.“
Atkins starrte ihn dumpf an und verzog schließlich das Gesicht zu einem missglückten Grinsen. „Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie dringen einfach bei mir ein und schlagen mich nieder.“
„Lassen wir das Versteckspiel. Sie wissen genau, wer ich bin, denn wir sind uns schon begegnet. Sie haben den Kürzeren gezogen, und heute wird dasselbe passieren. Ich möchte wissen, wer Ihnen den Auftrag gegeben hat, Dr. Highwood zu überfallen.“
„Niemand hat mir den Auftrag gegeben. Das war ein dummer Zufall. Ich gebe zu, dass wir bei diesem Anwalt waren, aber wir wollten ihn nur um ein paar Dollar erleichtern.“
Steve lächelte freundlich und schlug mit der flachen Hand zu. Die gewaltige Ohrfeige warf den Gangster vom Stuhl, und er prallte wieder mit dem Kopf gegen die Wand.
„Ich weiß nicht, wie lange Sie das aushalten“, sagte Steve. „Ich habe den ganzen Tag Zeit.“
Atkins rappelte sich mühsam auf und stützte sich gegen die Wand.
„Das werden Sie noch bereuen“, murmelte er leise.
Steve lächelte ihn ungerührt an. „Ihr Komplice heißt Bill Ellison. Richtig?“
Atkins nickte erst, nachdem er einen aufmunternden Hieb gegen die Rippen eingesteckt hatte.
„Na also, wir kommen doch voran“, meinte Steve fröhlich. „Und jetzt noch den Namen des Auftraggebers.“
„Nein!“ Atkins schrie es fast. „Wenn ich den sage, bin ich ein toter Mann. Ich kenne den Namen auch gar nicht. Er ruft uns nur an, wenn er uns braucht. Wir kennen nur den Decknamen.“
Steve trat einen Schritt zurück und betrachtete ihn prüfend.
„Wie nennt sich dieser Mann? Es geht hier um Mord! Ich muss den Namen haben. Sie müssen sich sowieso einen anderen Job suchen.“
„Wenn er erfährt, dass ich Ihnen den Namen genannt habe ...“ Atkins brach ab und senkte den Kopf.
Steve packte ihn am Arm.
„Los! Raus damit! Sonst liefere ich Sie bei der Polizei ab, und zwar unter Mordverdacht. Dann haben Sie keine ruhige Minute mehr, das schwöre ich Ihnen.“
„Er nennt sich Sabato.“ Die Worte waren kaum zu verstehen.
„Sabato.“ Steve wiederholte den Namen und betonte jede Silbe. „Und weiter?“
„Weiter nichts. Das ist sein Name. Einen anderen gibt es nicht. Und es ist bestimmt nicht sein richtiger.“
„Und wo hält er sich normalerweise auf?“, fragte Steve.
„Das wissen wir nicht. Er ruft uns an und bestimmt einen Treffpunkt. Er hat uns verboten, ihm nachzugehen. Als wir es einmal versucht haben, hat er uns fast umgebracht.“
Steve nickte langsam. Er hatte den Eindruck, dass der Gangster die Wahrheit sagte.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Beide starrten das schwarze Plastikgehäuse an.
„Na los, gehen Sie ran!“, sagte Steve schließlich.
Atkins hob langsam den Hörer ab.
„Ja?“, sagte er.
Plötzlich wurde sein Gesicht kreidebleich, und er sah Steve McCoy entsetzt an. Er sagte nichts, sondern hörte seinem unbekannten Gesprächspartner zu, wobei er mehrmals nickte.
Steve ahnte, wer am anderen Ende sprach. Mit einer raschen Bewegung nahm er Atkins den Hörer aus der Hand.
„Hier spricht Steve McCoy“, sagte er. „Falls wir das Vergnügen noch nicht hatten, wird es vermutlich bald soweit sein.“
Dann gab er den Hörer zurück.
Atkins starrte ihn nur an und legte den Hörer behutsam auf die Gabel. Er ließ sich auf das Bett sinken und stützte den Kopf in die Hände.
„Das war doch Ihr geheimnisvoller Auftraggeber?“, fragte Steve. „Das wird ihm gar nicht schmecken. Wir werden versuchen, ihn aus der Reserve zu locken. Und Sie müssen mir jetzt helfen, denn er wird annehmen, dass Sie mir alles verraten, was Sie wissen.“
Atkins murmelte ein paar unverständliche Worte. In welcher Lage er war, hatte er begriffen. Steve hatte fast Mitleid mit ihm. Doch ihm hätte nichts Besseres passieren können, als den Unbekannten an der Leitung zu haben. Zum ersten Mal hatte er die Chance, an den Killer heranzukommen und ihn aus der Deckung zu locken.
„Was wollte er von Ihnen?“, fragte er Atkins.
„Er hat mir Ihren Namen genannt“, murmelte der Gangster. „Wir sollen Sie finden und beobachten.“
„Er kennt meinen Namen also schon“, sagte Steve nachdenklich. „Wer ihm den wohl gesagt hat ... Ich bin also schon dicht dran.“
„Tun Sie mir den Gefallen und verschwinden Sie endlich“, beschwor ihn Atkins. Seine Stimme klang müde und verzweifelt.
„Na schön“, entgegnete Steve. „Sehen Sie zu, wie Sie mit Ihrem geheimnisvollen Unbekannten fertigwerden. Wir sprechen uns später noch. Und geben Sie sich keine Mühe. Ich finde Sie, wo immer Sie sich auch aufhalten.“
Damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging hinaus.
Unten setzte er sich in seinen Wagen. Er behielt den Eingang im Auge und wartete.
Sabato, dachte er. Ich bin gespannt auf unsere Begegnung.
––––––––
27.
DER SCHLANKE HOCHGEWACHSENE Mann mit den dunklen Augen löste langsam die Hand von der Gabel des Telefons. Er hatte sie seit fast einer Minute nach unten gedrückt. Den Hörer hielt er immer noch in der Hand. Dann legte er ihn mit einer schnellen Bewegung auf.
Er legte die Stirn in Falten und überlegte fieberhaft. Sein Auftraggeber hatte Recht. Dieser Schnüffler McCoy wusste wirklich zu viel. Dass er Atkins ausfindig gemacht hatte, war unglaublich. Und dann noch diese Provokation am Telefon!
Der Mann, der sich Sabato nannte, ging zum Fenster und starrte hinaus. Er war ein Killer, dessen war er sich bewusst. Sein Beruf war das Töten. Es hatte den Anschein, als müsste er sehr schnell beruflich tätig werden. Er lächelte böse.
Er öffnete seinen Koffer und legte den Inhalt des Geheimfachs auf den Tisch. Sorgfältig wählte er sein Handwerkszeug aus. Diesmal ging es um ihn selbst.
Er entschied sich schließlich für den 44er Magnum. Der schwere Revolver war zuverlässig und hatte eine vernichtende Wirkung. Sabato wog die Waffe in der Hand. Das war kein Spielzeug für schwache Hände. Er strich zärtlich über die Combat-Griffschalen und überprüfte alle Funktionen. Danach lud er die Trommel.
Mit geübten Griffen befestigte er sein Schulterholster und schob den Revolver hinein. Schalldämpfer und Ersatzmunition verschwanden in der Sakkotasche. Er trat kurz vor den Spiegel. Der Anzug war so gearbeitet, dass man die Waffe unter der Achsel kaum sah.
Als Nächstes nahm er ein schmales Stilett in einer schwarzen Lederscheide aus dem Koffer. Er schob es in den Schaft seines Halbstiefels. Auch das war eine zuverlässige Waffe – in der Hand eines Spezialisten jedenfalls.
Sabato sah auf die Uhr. Es wurde Zeit. Er musste sich beeilen, wenn er seinem Gegner zuvorkommen wollte. Er war entschlossen, die Gefahr zu beseitigen. Das hieß, es durfte niemanden mehr geben, der ihm gefährlich werden konnte. Es waren nicht viele. Die, die ihn schon kannten, mussten zuerst verschwinden.
Er verließ sein Hotelzimmer, ohne gesehen zu werden. Den Weg kannte er, und er wusste auch, wie viel Zeit er brauchen würde. Denn er nahm die U-Bahn. Das war der sicherste und schnellste Weg. Und niemand würde auf ihn achten.
Die Fahrt dauerte genau achtundzwanzig Minuten. Dann war er am Ziel. Noch fünf Minuten zu Fuß, und er stand vor dem Haus, in dem sein erstes Opfer wohnte: Bill Ellison.
Ellison hatte den Fehler begangen, ihn kennengelernt zu haben. Und es war zu befürchten, dass der kleine Gangster reden würde, wenn er in die Mangel genommen wurde – ein Risiko, das Sabato nicht eingehen konnte.
Mit einem kurzen Blick überzeugte er sich davon, dass niemand auf ihn achtete. Schließlich ging er mit raschen Schritten ins Haus. Zwei Minuten später stand er vor der Tür, hinter der Bill Ellison wohnte. Die Wohnung hatte seiner Mutter gehört, die vor zwei Jahren gestorben war. Sein Vater war schon vor Jahren bei einem Banküberfall von einem Polizisten erschossen worden.
Sabato öffnete mit einem Spezialwerkzeug das alte Schloss und trat in die Wohnung. Er bewegte sich völlig lautlos, und seine Sinne waren bis zum Äußersten angespannt. Eine flüchtige Durchsuchung der Wohnung führte zu keinem Ergebnis. Ellison war nicht zu Hause.
Sabato setzte sich in einen Sessel und wartete. Die Hände lagen ruhig auf seinen Knien. Tür und Fenster behielt er im Auge – er war ein vorsichtiger Mann.
Es dauerte länger als eine Stunde, bis die Tür aufgeschlossen wurde. Sabato rührte sich nicht. Er hörte es im Flur rumoren. Schließlich kam Ellison ins Zimmer, im Arm eine riesige braune Papiertüte mit Lebensmitteln.
Er erstarrte, als er Sabato bemerkte. Dann glitt ihm die Tüte aus den Händen und fiel auf den Fußboden. Klirrend zerplatzte eine Flasche, und irgendeine Flüssigkeit lief aus. Wahrscheinlich Bier, dachte Sabato, ohne den anderen aus den Augen zu lassen. Seine Hände hatten sich noch keinen Zoll bewegt.
„Wie – wie kommen Sie hier herein?“, stammelte Ellison. „Was wollen Sie von mir? Harvey hat mir nicht gesagt, dass Sie einen Auftrag für uns haben.“
Sabato lächelte schwach. Nur seine Augen blieben ernst.
„Ich habe einen Auftrag für dich allein. Das ist eine einmalige Gelegenheit für dich. Du wirst alles zeigen müssen, was du hast.“
„Aber ich habe noch nie ohne Harvey gearbeitet.“ Ellisons Stimme klang zweifelnd. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut.
„Wir brauchen Harvey diesmal nicht“, sagte Sabato leise. „Dafür kannst du das Geld auch allein behalten.“
Ellison zuckte mit den Schultern. „Das wird Harvey aber gar nicht recht sein. Ich habe noch nie ohne ihn ...“
„Hör auf!“ Die harte Stimme unterbrach ihn, und Ellison zuckte zusammen. Seine Hände zitterten leicht.
Sabato sah es mit Befriedigung. „Wir wollen gehen.“
Ellison bewegte sich immer hilfloser. Ein Schwachsinniger, dachte Sabato angewidert. Ein hirnloser Schläger und Feigling.
Ellison bückte sich und wollte die zerrissene Tüte aufheben. Ein paar Äpfel waren über den Fußboden gekollert.
„Lass das jetzt liegen!“ Sabatos Stimme klang wie ein Peitschenhieb. Er stand mit einem Ruck auf. Mit einer flüchtigen Bewegung überzeugte er sich davon, dass die dünnen Lederhandschuhe fest saßen.
„Also los, gehen wir endlich!“
Er schob Ellison mit der Hand aus der Tür. Ellison ließ die Schultern hängen, aber er biss schon wieder auf dem Kaugummi herum, an dem er sich beim Betreten des Zimmers fast verschluckt hatte.
Sie gingen rasch die Treppe hinunter. Sabato war immer einen halben Schritt hinter Ellison. Keiner sagte ein Wort. Ellison traute sich nicht, und Sabato hatte dem anderen nichts mehr zu sagen. Auf der Straße wandten sie sich nach links.
„Wohin gehen wir?“, fragte Ellison mit einem schnellen Seitenblick in das steinerne Gesicht des Killers. Der schüttelte nur leicht den Kopf und deutete vorwärts.
Es waren nur ein paar hundert Meter bis zu dem Schrottplatz, den Sabato ausgewählt hatte. Schon von Weitem hörten sie das Kreischen des Metalls. Die Schrottautos wurden in der riesigen Presse zu handlichen Paketen geformt.
Sie betraten den Platz durch ein schmales Gittertor, das nicht abgeschlossen war. Das Schloss war verrostet. Niemand achtete auf sie. Ringsum standen dunkle Fabrikgebäude.
„Was wollen wir hier?“, fragte Ellison erneut. Aber er bekam auch diesmal keine Antwort. Sabato stieß ihn leicht zwischen die Schulterblätter, und sie gingen weiter. Zu beiden Seiten einer schmalen Gasse türmten sich Autowracks in mehreren Etagen übereinander. Wieder ertönte das ohrenbetäubende Geräusch, als ein Wagen von der Presse zusammengedrückt wurde.
Sabato streckte den Arm aus und packte Ellison an der Schulter. Sie blieben stehen. Ellison sah sich um. Dann verzerrten sich seine Züge entsetzt.
Er stolperte und hob abwehrend die Arme. Sein Schrei wurde vom Kreischen der Presse übertönt – und auch das Donnern der 44er Magnum.
Die Wucht des schweren Geschosses hob Ellison von den Füßen. Er wurde gegen ein Autowrack geschleudert, fiel in eine zersplitterte Scheibe, und ein dolchartiger Glassplitter bohrte sich in seinen Hals.
Sabato senkte den Revolver. Ellison rutschte neben dem Hinterrad zu Boden. Die helle Jacke färbte sich dort dunkel, wo die Kugel ausgetreten war. Ellison rührte sich nicht mehr. Ein Schuss durchs Herz aus dieser Entfernung mit einer 44er Magnum überlebte niemand.
Sabato steckte den Revolver ein, packte die Leiche unter den Achseln und zerrte sie bis zum Ende der Gasse. Er blickte um die Ecke und sah befriedigt die Reihe der Autowracks, die für die Presse vorgesehen waren. Es war kein Mensch in der Nähe. Die Autowracks wurden mit einem Elektromagneten in die Presse gehoben, und der Kranführer konnte diese Stelle nicht einsehen.
Der Killer wusste das, denn er hatte hier bereits einmal einen Auftrag erledigt.
Er öffnete den Kofferraum des letzten Wagens, hob den Toten hinein und schlug die Klappe wieder zu. In einigen Stunden würde Bill Ellison spurlos verschwunden sein, eingeschlossen in einem rechteckigen Block aus Metall, Glas und Kunststoff, bestimmt für einen heißen Schmelzofen.
Sabato warf einen prüfenden Blick in die Runde. Er war immer noch allein. Langsam streifte er seine Handschuhe ab und schob sie in die Tasche. Dann drehte er sich ruckartig um und trat den Rückweg an. Auf seinem Gesicht stand ein schwaches Lächeln.
––––––––
28.
STEVE MCCOY SUCHTE gerade einen anderen Sender im Autoradio, als Harvey Atkins das Haus verließ. Steve blickte auf seine Uhr. Über zwei Stunden hatte er warten müssen, aber seine Geduld hatte sich schließlich bezahlt gemacht. Der Motor des Camaro sprang an.
Atkins achtete nicht auf seine Umgebung, sondern strebte mit schnellen Schritten auf einen Taxistand zu, der etwa zweihundert Meter entfernt war, Steve McCoy folgte in einigem Abstand.
Der Gangster stieg in ein Yellow Cab, und der Wagen scherte aus der Reihe. Steve hatte keine Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Es ging ins südliche Manhattan, Richtung East River. Sie fuhren über die Bowery und bogen vor der Manhattan Bridge nach links ab.
Zwei Querstraßen weiter hielt das Taxi. Steve sah, dass Atkins bezahlte, die Straße überquerte und auf der anderen Seite in einem Lokal verschwand.
Steve brauchte ein paar Minuten, bis er eine Parklücke gefunden hatte. Dabei fragte er sich, wieso der Gangster nicht seinen eigenen Wagen benutzte, sondern Geld für ein teures Taxi ausgab. Aber vielleicht war das gar nicht so merkwürdig. Vielleicht hatte Atkins nur die Absicht, sich nach dem Besuch von Steve McCoy volllaufen zu lassen.
Steve schloss seinen Wagen ab und ging ebenfalls über die Straße. Das Lokal hieß schlicht „The Saloon“ und unterschied sich von einer ehrlichen alten Westernkneipe wie ein Ackergaul von einem Rennpferd.
Es war unmöglich, von außen hineinzusehen. Die zwei schmierigen Fenster wurden von dichten Vorhängen verhängt. Über dem Eingang flackerte ein rotes Neonlicht. Die Speisekarte neben der Tür war so verblichen, dass man fast kein Wort mehr erkennen konnte. Entschlossen drückte Steve die Tür auf. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er sich an die schlechten Lichtverhältnisse gewöhnt hatte. Er setzte sich an einen Tisch in einer Nische gleich neben dem Eingang.
Der Grundriss des Raums war fast quadratisch. An der gegenüberliegenden Seite befand sich die Bar mit einigen wackligen Hockern, deren Polster völlig zerschlissen waren. Die Mitte des Raumes war frei, offenbar eine Tanzfläche.
Eine relativ moderne Music-Box stand an der Seite, sie war jedoch nicht in Betrieb. An der Bar hockten zwei Männer. Harvey Atkins war nicht zu sehen. Entweder saß er in einer Nische, oder er hatte das Lokal bereits wieder verlassen. Vielleicht gab es einen Hinterausgang.
Steve stand auf und schlenderte zu den Toiletten. Im Vorbeigehen bestellte er beim Barkeeper ein Bier.
Vor Steve öffnete sich ein schmaler Gang, der bis unter die Decke mit leeren Kistenstapeln gefüllt war. Nur eine trübe Funzel brannte. Mehrere Türen gingen von dem Gang ab. Die Erste betraf Ladys, die Zweite Gents, und auf der Nächsten stand „Privat“. Dahinter befand sich noch eine weitere, auf der nichts stand.
Steve öffnete sie. Es war ein Lagerraum, in dem es nach schalem Bier und alter Wäsche roch. Er rümpfte die Nase.
Die letzte Tür führte auf einen Hof, war aber abgeschlossen. Atkins befand sich jedenfalls nicht hier.
Steve überprüfte noch die Toilette. Aber auch dort befand sich außer monatealtem Dreck nichts Bemerkenswertes. Er ging zurück in den Gastraum. Sein Bier stand inzwischen auf dem Tisch. Er nahm einen kleinen Schluck und sah sich gründlich um.
Jetzt erst entdeckte er die Treppe. Sie war schmal und leicht zu übersehen und führte an der linken Seite zwischen zwei hölzernen Nischen in den ersten Stock. Dort oben musste Atkins sein.
Steve überlegte, ob er hinaufgehen sollte. Dann verwarf er diesen Gedanken. Denn er hätte kaum unauffällig verschwinden können, und der Barkeeper beobachtete ihn bereits aufmerksam. Fremde Gäste waren in solchen Etablissements immer suspekt.
In diesem Augenblick kam ein neuer Gast herein. Er ging mit raschen Schritten durch den Raum auf die Treppe zu und verschwand nach oben. Steve sah ihn nur von hinten. Er war schlank und hochgewachsen und trug dunkle Handschuhe. Sein Anzug war vermutlich nicht von der Stange. Trotzdem erkannte Steve den Riemen des Schulterholsters unter dem Sakko.
Er setzte langsam das Bierglas ab und zog die Stirn in Falten. Hier fand sicher keine gewöhnliche geschäftliche Besprechung statt.
Steve stand auf und ging ebenfalls zu der Treppe. Er blickte nach oben, konnte aber nichts erkennen. Wie ein Schatten glitt der Barkeeper neben ihn.
„Das dort oben ist privat.“ Er legte seine Hand in einer vertraulichen Geste auf Steves Schulter.
Steve McCoy schüttelte die Hand unwillig ab.
„Ich dachte, ich hätte einen Bekannten entdeckt. Er ist eben nach oben gegangen.“
Der Barkeeper schüttelte leicht den Kopf und grinste. „Sie haben sich bestimmt getäuscht. Der Mann gehört mit Sicherheit nicht zu Ihren Bekannten.“
Er lachte leise in sich hinein. „Das würde mich jedenfalls sehr wundern. Darf ich Ihnen noch ein Bier bringen? Vielleicht auf Kosten des Hauses? Bei neuen Gästen tun wir das immer.“
Steve sah ihn unbewegt an. „Nein, danke. Ein Bier in Ihrem Laden reicht mir völlig.“
Der Barkeeper zuckte mit den Schultern und schlurfte wieder hinter seinen Tresen, um dort in einer Sportzeitung weiterzulesen.
Steve setzte sich an seinen Tisch und wartete. Mehr konnte er im Moment nicht tun, obwohl er vor Anspannung fast vibrierte. Er fühlte, dass er dicht vor dem Ziel war. Er glaubte zu wissen, warum und durch welche Machenschaften Kevin MacLaren in Untersuchungshaft gekommen war.
Auf der Treppe wurden Schritte laut. Steve lehnte sich tiefer in den Schatten zurück. Harvey Atkins erschien, und hinter ihm der schlanke Neuankömmling. Die beiden sprachen nicht miteinander und gingen auf den Ausgang zu.
Als sie an ihm vorbeikamen, warf der zweite Mann einen Blick in Steves Richtung. Für einen Sekundenbruchteil kreuzten sich ihre Blicke, und Steve durchzuckte es wie ein elektrischer Schlag.
Das musste er sein!
Der Killer.
Für einen Moment hatte er in Augen gesehen, die nur den Tod versprachen, Augen, die nicht lächeln konnten. In ihnen lag die kalte Erbarmungslosigkeit eines menschlichen Raubtiers.
Dann waren die beiden Männer draußen. Steve warf einen Dollarschein für sein Bier auf den Tisch und folgte ihnen. Er spürte, dass ihn das Jagdfieber packte. Sein Puls beschleunigte sich, und seine Sinne schärften sich wie immer in solchen Situationen.
Er blinzelte, als er in das helle Tageslicht trat. Die beiden Männer überquerten vor ihm die Straße, ohne sich umzusehen. Sie gingen in Richtung der Piers.
Steve folgte ihnen in dem Gewirr der Straßen zwischen Williamsburg Bridge und Chinatown. Bis zum East River waren es nur ein paar hundert Meter.
Steve hatte keine Mühe, den beiden auf den Fersen zu bleiben, obwohl sie ziemlich schnell gingen. Er hielt immer denselben Abstand. Aber er wusste, dass sie ihn bemerkt hatten.
Schließlich waren sie im Hafengebiet angekommen. Steve hatte keine Ahnung, was die beiden hier wollten, aber er war entschlossen, sich nicht abschütteln zu lassen.
Die Silhouetten einiger Frachtschiffe hoben sich gegen den diesigen Himmel ab. An den nächstliegenden Piers lagen keine Schiffe. Die Gegend wurde unübersichtlich. Nur einige Werftarbeiter begegneten ihm. Das Gewirr von Kränen, Lagerschuppen, Containerstapeln und Eisenbahnwaggons war für einen Fremden schwer zu überschauen.
Plötzlich wusste Steve McCoy, was die beiden hier wollten. Es war eine Falle. Die Gegend war ideal dafür, einen Mann am helllichten Tag auszuschalten. Und die dunklen Gewässer des East River waren schweigsam.
Steve lockerte den Kolben der Beretta und bewegte sich mit äußerster Vorsicht. Gerade waren die beiden hinter einem Kistenstapel verschwunden. Er wusste nicht, wo er sich befand.
In der Deckung einer langen Reihe von Containern schlich er weiter. In der Nähe war kein Laut zu hören. Nur aus der Ferne drang das Geräusch von Schmiedehämmern herüber.
Er riskierte einen Blick um die Ecke. Es war niemand zu sehen. Die beiden schienen vom Erdboden verschluckt zu sein. Aufmerksam musterte er seine Umgebung. Gegenüber standen einige Ladekräne, die aber zurzeit nicht in Betrieb waren. Sie standen auf hohen Gerüsten, die in Schienen direkt an der Kaimauer liefen.
Links befand sich ein langgestreckter Lagerschuppen, dessen Tore verschlossen waren. Davor stand eine Reihe von Lastwagen. Rechts waren weitere Container aufgetürmt, unterbrochen von Gassen, sodass man leicht an sie herankonnte. Zu diesem Zweck standen einige Gabelstapler bereit.
Steve zuckte zusammen, als der Schuss krachte. Mit einem hässlichen Geräusch schlug die Kugel einen knappen halben Meter neben ihm in die Stahlwand eines Containers. Blitzschnell warf er sich zu Boden. Keine Sekunde zu früh! Die zweite Kugel hätte ihn erwischt.
Er rollte zur Seite und robbte um die Ecke zurück. Den Standort des heimtückischen Schützen hatte er nicht ausmachen können. Jedenfalls war die Treffsicherheit des Schützen auf eine solche Entfernung beachtlich. Die nächste Deckung war etwa vierzig Meter entfernt. Wer auf diese Distanz mit einer Pistole so knapp sein Ziel verfehlte, durfte nicht unterschätzt werden.
Steve stand auf, klopfte den Staub ab und sah sich um. Wenn er über die freie Fläche rannte, würde er wie ein Hase abgeschossen werden. Er musste also den Schützen umgehen.
Mit großen Schritten lief er zurück und bog in die nächste Gasse zwischen den Containern ein. Vor der nächsten Quergasse hielt er an. Er riskierte einen vorsichtigen Blick. Niemand war zu sehen. Er hetzte weiter. Als er um die nächste Ecke spähte, sah er eine Bewegung.
Hinter einem der Kräne stand jemand. Steve kniff die Augen zusammen und versuchte, Einzelheiten zu erkennen. Aber die Gestalt war auf diese Entfernung nicht zu identifizieren. Er musste näher heran. Eng an die Container gepresst, arbeitete er sich vorwärts.
Als er das Ende der Containerreihe erreicht hatte, schlug dicht vor seinen Füßen eine Kugel ein und schrammte eine tiefe Furche in das Pflaster. Gleichzeitig hörte er das Krachen einer schweren Faustfeuerwaffe.
Steve sprang ein paar Schritte zurück. Es hatte keinen Sinn. So kam er an seinen Gegner nicht heran. Der saß in guter Deckung und konnte ihn jederzeit auf Distanz halten. Außerdem waren sie zu zweit und konnten ihn in die Zange nehmen, wenn er nicht aufpasste.
Steve sah sich um, plötzlich hatte er einen Einfall. Geduckt lief er wieder zurück, schlug einen weiten Bogen und näherte sich dann dem Lagerschuppen. Sein Ziel waren die schweren Trucks vor dem Schuppen.
Vermutlich lauerten seine Gegner noch bei den Kränen, denn dort hatten sie freies Schussfeld nach allen Richtungen.
Steve kletterte in einen der Trucks und schwang sich auf den hohen Fahrersitz. Schnell machte er sich mit der Apparatur vertraut. Danach schloss er die Zündung kurz. Mit einem dumpfen Röhren sprang der Motor an. Der Wagen zitterte vor geballter Kraft.
Steve legte den ersten Gang ein und ließ den Lastzug anrollen. Er duckte sich hinter das Lenkrad, sodass er gerade noch den Weg erkennen konnte. Sein Ziel waren die Kräne.
Das Geräusch des Motors übertönte die Revolverschüsse. Zwei Kugeln schlugen in kurzen Abständen gegen das Metall der Zugmaschine. Eine dritte ließ die Windschutzscheibe zersplittern und bohrte sich hinter ihm in die Rückwand der Fahrerkabine. Steve rutschte noch tiefer.
Schließlich war er bei den Kränen. Er sah eine schlanke hochgewachsene Gestalt davonhuschen. Sein Gegner wusste, wann es Zeit war, den Rückzug anzutreten. Ein Profi.
Steve trat auf die Bremse und stoppte den Truck. Der andere war jetzt zwischen den Containern verschwunden.
Aber wo war Harvey Atkins?
Steve richtete sich auf und blickte sich um. Die Hafenanlagen schienen völlig verlassen. Er schaltete den Motor ab und stieg aus, die Pistole in der Hand.
Er blickte zu den Containerstapeln hinüber. Aber der schlanke Mann war verschwunden. Wenn er sich bereits abgesetzt hatte, konnte Steve ihn nicht wieder einholen. Die Gegend war viel zu unübersichtlich.
Steve McCoy spürte, dass im Augenblick keine Gefahr mehr bestand. Trotzdem blieb er vorsichtig. Irgendwo lief Harvey Atkins noch herum, und Steve konnte sich vorstellen, dass der Gangster nicht gerade gut auf ihn zu sprechen war.
Steve näherte sich langsam dem Kran, von dem aus man auf ihn geschossen hatte.
Erst als er unmittelbar davorstand, bemerkte er Harvey Atkins. Der Gangster lag in seltsam verkrümmter Haltung neben einem der großen Räder des Schienenkrans. Er lag halb auf der Seite, einen Arm unter dem Körper, den anderen abgewinkelt, als wollte er sich abstützen und aufstehen.
Aber aufstehen würde Harvey Atkins nie mehr. Denn er war tot.
Steve McCoy ging in die Knie und steckte seine Waffe ein. Er berührte den Toten an der linken Schulter, und der Körper rollte zur Seite.
Zwei Zentimeter unter dem linken Ohr entdeckte er die tödliche Wunde. Aber es war kein Einschuss, sondern ein Messerstich. Die Wunde blutete kaum. Auch das war das Werk eines professionellen Killers. Steve überlief es kalt.
Der Killer löschte die Menschen wie Ungeziefer aus, und selbst ein Gangster wie Atkins hatte einen solchen Tod nicht verdient.
Steve erhob sich und blickte auf die Leiche hinunter. Der Killer wusste, dass man ihm auf der Spur war, und versuchte jetzt, alle Mitwisser auszuschalten. Der Unbekannte war gefährlicher als eine gereizte Klapperschlange. Er würde rücksichtslos zuschlagen, wenn er sich bedroht fühlte.
Müde trat Steve den Rückzug an. Er konnte nur noch die Mordkommission benachrichtigen. Und er selbst hatte jetzt nur noch eine einzige Spur.
––––––––
29.
ALLE BETEILIGTEN SPÜRTEN es: Heute war der Tag der Entscheidung. Obwohl keiner vom anderen wusste, hatten sie alle dasselbe Ziel. Ein Haus in der Upper East Side.
Dort wohnte John Carruthers.
Joan MacLaren war die Erste. Sie kam mit einem Taxi. Aus der Morgenzeitung hatte sie erfahren, dass Rico Manzini tot war. Ermordet in der Nähe des Mannes, den er überwachen sollte. Sie wusste nicht genau, was sie davon halten sollte, aber sie hatte ein unbestimmtes Angstgefühl. Sie konnte sich zwar nicht vorstellen, dass John damit etwas zu tun hatte, aber sie ahnte Unheilvolles.
Sie wollte mit ihm sprechen und ihm auf den Kopf zusagen, dass er mehr von der Verhaftung ihres Mannes wusste, als er zugab. Sie hatte es sich selbst nicht eingestehen wollen, dass ihr gefährliches Spiel zwischen ihrem Mann und John tödliche Konsequenzen hatte. Sie hätte gern einiges rückgängig machen wollen, aber sie wusste, dass es dazu bereits zu spät war.
Sie konnte nur noch retten, was zu retten war. John musste ihr endlich die ganze Wahrheit sagen. Er hatte sie benutzt, um an die Waffe ihres Mannes zu kommen, die nun als Mordwaffe bei der Mordkommission lag.
Fünf Minuten später traf Dr. Charles Highwood ein. Er wusste selbst nicht genau, was ihn eigentlich hierher führte. Aber er war zurzeit nicht über den Stand der Dinge informiert. Die Zeit drängte: Kevin MacLaren würde bald offiziell angeklagt werden. Und es hatte den Anschein, als wäre man keinen Schritt weitergekommen. Steve McCoy verfolgte irgendwelche Spuren und schwieg sich aus.
So hatte der Anwalt einen plötzlichen Entschluss gefasst und sich zu John Carruthers auf den Weg gemacht. Er wusste, dass Carruthers ein unerbittlicher Gegner Kevin MacLarens war. Aber MacLaren selbst war wie mit Blindheit geschlagen. Er nahm nicht einmal zur Kenntnis, dass seine Frau ein Verhältnis mit Carruthers hatte.
Highwood stieg aus dem Taxi und ging langsam auf der Straße auf und ab, die Hände auf dem Rücken. Er wusste nicht, wie er seinen Besuch bei dem Politiker motivieren sollte. Was wollte er ihn fragen?
Er blickte auf, als ein Wagen neben ihm stoppte. Nach einer Schrecksekunde erkannte er einen Camaro. Er blieb stehen und sah Steve McCoy gespannt entgegen. Der Agent stieg aus und schloss die Tür ab. Die beiden Männer schüttelten sich die Hände.
„Was machen Sie denn hier?“, fragte Steve McCoy.
Der Anwalt zuckte mit den Schultern. „Das kann ich nicht sagen. Es war nur eine Idee. Ich habe das Gefühl, dass Carruthers der Schlüssel zu dem ganzen Fall ist. Aber es gibt nicht die Spur eines Beweises. Und jetzt weiß ich nicht, was ich ihm sagen soll.“
Steve nickte. „Mit Ihrem Verdacht haben Sie völlig recht. Ich bin sicher, dass Carruthers der Drahtzieher ist. Aber auch ich kann es nicht beweisen. Wir können ihn nur überrumpeln. Im Übrigen glaube ich, dass er in höchster Lebensgefahr ist.“
Highwood blickte überrascht auf. „Wieso das?“
„Er hat einen Killer gemietet, und der fühlt sich offensichtlich bedroht, denn er räumt seine Helfer aus dem Weg. Einen von ihnen habe ich heute Morgen selbst gefunden. Von dem anderen gibt es keine Spur. Niemand hat ihn heute gesehen. Ich war in seiner Wohnung. Alles spricht für einen überstürzten Aufbruch. Ich glaube, dass auch er tot ist. Der Killer kennt keine Rücksicht.“
In Highwoods Gesicht stand das blanke Entsetzen.
„So schlimm ist es? Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Carruthers so weit gehen würde.“
Er drehte sich um und blickte zum Haus hinüber. Mit leiser Stimme fragte er: „Was können wir tun?“
„Ich werde mit ihm reden“, sagte Steve McCoy. „Es ist unsere einzige Chance. Der Killer wird mir bestimmt nichts sagen.“
„Na schön, wenn Sie meinen.“
„Und Sie benachrichtigen die Polizei. Verlangen Sie Lieutenant Anderson. Hier ist zwar nicht sein Revier, aber wenn Sie ihm sagen, worum es geht, wird er kommen. Und er soll das Blaulicht abschalten. Unser Freund wird sonst nur verstört. Lassen Sie mir etwas Zeit.“
Damit wandte er sich um und ging auf den Eingang zu, ohne sich noch einmal umzusehen.
Und dann kam noch jemand. Ein schlanker hochgewachsener Mann von dunkler Gesichtsfarbe. Er parkte seinen Mietwagen, den er sich vor einer Stunde unter falschem Namen geliehen hatte, in einer Seitenstraße.
Mit gesenktem Kopf, die Hände in den Taschen vergraben, ging er gemächlich die Straße entlang. Er wirkte wie ein Angestellter auf dem Wege nach Hause, völlig desinteressiert an seiner Umgebung. In Wirklichkeit registrierte er alles. Diese Fähigkeit hatte ihn bis jetzt überleben lassen.
Noch diesen einen Job, dann war er wieder sicher. Es tat ihm zwar um das Geld leid, das ihm nun entgehen würde. Aber seine persönliche Sicherheit hatte Vorrang. Aufträge erhielt er immer wieder. Killer hatten Konjunktur.
Es dämmerte schon. Die Tage wurden wieder kürzer. Auf der Straße herrschte kaum Verkehr, und auch Fußgänger waren kaum zu sehen. Er passte den richtigen Augenblick ab. Als in beiden Richtungen alles frei war, huschte er in den schmalen Zwischenraum zwischen den Häusern. In aller Ruhe sah er sich um.
Das Tor zu einer Tiefgarage war geöffnet, und ein Wagen stand davor. Vielleicht wollte Carruthers noch wegfahren.
Hinter einem der Fenster brannte Licht. Aber Besucher waren offensichtlich nicht gekommen, sonst hätten wohl mehr Lampen gebrannt. Lautlos schlich er auf die Garage zu, um von ihr aus ins Haus zu gelangen. Er setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, obwohl die Lärmkulisse der Großstadt das Geräusch seiner Schritte sicher übertönen würde.
In der Tiefgarage, die nur Platz für einen Wagen bot, gab es tatsächlich eine Tür. Er nickte befriedigt und drückte die Klinke herunter.
Die Tür war nicht verschlossen.
Lautlos verschwand er im Haus.
––––––––
30.
JOHN CARRUTHERS STARRTE Steve McCoy missmutig an. Fieberhaft dachte er nach. Er versuchte, einen Entschluss zu fassen, wollte dabei aber jeden Fehler vermeiden. Er wusste, dass es jetzt ums Ganze ging.
Steve McCoys Worte lasteten noch über ihm. Der Detektiv hatte gesagt: „Und deshalb haben Sie einen Killer gemietet, der für Sie die Schmutzarbeit machen sollte. Er hat ein Attentat auf Senator Joseph Clark verübt, damit die Nachfolgefrage akut werden konnte. Um MacLaren auszuschalten, wurde seine Schwester ermordet und der Verdacht auf MacLaren gelenkt.
Aber inzwischen fühlt sich der Killer selbst bedroht. Er räumt die Leute aus dem Weg, die ihn identifizieren können. Und da Sie vermutlich auch dazugehören, werden Sie der Nächste sein. Wahrscheinlich auch der Letzte. Außer Ihnen kann niemand mehr Hinweise auf den Killer geben. Ich selbst kenne nur seinen Decknamen: Sabato.“
Carruthers zog nervös an einer Zigarre. Er starrte auf seine Fußspitzen, und seine rechte Hand trommelte auf der Sessellehne.
Joan MacLaren hatte die Unterhaltung, die Steve McCoy fast allein bestritt, mit wachsendem Entsetzen verfolgt. Mit aufgerissenen Augen blickte sie zwischen den beiden Männern hin und her, als könne sie ihren Ohren nicht trauen. Ihre Hand krampfte sich um ein leeres Glas.
Im Raum herrschte drückendes Schweigen. Steve McCoy hatte die Situation im Griff. Er merkte, dass seine Worte Eindruck auf den Politiker machten. Carruthers hatte offensichtlich noch nicht daran gedacht, dass er ein Opfer seines eigenen Killers werden könnte. Zwischen ihm und Joan MacLaren tat sich eine Kluft auf. Die Frau würde ihren Liebhaber wie eine heiße Kartoffel fallenlassen.
Steve war zufrieden. Er war sicher, dass er Carruthers dazu bewegen konnte, alles zuzugeben. Dann endlich konnte er sich auf die Jagd nach dem Killer machen. Und Kevin MacLaren würde endlich frei sein.
„Das sind ungeheuerliche Anschuldigungen“, sagte Carruthers mühsam. „Sie können nichts davon beweisen.“
Steve spielte den Überlegenen.
„Es wird reichen. Sie sind auf jeden Fall erledigt. Mir kommt es nur noch darauf an, den Killer zu fassen.“
Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Bevor er Sie erwischt.“
Carruthers schüttelte langsam den Kopf. „Sie sind ja verrückt.“
Er blickte auf und sah zu Joan MacLaren hinüber. „Du glaubst doch wohl kein Wort von dieser idiotischen Geschichte? Der Mann weiß ja nicht, was er sagt. Du glaubst doch nicht, dass ich auf diese Weise versuchen würde ...“
Sie senkte den Kopf und begann, leise zu schluchzen. Das Glas fiel aus ihrer Hand, und sie schlug die Hände vor das Gesicht.
Rührend, dachte Steve. Sie spielt schon wieder eine neue Rolle. Diesmal die Enttäuschte und Hintergangene. Dabei war er überzeugt, dass sie einiges geahnt und wahrscheinlich sogar Hilfe geleistet hatte, um den tückischen Plan umzusetzen. Aber das war natürlich nicht zu beweisen.
Steve konzentrierte sich auf die beiden, damit ihm keine Regung entging. Und als er den leichten Luftzug hinter sich spürte, reagierte er zu spät.
Er ließ sich aus dem Sessel fallen und griff nach der Beretta. Doch da verhallte das Donnern des Schusses bereits.
Aus dem Augenwinkel sah er das fassungslose Gesicht von Carruthers, den die Kugel mitten auf der Nasenwurzel erwischt hatte. Der Sessel kippte nach hinten. Carruthers fiel mit einem dumpfen Geräusch zu Boden und riss einen kleinen Tisch mit. Glas klirrte, und ein Aschenbecher kollerte unter die Couch.
Joan MacLaren schrie hysterisch auf.
Das alles hatte nur einen Herzschlag lang gedauert. Steve sah, dass der Lauf der 44er Magnum langsam herumschwenkte, und die Mündung erschien ihm wie ein Ofenrohr.
Der Killer stand auf gespreizten Beinen in leicht gebückter Haltung, die Arme ausgestreckt. Den Kolben der Waffe umklammerte er mit beiden Händen.
Auch der nächste Schuss war ohrenbetäubend. Steve hatte sich in letzter Sekunde herumgeworfen. Die Pistole lag in seiner Faust. Er feuerte zurück, traf aber nur ein Bild an der Wand.
Gleichzeitig spürte er den Schlag gegen seinen linken Oberarm. Er spürte keinen Schmerz. Kühl, fast sachlich registrierte er, dass er getroffen war, aber nicht tödlich. Noch hatte er eine Chance.
Seine Waffe bellte zweimal kurz hintereinander, und mindestens ein Schuss traf. Der schlanke Mann stöhnte auf und zog sich hastig zum Ausgang zurück.
Sein letzter Schuss zertrümmerte einen kleinen Tisch, zerfetzte die Füllung eines Sessels und schlug schließlich in die Wand dicht über dem Boden ein.
Steve stand schwankend auf und presste die rechte Hand mit der Pistole gegen den linken Arm, der kraftlos herunterhing. Der Ärmel war bereits blutdurchtränkt. Es tropfte auf den hellen Teppichboden. Es war ein glatter Durchschuss. Langsam meldete sich pochender Schmerz. Er biss die Zähne zusammen und drehte aus dem zerrissenen Ärmel eine provisorische Aderpresse.
Dann stolperte er hinter dem Killer her. Es war seine letzte Chance. Er warf einen raschen Seitenblick zu Joan MacLaren, die immer noch schrie.
Der Killer rannte die Treppe hinunter. Steve schoss zweimal, traf aber nicht. Er spürte, dass seine Wunde immer noch blutete. Er brauchte dringend einen ordentlichen Verband und musste sich beeilen, ehe er endgültig außer Gefecht war.
Auf der Straße konnte er den Killer zwar nicht direkt sehen, denn er hatte sich hinter einen der großen Blumenkübel geduckt. Dort konnte er seinerseits nicht verschwinden, ohne eine Kugel zu riskieren. Steve rannte zu dem schweren Lincoln vor der Garageneinfahrt.
Heute war sein Glückstag. Der Schlüssel steckte noch. Steve ließ den Motor an und gab Vollgas. Die durchdrehenden Räder schleuderten kleine Steinchen gegen die Hauswand. Steve kurbelte am Steuer und hatte Mühe, den schweren Wagen mit einer Hand auf der Bahn zu halten. Er merkte auch, dass er langsamer zu reagieren begann. Die Verletzung machte ihm zu schaffen.
Der Killer hatte eiserne Nerven. Eine Sekunde, bevor der Wagen den Blumenkübel traf, schnellte er hoch und sprang mit einem gewaltigen Satz zur Seite.
Steve warf das Steuer erneut herum. Die Servolenkung machte sich bezahlt. Der Wagen schrammte kreischend an dem Betonkübel entlang.
Steve spürte einen harten Schlag. Der Killer war von einem Kotflügel getroffen worden. Der schlanke Mann wurde zwei, drei Meter durch die Luft geschleudert und fiel gegen den Blumenkübel.
Steve stieg auf die Bremse, und der Lincoln kam schleudernd zum Stehen. Er ließ sich hinausfallen und lief zu Sabato hinüber.
Er brach fast in die Knie, als er den Killer erreichte. Seine Pistole hatte er irgendwo verloren.
Sabato lag mit dem Gesicht nach unten mitten zwischen heruntergefallenen Blumen, die Arme weit ausgebreitet. Wenige Zentimeter neben seiner rechten Hand lag die 44er Magnum.
Steve trat die Waffe mit einem heftigen Fußtritt zur Seite. Dann beugte er sich hinunter.
Der Killer rührte sich nicht.
Steve zerrte ihn unter Aufbietung aller Kräfte hoch und wälzte ihn auf den Rücken.
Er schluckte und musste sich abwenden.
Der Kopf stand in einem unnatürlichen Winkel zur Seite. Die Augen starrten weit aufgerissen in den dunklen Himmel. Sabatos Genick war durch den Sturz gebrochen. Er würde niemanden mehr umbringen können.
Steve McCoy hörte halb im Unterbewusstsein das Schlagen von Wagentüren, Rufe und Schritte. Langsam sank er neben dem toten Killer zu Boden. Rote Nebel wallten vor seinen Augen.
Dr. Highwood und Lieutenant Anderson, die sich über ihn beugten, erkannte er nicht mehr.
––––––––
31.
„ICH WEIß NICHT, WIE ich Ihnen für das danken soll, was Sie für mich getan haben“, sagte Kevin MacLaren zu Steve McCoy, der entspannt in einem Sessel saß. Seinen linken Arm trug er in einer Schlinge.
Steve zuckte mit den Schultern. „Für Ermittlungen werde ich bezahlt. Es tut gut, auch mal einen Unschuldigen vom Verdacht zu befreien, als immer nur Schuldige zu verfolgen.“
„Ich hoffe, Sie können Ihren Arm bald wieder gebrauchen“, entgegnete MacLaren.
Steve machte eine vage Geste. „Halb so schlimm. Der Arzt sagt, in zwei Wochen merke ich davon nichts mehr. Ich habe Glück gehabt.“
„Na ja, ich glaube, wir gehen dann wieder“, mischte sich Dr. Highwood ein und sah Steve McCoy ein wenig unsicher an.
MacLaren streckte seiner Frau die Hand entgegen. Sie hatte bisher noch kein Wort gesagt. „Komm. Das Ganze hat dich doch sehr mitgenommen.“
Der Anwalt tauschte einen kurzen Blick mit Steve. Dann erhob auch er sich, und er ging mit Steve zur Tür.
Eine halbe Stunde später saß er mit Highwood in dem Café am Bryant Park, das er schon von ihrem ersten Treffen kannte. Es war erst wenige Tage her, in denen viel passiert war. Auch Colonel Alec Greene war natürlich wieder dabei.
„Das war alles ziemlich überraschend“, begann der Anwalt. „Ich hätte nicht gedacht, dass Sie den Fall so schnell aufklären können.“
Steve nahm einen Schluck von seinem Espresso. „Die Rolle von MacLarens Frau ist jedoch immer noch nicht ganz klar. Damit wird sich ihr Mann auseinandersetzen müssen. Ich denke, sie hat ihn ganz schön hintergangen.“
„Wir haben eine politische Krise verhindert, ehe sie sich richtig ausbreiten konnte“, stellte der Colonel zufrieden fest. „Die Medien haben nicht die ganze Wahrheit erfahren, und der Justizminister ist glücklich.“
„Ist schon merkwürdig, wenn man selbst als Einziger alle Tatsachen kennt“, sinnierte Steve.
Die beiden sahen ihn nur schweigend an.