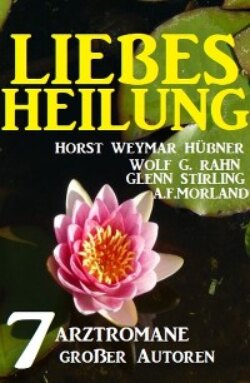Читать книгу Liebesheilung: 7 Arztromane großer Autoren - A. F. Morland - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
19
Оглавление'Denk an was Schönes!' Seine Worte beschäftigten sie.
Die schönste Zeit hatte sie mit ihm verlebt. Die Jugendjahre davor, da hatte es Schwärmereien gegeben, nette Erlebnisse, aber ohne Tiefgang und nachhaltige Erinnerung.
Sie starrte zur Decke hinauf und betrachtete die Sprünge, die das Aussehen von überdimensionalen Spinnen hatten.
Spinnen – ihre Gedanken kehrten zu den Dias zurück, die sie gestern zu Hause gerahmt hatte, uralte Aufnahmen, verbunden mit ganz besonderen Erinnerungen, und wanderten weit in die Vergangenheit.
Da war die Wohnung, die sie sich gemietet hatten. Ein verwohntes Loch, das erst renoviert werden musste.
Geld hatten sie kaum welches. Also behalfen sie sich mit Farbe, Eifer und Ausdauer.
Jeden Abend, wenn sie nach der Arbeit heimkamen, saßen auf den frisch abgerollten Wänden und Decken Spinnen. Die Tiere waren durch die angekippten Fenster hereingekrochen.
Oh, was war sie wütend geworden!
Die Fenster mussten halb geöffnet bleiben, damit die Feuchtigkeit entwich. Einmal hatte sie sie geschlossen. Abends lief buchstäblich die Brühe von den Wänden.
Die Spinnen wurden Dauergäste, weil die Wohnung zur ebenen Erde lag.
Anfangs hatte sie sich schrecklich gegrault, war auch mit dem Staubsauger auf die Tiere losgegangen und hatte sie ins Rohr zischen lassen.
Einige waren nach Stunden wieder hervorgekommen, um sich sofort auf die Suche nach einem günstigen Platz zu machen, wo ein Netz gesponnen werden konnte.
Endlich war die Wohnung fertig, die Möbel konnten kommen, die sie anbezahlt hatten.
Sie kamen nicht.
Nicht zum vereinbarten Termin, auch nicht am nächsten Tag.
„Die bringen sie schon“, sagte Walter. Er hatte ein sträfliches Gottvertrauen in die Ehrlichkeit der Leute.
Sie gab noch einen Tag zu, dann stieg sie entschlossen in den kleinen gemeinsamen Wagen und fuhr nach Köln.
Das Herz blieb ihr fast stehen, als dort, wo vor sechs Wochen noch Möbel die Auslagen geziert hatten, das Markenzeichen einer Automobilfirma auf den Schaufenstern prangte.
Von der Möbelfirma keine Spur! Auch keine Nachricht in der Tür!
Sechshundert Mark weg! Und keine Möbel!
Sie war außer sich und lief in die Tankstelle schräg gegenüber. Vielleicht wusste man da etwas.
Drei Männer schauten ihr grinsend entgegen. Ihr Benehmen verriet, dass sie sie schon geraume Zeit beobachtet hatten, wie sie drüben verstört von einem Schaufenster zum anderen geirrt war, in der Hoffnung, einen hinters Glas geklebten Zettel zu entdecken.
„Na, na, junge Frau, nicht gleich aufregen!“, sagte ein gemütlicherer älterer Mann. „Sie suchen wohl auch Möbel? Da waren schon einige Leute da.“
„Ist die Firma pleite?“, war ihre bange Frage.
„Umgezogen ist die. Hat jetzt eine Toplage. Fahren Sie rein zum Wiener Platz, drum herum und in die Frankfurter Straße hinein. Ist schon von weitem zu sehen. – Ein Saftladen, wenn die Kunden nicht vom Umzug benachrichtigt werden.“
Sie stob hinaus und fuhr weiter.
Die Firma war da. Die Möbel auch.
Anderntags wurden sie geliefert. Sogar richtig und ohne Anlass zu Beanstandungen.
Die sechshundert Mark waren gerettet.
Sehr viel zuversichtlicher blickte sie dem Hochzeitstermin entgegen.
Bevor es so weit war, platzte die Sache mit dem neuen Wagen dazwischen.
Walter bekam einen Anruf von seiner Mutter; in der Ehe war die große Krise ausgebrochen. Kurz entschlossen fuhr er noch abends nach Süddeutschland. Im Morgengrauen stand er wieder vor der Tür, hatte die Mutter dabei und den Wagen erledigt. Auf der Autobahn hatte er das kleine Fahrzeug derart gescheucht, dass das Motorengehäuse gerissen war.
Mit den Finanzen hatten sie sich gerade bekrabbelt.
Der neue Wagen warf sie in die roten Zahlen zurück. Noch vor der Hochzeit.
Wildbewegte Tage waren das, die ihre Nerven bis an den Rand der Belastbarkeit strapazierten. Bei aller Aufregung waren es aber auch schöne Tage.
Dann die Hochzeit. Eine neuerliche Nervenprüfung.
Walter war den Vorabend mit Freunden aufgebrochen, um Abschied vom Junggesellenleben zu nehmen und einen letzten flotten Zug durch die Gemeinde zu machen.
Um neun war die standesamtliche Trauung, und um neun war er nicht da. Dafür war ihr Elternhaus voller Gäste, die teils schockiert, teils ergrimmt und teils amüsiert der weiteren Entwicklung der Dinge harrten.
Zehn nach neun erschien Walter, mit Knöpfen auf den Augen und leicht beduselt, aber mit einem wunderschönen Brautbukett. Die allgemeine Aufregung erreichte ihren absoluten Höhepunkt, als er, statt mit ihr und den Trauzeugen nun spornstreichs zum Standesamt zu fahren, sich gemütlich niederließ und seelenruhig ein ausgewachsenes Frühstück vertilgte.
Endlich bequemte er sich, und im neuen Wagen machten sie die Einweihungsfahrt.
Im Standesamt stellte sich heraus, die die ganze Aufregung für die Katz war. Der Standesbeamte hatte sich in der Uhrzeit geirrt, es war noch ein Paar vor ihnen. Ihre Trauung war erst um zehn.
Das vergnügte Gesicht von Walter entschädigte für den Nervenkitzel am Morgen und so erbauliche Sprüche wie: „Er hat es sich noch anders überlegt.“
Vor der Tür des Trauungszimmers warteten ein paar zerknitterte Zechkumpane und sparten nicht mit ermunternden Zurufen. „Sag nein!“
„Jetzt kriegst du lebenslänglich!“
Und was machte Walter? Als der Standesbeamte von ihm das „Ja!“ hören wollte, erklärte er rundheraus: „Ohne meinen Anwalt sage ich hier kein Wort!“
Zum Glück war der Beamte ein humorvoller Mensch, und die Zeremonie kam zu einem guten Abschluss.
Danach stellte sich eine ausgelassene Fröhlichkeit ein, die schließlich auch auf die Hochzeitsgäste übergriff.
Die kirchliche Trauung – der Höhepunkt, die schönste Stunde dieses Tages. Sie im schneeweißen Kleid, Walter, der Hallodri, an ihrer Seite. Etwas stolz war sie doch darauf, dass er nun ihr Mann war. Ein paar Freundinnen von ihr hatten sich die Augen nach ihm ausgeguckt und hätten ihn halt auch gern für sich gehabt.
Dabei besaß er keinen guten Ruf, was Zuverlässigkeit und Treue in Liebesdingen betraf. Laufend neue Freundinnen. Einmal, als sie ihn darauf ansprach, sagte er belustigt: „An diesem schlechten Ruf habe ich jahrelang hart gearbeitet und weder Zeit noch Kosten gespart.“
Leise Sorge mischte sich in ihre Freude über diesen ihren schönsten Tag. Wenn er untreu war und sich heimlich eine Freundin hielt, was dann?
Sie wurde angenehm überrascht. Er legte mit diesem Tag seine Junggesellengewohnheiten ab. Langweilig wurde es jedoch nie in der Ehe. Dazu steckte er zu sehr voller Ideen und Einfälle, und für Überraschungen war er jede Stunde eines jeden neuen Tages gut.
Auf ihrer Hochzeit erfuhr sie gegen Abend von seiner Wirtin, bei der er zwei Jahre zur Untermiete gewohnt hatte, was sich in der Junggesellenabschiedsnacht beziehungsweise am Morgen abgespielt hatte.
Den Wecker hatte sie auf sieben gestellt; sie wollte ihn wecken, damit er die Kurve kriegte bis zur Trauung um neun. Um sechs kam er nach Hause. Als er die Treppe oben war, brauchte sie keinen Wecker mehr. Bis um sieben lag sie wach, dann klopfte sie energisch an seine Tür und wider Erwarten meldete er sich sofort und versprach folgsam, jetzt aufzustehen.
Sie legte sich wieder hin, schlief beruhigt noch ein Stündchen und war beim Munterwerden gegen acht felsenfest der Meinung, er sei schon aus dem Haus, weil sie so gar nichts hörte.
Also frühstückte sie in aller Ruhe und machte sich dann daran, sein Zimmer aufzuräumen. Ein gewaltiger Schreck ergriff sie, als die Tür noch von innen abgeschlossen war.
Sie hämmerte und trommelte gegen das Holz und war mit den Nerven ziemlich herunter, als sich drinnen endlich gähnend und verkatert der hoffnungsvolle Hochzeiter meldete.
Sie schimpfte und lamentierte, bat und flehte und hielt ihn zur Eile an. Und was machte er? Ein Bad sollte sie ihm einlassen, das als erstes!
Alle Minute war sie dann an der Badezimmertür aufgetaucht, klopfte und rief ihm die Uhrzeit zu – einmal, um zu hören, ob er nicht untergegangen war, und zum anderen, um ihn anzutreiben.
Schließlich stand er vor ihr, fünf Minuten vor neun; das Bad hatte nur ungenügend die Falten aus ihm herausgebügelt. Sie bürstete ihm den Anzug ab und bat inständig, er solle nun endlich zu seiner Braut fahren, man habe schon dreimal angerufen.
Da lachte er entwaffnend und sagte, sicher fahre er hin, ihm dämmere, dass heute eine Hochzeit sei, aber erst müsse er noch den Brautstrauß beim Blumengeschäft in der Stadt abholen.
Da hatte sie besser gar nichts mehr gesagt, aber auf die Galle geschlagen sei ihr das doch. Das sei ein Mannsbild! Mit dem könne sie noch einiges erleben!
Die Prophezeiung der Wirtin ging in Erfüllung, aber mehr im positiven Sinne.
Einen Tag nach der so turbulent begonnenen Hochzeit fuhren sie in die Flitterwochen. Mit tausend Mark in der Tasche. Geldgeschenke, die es gegeben hatte. Die Anzahlung für den neuen Wagen, die restlichen Möbel, die Wohnungsrenovierung und die Bewirtung der Gäste hatten ihre verfügbaren Barmittel auf gezehrt, bei der Bank standen sie schon mit zwei Monatsgehältern in der Kreide.
Ohne die Geldgeschenke hätten sie gar nicht in die Flitterwochen fahren können.
Bei Walters Eltern in Süddeutschland machten sie Station und deponierten vierhundert Mark. Die hatten Beziehungen zu einem Textilgroßhandel; auf der Rückfahrt sollten dort die Übergardinen gekauft werden.
Aufs Geratewohl fuhren sie los. Ziel sollte das nette Familienhotel in Riccione sein, in dem sie während der Verlobungszeit schon mal gewohnt hatten. Damals sittsam in getrennten Zimmern, weil’s die Hotelinhaberin nicht anders duldete.
Vorbestellt war natürlich nicht. Es war ja ziemlich unsicher gewesen, ob sie jetzt überhaupt die Hochzeitsreise machen konnten.
Die Autostrada gab es noch nicht. Man zuckelte in der Kolonne den Brennerpass hinauf.
Walter hatte hier schon getrampt, mit dem Fahrrad war er ebenfalls in Italien gewesen. Seit damals hatte er eine Vorliebe für den Gardasee und für die Occidentale, die Straße auf dem Westufer.
Also kam nur diese Strecke in Frage.
Unbeschwert und fröhlich in ihrem Glück fuhren sie in den Tag hinein, bis in Peschiera am Ausfluss des Gardasees die Unbeschwertheit der Sorge um eine Bleibe für die Nacht wich.
Noch war Hauptsaison, es wimmelte von Touristen. Diesen Umstand hatten sie nicht in ihre Überlegungen einbezogen.
Die Hotels, in denen sie anfragten, waren voll besetzt oder zu teuer.
Sie waren schon fast wieder aus Peschiera heraus, als Walter linker Hand zwei riesige Segelschiffe entdeckte, die vertäut am Ausrüstungskai lagen.
„Ich werd’ verrückt! Piratensegler! Du – die drehen bestimmt einen Film“, sagte er. Segelschiffe waren eine Leidenschaft von ihm. Und die zwei Segler sahen auch wirklich imponierend aus. Dass er die Schiffe entdeckte, war weniger ein Zufall, denn er blickte beim Fahren mehr nach rechts und links in die Landschaft als auf die Straße.
Er trat auf die Bremse und spähte nach einem Parkplatz. Ein mittleres Verkehrschaos war die Folge, weil sich zu dem Strom der Touristenfahrzeuge noch der einheimische Feierabendverkehr gesellte.
Ein Polizist mit Tropenhelm versuchte, das Knäuel zu entwirren. Vom Fahrbahnrand auf der Höhe der Kasematten der alten Festung betrachteten grinsend etliche Halbwüchsige das angerichtete Durcheinander; geschäftstüchtig brüllten sie zwischendurch den Lenkern der Fahrzeuge mit ausländischer Nummer ihr „Camere! Zimmer!“ zu.
Walter war wie elektrisiert. Zimmer! Weit von hier konnten sie nicht liegen. In jedem Falle in der Nähe der Segler!
Er schlängelte den Wagen aus dem Chaos und gab einem der Burschen zu verstehen, dass Interesse an den angebotenen Zimmern bestand.
Wie der Blitz schwang sich ein Junge barfuß auf ein klappriges Rad, um den Weg zu zeigen.
Ein Krach! Der Bengel balancierte mühsam auf dem Fahrrad, kämpfte ums Gleichgewicht und schaffte es.
Die Kette war gerissen.
Der Geschäftssinn dieser Jüngstkaufleute war besser ausgeprägt als das Konkurrenzdenken.
Einer hielt sofort seinen Drahtesel bereit, der Pechvogel stieg um und führte triumphierend seine Beutetouristen in eine Seitenstraße unweit des Hafens. Die Mastspitzen der Segler waren über dem verstaubten Grün der Bäume und den Hausdächern zu sehen. Walter nahm das aufmerksam zur Kenntnis.
Da wusste sie schon, wohin es morgen früh zuerst gehen würde, bevor die Weiterfahrt angetreten wurde.
Vor einer Pension, fast völlig hinter Weinblattgeranke und Pfirsichbäumen mit schönen großen Früchten versteckt, hielt der geschäftstüchtige Quartierbeschaffer und kassierte ein gediegenes Trinkgeld für seine Bemühungen.
Die Wirtsleute kamen aus der Tür, und dabei stellte sich heraus, dass der Bengel der jüngste Spross des Ehepaares war.
Besonders komfortabel sah die Pension weder von außen noch von innen aus. Die Gäste, die im Garten unter einem schattigen Weinblätterdach saßen, waren Italiener, einfache Leute, höflich, fröhlich.
Das Haus entpuppte sich als Familienpension. Den fehlenden Luxus ersetzte es durch Sauberkeit und eine urige Atmosphäre. So richtig eine Ecke zum Wohlfühlen.
Dabei war das Zentrum der Stadt keine fünfhundert Meter entfernt, der brodelnde Lärm drang bis in den Garten dieser unvermuteten Idylle.
Es bestand Meldepflicht. Wegen der Vorgänge in Südtirol.
Beim Unterschreiben der Meldekarte brachte sie das Kunststück fertig, mit ihrem Mädchennamen zu unterschreiben. Die Macht der Gewohnheit.
Die Brauen des leutseligen Pensionswirtes wanderten ausdrucksvoll in die Höhe, als er die verschieden lautenden Namen verglich. Er hielt sodann eine eindrucksvolle Rede, die sie nicht verstanden. Aber sie wussten, worum es ging.
Um das Doppelzimmer.
Verwirrt und verlegen kramte sie ihren nagelneuen Reisepass aus der Tasche. Der Wirt studierte die Eintragungen, eine mit Händen und Füßen geführte Unterhaltung setzte ein, und allmählich verstand der gute Mann, dass Hochzeitsreisende bei ihm abgestiegen waren.
Sein Gesicht begann zu glänzen wie der Vollmond. „Mama! Mama!“ Er schoss davon und rief im Haus unverständliche Worte.
Nacheinander tauchten in Türen und Fenstern freundliche Gesichter auf. Man nahm Anteil, man freute sich und zeigte es ungezwungen.
Die Matrone kam aus der Küche, wischte die Hände an der Schürze ab und schüttelte die Hände. Sie redete und lachte. Diese Leute hatten Gefühle und zeigten sie auch.
Ächzend schleppte der Wirt schließlich einen der Koffer in den ersten Stock und schloss das Zimmer auf. Der Raum war mindestens drei Meter hoch und besaß eine Miniaturveranda mit altem Eisengeländer. Trotz geöffneter Verandatür und sperrangelweit aufstehender Fenster war es kochend warm.
Einladend wies der Wirt zu seiner Veranda, trat durch die Tür, beugte sich übers Geländer und war schon mit dem Oberkörper im Blätterwerk eines Pfirsichbaumes verschwunden. Als er wieder zum Vorschein kam, präsentierte er vier herrliche Pfirsiche und überreichte sie ihr mit der Grandezza eines wahren italienischen Kavaliers.
„Per la bionda signora! Ah que bella!“
Er war ganz hingerissen und sie sehr geschmeichelt.
Der Winter der Pension und die emsige Mama brieten, brutzelten und sotten bis Mitternacht für die Gäste im Garten, wo man in fröhlicher Ausgelassenheit noch einige Zeit zusammenblieb.
Für sie war diese Verlagerung des geselligen Lebens in die Abend und Nachtstunden die Auffrischung einer als sehr angenehm empfundenen Erfahrung.
Nur verbarg sich hinter dem noch längeren Ausharren der italienischen Pensionsgäste im Garten eine ganz nüchterne Erklärung; schließlich hatten die Leute auch die größere Erfahrung.
Das waren die Schnaken!
Die Wassergräben am Seeausfluss, die Wasserflächen rings um die Kasematten der alten Festung und das streckenweise schilfbestandene Ufer waren ideales Vermehrungsgebiet für die Biester.
Kaum knipste Walter das Licht aus – sirrr, da stürzten sich die kleinen Aasgeier schon zu Dutzenden von der Decke.
Licht wieder an und es herrschte Ruhe.
Licht aus – der Angriff begann erneut.
Bei Licht konnten sie nicht schlafen, trotz der angenehmen Müdigkeit, die auf die Klimaveränderung und die andere Art des Lebens zurückzuführen war.
Walter drehte ein Handtuch zusammen und eröffnete die Abwehrschlacht gegen schätzungsweise fünfhundert Schnaken.
Es wurden immer mehr.
Schließlich begriffen sie, dass es besser war, die Verandatür zu schließen. Das Licht lockte die Plagegeister an.
Die Schnaken sahen ihr Heil darin, dem wedelnden Handtuch zu entwischen. Also setzten sie sich an die Decke. Drei Meter hoch.
Allmählich kam Walter in Rage. Er drehte das Handtuch noch mehr zusammen und warf es an die Decke. Leider entfaltete es sich unterwegs und kam nicht einmal bis nach oben. Ein paar Schnaken wurden vom Luftzug vertrieben. Das war der ganze Erfolg.
Plötzlich hielt er das Handtuch unter den Wasserhahn und machte es nass. Ausgewrungen und zusammen gedreht ließ es sich als solides Wurfgeschoss verwenden.
Er richtete in dieser Nacht ein Massaker unter den Schnaken an. Alle zwei, drei Minuten sauste das Handtuch an die Zimmerdecke und erschlug mit sattem Klatschen bis zu einem Dutzend Plagegeister.
Im Morgengrauen war die Schlacht entschieden, selig schlief Walter ein.
Was er nicht beachtet hatte, war die Hellhörigkeit der Pension. Jedenfalls gab es beim Frühstück ringsum fragende, verwirrte, verblüffte, auch ein paar grinsende Gesichter. Den Leuten war nicht verborgen geblieben, dass die seltsamen Geräusche die ganze Nacht über aus dem Zimmer der deutschen Hochzeitsreisenden kamen. Na ja, man zeigte Verständnis. Man besaß ja Phantasie. Doch was sich wirklich abgespielt hatte, ahnte wohl keiner der Gäste.
Hastig beluden Walter und Eva-Maria ihren Wagen und fuhren hinüber zum Ausrüstungskai.
Eine herbe Enttäuschung wartete auf Walter. Aus der Nähe gesehen, waren die stolzen Segler nur noch hässliche und lieblos zusammengenagelte Pötte. In den Rümpfen klafften Löcher. Nicht die Spuren einer Filmschlacht, denn hinter den Löchern schimmerte roter Rost.
Die Segler waren nichts anderes als Attrappen. Auf eiserne Lastkähne waren Segler aufbauten und Rümpfe gesetzt.
Von einem leidlich Deutsch sprechenden Fiatfahrer erfuhren sie, dass die Schiffe zum Abwracken hier vertäut lagen. Den Film hatte man schon in den Wintermonaten gedreht. Ohne den Touristenrummel an den Ufern und den Schlauchbooten, Luftmatratzen, Segelbooten und Motorflitzern auf dem See. Das Tragflächenboot von Riva nach Desenzano und Sirmione und retour hatte während der Dreharbeiten sogar den Verkehr eingestellt. Aber im Winter sei hier ohnehin nicht viel los.
Durch Pappelalleen fuhren sie weiter. Vorbei an traumhaften Villen, Bauernhäusern, versteckt in den Weinfeldern, aber mit Toreingängen an der Straße wie Renaissanceschlösser.
In Ferrara verfranzte sich Walter. Die Beschilderung war unter aller Kritik. Gereizt landeten sie schließlich vor einem alten Gemäuer, das sich „Da vecchia gitarra“ – Zur alten Gitarre – nannte. Im Schatten parkten Autos mit Kennzeichen aus Mailand und Rom. Wo weitgereiste Leute saßen, musste die Küche gut sein.
Sie stellten den Wagen in den Schatten und betraten die „Gitarre“.
Im ersten Moment glaubten sie, in ein Weinlager geraten zu sein. An den Wänden Regale voller Flaschen. Es gab jedoch auch Tische. Und es duftete verlockend.
Walter war großzügig und überließ dem Wirt die Zusammenstellung des Essens. Der Spaß riss ein großes Loch in die Urlaubskasse, dafür speisten sie aber in einem Lokal, das schon fast alle Größen der italienischen Kunstszene und der Politik als Gäste erlebt hatte. Die Bilder der Besucher hingen mit Widmung überall dort, wo die Flaschenregale Platz ließen.
Sie erfuhren bei dieser Gelegenheit auch noch, dass der Wirt eine Art Weinmuseum mit Ausschank unterhielt. Jede halbwegs ordentliche Weinlage des gesamten Landes war in den Regalen vertreten und durfte getrunken werden. Die Flasche ab zwanzig Mark aufwärts umgerechnet.
„Man heiratet so selten“, flachste Walter und bestellte eine Flasche.
Recht beschwingt verließen sie später das angenehm kühle Lokal, stiegen in den kochend heißen Wagen und verbrannten sich ums Haar die edleren Körperteile an den fast glühenden Kunststoffsitzen. Inzwischen war nämlich die Sonne weitergewandert und mit ihr auch der köstliche Schatten.
Unter dem Einfluss der Hitze verwandelte sich ihre Beschwingtheit in einen handfesten Schwips. Walter behielt als Orientierungshilfe die Mittelstreifenmarkierung der Straße unter dem Wagen, die Bäume zischten rechts und links nur so vorbei.
Ein sträflicher Leichtsinn.
Ohne Schramme kamen sie irgendwie ans Ziel, und im Hotel hatte man sogar ein Zimmer für sie frei. Sie waren ja schon fast Stammgäste.
Die Tage waren wunderschön und vergingen mit Faulenzen, Schwimmen und Glücklichsein viel zu rasch.
Walter unternahm den Versuch, sich das Rauchen abzugewöhnen. Bis er an einem schönen Morgen aus heiterem Himmel einen Streit vom Zaun brach und gereizt war wie ein Schwarm Wespen.
Auf der Stelle kaufte sie ihm eine Schachtel Zigaretten. Ein rauchender Ehemann war ihr lieber als ein knurrender, der schon in den Flitterwochen ungenießbar war.
Nachdem die Hotelrechnung beglichen war, befand sich nicht mehr viel in der Urlaubskasse. Sie tankten den Wagen voll und fuhren heimwärts, mit einem Fünfzig Mark Schein in der Tasche und etwas Hartgeld, so an die fünfundzwanzig Mark.
Wieder ging es Richtung Gardasee.
An der Straße lag eine Gärtnerei und bot Palmen, Oleander und Agaven feil.
Lebende Pflanzen mochten sie beide, daheim in der Wohnung machte sich mitgebrachtes Grünzeug sicher sehr gut, und warum sollten sie nicht eine Erinnerung an ihre schöne Hochzeitsreise mitnehmen?
Für fünfzig Mark konnte man natürlich auch unterwegs noch mal übernachten.
Die Entscheidung fiel nicht schwer. Sie luden den Wagen mit Oleander in Töpfen und Agaven voll und fuhren weiter. Um Mitternacht langten sie auf dem Brenner an. Es musste nachgetankt werden. Auf italienischer Seite noch, weil’s da billiger war.
Der Tankwart musste erst vom Billardtisch weggeholt werden. Walter stand neben der Zapfsäule und rechnete fieberhaft. Bei ungefähr einundzwanzig Mark war der Tank voll.
„Nehmen Sie auch deutsches Geld?“
Der Tankwart stutzte. „Si!“
Walter grub ihr restliches Vermögen aus der Tasche. „Auch Hartgeld?“
Er zählte zweiundzwanzig Mark ab und drückte sie dem Mann in die Hand.
Erschüttert blickte der Tankwart auf die Münzen. Er rechnete, dann nickte er widerstrebend.
Sein Blick drückte aus, dass er solche Kunden nicht oft zu sehen wünschte.
Mit dem Sprit mussten sie auskommen, egal wie. Walter fuhr verhalten. In der Nacht war wenig Verkehr.
Morgens um sieben setzte er das restliche Geld in der Autobahnraststätte Augsburg in eine Portion Sauerkraut mit Würstchen um. Die teilten sie sich.
Und die fünfzig Pfennig Wechselgeld bildeten ihre eiserne Reserve.
Bei den Schwiegereltern war das Gardinengeld deponiert. Das war ein Trost. Hätten sie es bei sich gehabt, es wäre garantiert auch ausgegeben worden.
Walter zweigte das Benzingeld für die restliche Strecke nach Hause ab, und später lachten sie oft darüber, wenn er behauptete, deswegen seien die Übergardinen etwas kürzer ausgefallen.
Eine Tür klappte. Eva-Maria schreckte aus ihren Erinnerungen und Gedanken hoch. Verwirrt blickte sie um sich.
Das war nicht Italien, sie war nicht auf der Hochzeitsreise. Hier war das Krankenhaus. O Gott ...! Die quälende Angst kam wieder.
Eine Schwester mit mütterlichem Gesicht trat ans Bett. Aus einer Lage Gaze hob sie eine fertig aufgezogene Spritze mit wasserklarem Inhalt.
„Ich bin Schwester Else“, stellte sie sich vor. „Ich gebe Ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze. Dann machen wir die Rasur.“
Es piekste etwas, als die Nadel einstach.
Ein sanftes Kribbeln breitete sich in Eva-Marias linkem Arm aus.
„Blut nehme ich Ihnen gleich noch ab“, versprach Schwester Else. Plötzlich weiteten sich ihre Augen. „Was ist denn das? Sie haben noch die Fingernägel lackiert? Etwa auch die Fußnägel?“ Resolut hob sie die grünen Tücher an. „Das machen wir aber gleich herunter.“
„Wozu?“
„An Finger und Zehenspitzen messen wir immer die Sauerstoffversorgung des Patienten. Lackierte Nägel und Zehen stören dabei. Stellen Sie sich außerdem mal vor, wenn ein winziger Splitter abgeht und ins Operationsgebiet gerät! Tragen Sie eine Zahnprothese? Die müssten Sie herausnehmen.“
„Nein, ich habe noch meine eigenen.“
Strahlend blickte die Schwester auf sie herab. „So ist es brav, nur schön ruhig bleiben. Wie fühlen Sie sich jetzt?“
„Müde. Schlafe ich ein?“
„Besser nicht. Das machen wir dann später.“
Wieder klappte die Tür. Leises Räderrollen durchdrang die Stille.
Eine zweite Schwester erschien.
Eva-Maria fühlte sich matt, schwach und elend. Aber nicht beunruhigt.
Fast im Unterbewusstsein nahm sie wahr, dass die Schwestern sie rasierten, dann den Nagellack entfernten, schließlich eine Stauschlinge um den linken Oberarm legten und Blut aus der Vene entnahmen.
Dann war sie wieder allein – allein mit ihren nagenden, bohrenden Zweifeln und ihren Erinnerungen.
Was Walter jetzt machte? Nach Hause fahren?
Was wurde aus Tina?
Und was aus beiden, wenn sie sterben musste, wenn die Operation nicht glückte?