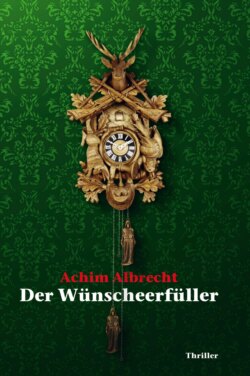Читать книгу Der Wünscheerfüller - Achim Albrecht - Страница 11
VI.
ОглавлениеLeugnen Sie nicht, dass Sie mir in Gedanken den Bruch meiner Vorsätze und den Verrat an den Interessen von Susi, der Krautsalatkünstlerin, vorgeworfen haben. Warum, denken Sie, bin ich mit dem Bus zum Bahnhof unterwegs? Ein aufstrebender Geschäftsmann wie ich hatte wahrlich andere Dinge zu tun, als in einer tristen Kleinstadt im Winter Busfahrten zu unternehmen. Eine Kreuzfahrt läge da schon näher. Meine platonische, aber ungebrochen intensive Zuneigung zu Susi war der Grund für diese Ausflüge. Ich breche niemals meine Versprechen, auch wenn ich sie nur mir selbst gegenüber abgegeben habe und kein anderer davon weiß. Das ist ein eherner Grundsatz.
Ich war nicht nur ein Altruist, sondern auch ein Determinist. Aber das wissen Sie ja schon. Determinismus ist Entschlossenheit und Vorbestimmung. Ich ging meinen Weg und fühlte, dass es der richtige war. Er gab mir Halt und Richtung und wenn andere wie Susi davon profitieren konnten – umso besser. Was ich damit sagen will: Ich war kein Robin Hood, kein uneigennütziger Wohltäter und keiner der selbstlosen Superhelden, die anonym und missverstanden in ihren Superheldenkostümen vegetierten, bis ein Bösewicht sie erneut auf den Plan rief. Nein, so war ich wahrlich nicht. Was ich tat, machte ganz einfach Spaß und ich wüsste nicht, was dagegen spräche, auch noch einen ungewöhnlichen Broterwerb damit zu verknüpfen.
Determinismus hat als Quersumme der Buchstabenwerte die „Sieben“. Ich hoffe, es klingelt bei Ihnen. Selbstverständlich ist das kein Zufall. Die Sieben steht in der unbestechlichen Überlieferung der neun Schlüssel für „Sieg“. Sie erinnern sich: Altruist ergab die Zwei und damit den Verweis auf die absolute Weisheit. Es ist selbst für einen nicht Eingeweihten nur ein kleiner Schritt zu dechiffrieren, dass angewandte absolute Weisheit zu nichts anderem führen kann als zum Sieg. Und auf diesem Weg war ich. Die Schicksalsgötter hatten diese Bestimmung für mich ausersehen. Sie handelten ganz ohne mein Zutun.
Das Wenige, das ich beitragen konnte, lag zu zwei Dritteln hinter mir. Ich hatte mehr als genug Zeit damit verbracht, den untreuen Ehemann von Susi zu beschatten und Beweise zu sammeln. Er war Metzger und tat die meiste Zeit des Tages das, was Metzger tun. Der Schlachthof ist ein Ort, dem nur Spezialisten etwas abgewinnen können. Alles dreht sich um Fleisch und seine Verarbeitung. Das Töten hilfloser Kreaturen hat mich schon immer abgestoßen und so war es kein Wunder, dass ich dem rohen Gewerbe auf Fernglassicht entfloh, bis ich mir einreden konnte, die niedrigen Gebäude mit dem verwahrlost wirkenden Innenhof dienten einem ganz gewöhnlichen Industrieunternehmen.
Die meiste Zeit verrichtete der Metzger seine Arbeit wie ein Uhrwerk. Er trug die Gummistiefel und die Plastikschürze, als seien sie mit ihm verwachsen. In den Zigarettenpausen trat er auf die Lieferrampe und machte sich noch nicht einmal die Mühe, den weißen Kopfschutz und den Kettenhandschuh auszuziehen, der ihn vor Schnitten schützen sollte. Er wirkte griesgrämig und verschlossen. Wahrscheinlich wurde man so, wenn man sein Leben zwischen frisch geschlachteten Tierkadavern verbrachte, die blutend und leblos an Haken hingen. Es reichte, dass ich mir den Fettgeruch vorstellte, um zu würgen. Über meine Vorstellungskraft hinaus ging es, wie ein solches Wesen für jemand anderen eine derartige Faszination ausüben konnte, dass man es begehrenswert und unwiderstehlich fand. Und dennoch schien die Beweislage eindeutig. Susi hatte tränenreich von eindeutigen E-Mails gesprochen, die mehrfach die Fingerfertigkeit des Metzgers beim Sex rühmten.
Die Treffen fanden in einem abgetakelten Schuppen in der Nähe des Bahnhofs statt. Es ist nicht wirklich einfallsreich, sich zu einem Stelldichein im Rotlichtbezirk zu verabreden, aber was sollte ich machen. Das „Palais d’Amour“ sah nicht danach aus, als ob sich die anonymen Sexsüchtigen zu Therapiestunden trafen. Mit knallroten Herzchen und Laternen geschmückt prostituierte sich das ehemals brave Mehrfamilienhaus zunächst als Bordell mit Anspruch, danach als Puff für abgetakelte Fregatten und ihre Low Budget Kundschaft und schließlich als Stundenhotel, das versiffte Zimmer und von schwitzenden Leibern durchgewalkte Matratzen als „Ruheräume von höchstem Komfort“ anpries.
Der Besitzer war Portier, Koch und Zimmerpersonal in einer Person. Er gehörte zu der gelassenen Sorte Männer unbestimmten Alters, die die Hosen bis unter die Brust zogen und schon alles gesehen hatten. Wie das Haus, das er verwaltete, leistete er sich keine Eitelkeiten. Ihn kümmerte es nicht, dass immer ein ansehnlicher Trupp Schuppen aus seinen strähnigen Haaren auf die Kragen seiner Billighemden rieselte und er verband keinen Imageverlust damit, dass er weiße Socken zu altmodisch geflochtenen Sandalen trug. Er war über dieses Stadium hinaus. Er war ein müde und phlegmatisch wirkender Mensch mit Raubvogelgesicht und hellen Augen, die trotz deutlicher Anzeichen der Resignation noch scharf zu blicken vermochten. Männern wie ihm stand als Alternativberuf der des Philosophen zur Verfügung. Und wer weiß, vielleicht war er einer.
Ganz und gar andersgeartet waren die Besucher des Etablissements. Während meiner Beobachtungen hätte ich soziologische Studien anstellen können. Gemessen an der Artenvielfalt der Typen wären manche auch als zoologische Studienobjekte geeignet gewesen. Der Männeranteil überwog den der Frauen eindeutig. Szenen von Gruppensexorgien und sonstigen Ausschweifungen, bei denen die Männerpositionen doppelt besetzt sein müssen, um den dreifachen Spaß zu garantieren, gingen mir durch den Kopf. Im Grunde war ich froh, dass die Fantasien eher rational gesteuert zu sein schienen, denn sie lösten kein unerfülltes Verlangen aus, sondern einen dumpfen Kopfschmerz.
Mein Metzger kam dienstags. Damit meine ich jeden Dienstag. Dienstag war sein Fremdficktag. Andere kegeln, er hatte sich für die befriedigendere Lösung entschieden. Ich kann verstehen, dass sich Susi über die generalstabsmäßig ausgeführten Seitensprünge empörte. Keine der Frauen, die das „Palais d’Amour“ an Dienstagen frequentierten, konnten Susi das Wasser reichen. Soweit ich es erkennen konnte, handelte es sich durch die Bank um abgetakelte Flittchen, die auf hohen Hacken herumstaksten oder um ausgezehrte Drogenfreaks, denen die Todessehnsucht in die Haut gebeizt war. Mein Metzger ließ sich durch solche Kleinigkeiten nicht beeindrucken und schlurfte mit seiner prall gefüllten Leinentasche in die Kaschemme, um spät nachts in gleicher Manier und unverändert erscheinendem Gemütszustand wieder aufzutauchen. Er nahm immer das Zimmer 23 im zweiten Stock, direkt neben der Fluchttreppe. Ich hatte diskrete Erkundigungen eingezogen. Wenn Sie jemals in die Verlegenheit kommen, ein Stundenhotel zu buchen, denken Sie bitte daran, dass es um den Datenschutz fürchterlich bestellt ist.
Um den Bogen zurückzuschlagen, waren meine Observationen der Grund für den Inhalt meines Aktenkoffers. Präzise ausgedrückt handelte es sich noch nicht einmal um einen Aktenkoffer, obwohl er stark danach aussah. Eigentlich war das gute Stück ein Besteckkoffer für ein ekelerregend protziges Goldbesteck mit Prägung, das meine Mutter in einem Anfall völliger Geschmacksverirrung von einem fliegenden Händler erstand. Bis heute weiß ich nicht, was diese Kollektion ausgesuchter Hässlichkeit gekostet hatte. Was ich ganz sicher weiß, ist, dass die Löffel derart ausladend geformt waren, dass man sie nicht ansatzweise im Mund unterbringen konnte und sich der Verdacht aufdrängte, es handele sich um verkappte Geburtszangen.
So sehr ich das Besteck verachtete, so sehr hatte es mir der Koffer angetan. Er war ein kleines Schmuckstück mit einem Antlitz aus Krokoimitat und schwungvoll geformten Messingbeschlägen, die dem Erscheinungsbild den letzten Pfiff gaben. Wenn er sein Maul aufriss, tat er es mit einem samtrot ausgeschlagenen Schlund, der mit Besteckfächern bestückt war, die den vorgesehenen Inhalt passgenau aufnahmen. Die Fächer konnte ich für meine Zwecke nicht brauchen, denn ich benötigte einen angemessenen Aufbewahrungsort für meine Messersammlung und weitere Kleinigkeiten.
Wenn, wie in meinem Fall, ein feines Messer Schicksal spielt und man von einem Hodenquetscher in eine längere Rekonvaleszenzphase geschickt wird, wo Zeit und Schmerz im Überfluss zu haben sind, entwickelt man auch zu leblosen Gegenständen eine starke Bindung. Die Damaszener Klinge war mir förmlich aufgedrängt worden und erschien mir anfangs wie ein Schreckgespenst, mit dem ich möglichst nie mehr in Berührung kommen wollte. Sie war Albtraummaterial und selbst in Sachen Bert hatte ich komplizierte Umwege gewählt, anstatt über eine simple Messerlösung nachzudenken.
Sie wissen es selbst – der Mensch ändert sich. Zeit überwindet alles, auch Abneigungen. Genau wie Sie hatte ich in der populärwissenschaftlichen Literatur über Ängste und Verdrängungsmechanismen gelesen. Die Thesen der Konfrontationstheorie erschienen mir einleuchtend und gaben den Ausschlag, mich mit Messern zu beschäftigen. Sie glauben gar nicht, wie befreiend es ist, wenn man sein persönliches Tabuobjekt zum ersten Mal in den Händen hält und mit dem Daumen die Schärfe der Klinge prüft.
Ich war so vorgegangen, wie Sie es von mir erwarten – generalstabsmäßig. Im Internet hatte ich Schneidwaren aus aller Welt identifiziert, ihre Machart und Verwendungsweise studiert und mich ihren blanken, seelenlosen Blicken und ihren Raubtiergebissen ausgeliefert. Sie erschienen niemals harmlos oder sogar dekorativ, wie Pistolen mit ihren plumpen, verkleideten Körpern, die sich gerne einen spielzeugartigen Anstrich geben, bis die Kugel das Leben ausgelöscht, das bis zuletzt die Hoffnung hatte zu entkommen. Ich stimme in keinem Fall mit der häufig zu lesenden Charakterisierung überein, dass Handfeuerwaffen Furcht und Schrecken verbreiten, wo immer sie sich zeigen. Ganz im Gegenteil. In Katalogen und auf Messen ziehen sie bewundernde Blicke auf sich. Es sind stille und schwerfällige, manchmal auch dekorative Gesellen, die Macht verkörpern und zum willfährigen Werkzeug ihres Besitzers werden.
Anders scheint es mir mit Messern zu sein. Niemals kommt man hinter ihr glattgesichtiges Geheimnis. Es gibt sie in allen Formen und Schliffen und immer spiegeln sie nur das wider, was von ihrer blanken Oberfläche reflektiert wird. Sie geben nichts von sich preis, verharren ohne jede Gefühlsregung, obwohl sie bereits blankgezogen haben und ihre hakennasige, spitze oder geschwungene Schärfe, die jeden Lebensfaden mit geringer Anstrengung zu durchtrennen weiß, entblößt ihre Killerseele. Sie sind furchterregend und ohne Mitleid.
Ich kann mir schon denken, dass Sie diesen philosophischen Exkurs für maßlos übertrieben halten. Mein neuer Deutschlehrer bezeichnet meine weitschweifigen Ausflüge gerne als interessante Miniaturen, die sich jedoch mehr an der Sache orientieren müssten. Ich fragte ihn, ob er Hölderlin den gleichen Rat erteilt hätte. Darauf wurde er unverschämt und bezichtigte mich der Anmaßung. Der Unterschied zwischen mir und Hölderlin sei so gewaltig, dass ich den Namen des Dichterfürsten noch nicht einmal im Munde führen dürfe. Ich hatte jede Menge geistreicher Erwiderungen auf der Zunge und den Messerkoffer unter meinem Schreibtisch. Beide Waffengattungen setzte ich nicht ein und begnügte mich mit der Erkenntnis, dass getroffene Hunde bellen.
Tatsache ist doch, dass ich mich in der Gegenwart von Messern beklommen und merkwürdig schutzlos fühlte und das wollte ich wiedergeben. Sie sollten dankbar sein, dass wir hier einen derartig offenen und vertrauensvollen Dialog führen, der nicht durch unnötigen Spott und Spiegelfechtereien vergiftet werden soll. Aber wenn Sie unbedingt darauf bestehen, dass ich es erwähne. Bitte sehr. Natürlich hatte ich keine Scheu vor Brot- und Gemüsemessern in ihrem Alltagsgebrauch. Ich war vielleicht traumatisiert, aber nicht therapiebedürftig. Um es ganz korrekt auszudrücken – das Sushi-Wasabi Kochmesser mit einseitig geschliffener Klinge, das Solinger Schälmesser mit gebogener Klinge und glatter Wate, die Gemüse-, Brot- und Filiermesser in all ihren Ausführungen machten mir keine Bange. Bei ihnen lag der Gebrauch näher als der Missbrauch. Es waren die martialisch aufgemachten Rambogesellen, die mir Gänsehaut verursachten. Aber genug davon. Überwunden ist überwunden. Und das hatte ich so gründlich getan, wie es nur Phobiker vermögen.
Ich hatte die tödlichen Stähle in meinen Händen gewogen, ihrer verschlagenen Glätte Auge in Auge standgehalten und ihre Formen mit vorsichtigen Fingern liebkost, wie ein Mensch, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Schlange in der Hand hält und unversehrt bleibt, weil er sich artgerecht verhält. Es war ein großer Sieg für mich und ein blendendes Geschäft für die Versandhäuser. Man kann sagen, dass ich mit der Zeit ein Kenner wurde, der mit Bedacht seine Auswahl traf und diese in dem Besteckkoffer parkte.
Als ich mit meiner Ausrüstung den Bus verlassen hatte, war die junge Frau mit dem kleinen Jungen verschwunden. Ich hatte nichts anderes erwartet. Genau genommen war es die falsche Zeit für Zivilcourage und zart aufkeimende Gefühle. Es war auch die falsche Zeit für Zeugen. Es war Dienstag und Zeit zu handeln. Ich zog den Schal, den ich um mein halbes Gesicht geschlungen hatte, enger. Die Baseballkappe wollte nicht so recht zu der teuren Lederjacke passen, die mein letztes Geschenk an mich war. Ich platzierte mich neben dem ausladenden Zeitschriftenständer eines Kiosks, dessen verwitterte Holzfassade mit mehreren Lagen Graffiti bedeckt war. Zigarettenstummel und Urinstrahlen hatten die unansehnlichen Schneehaufen mit ihren unverkennbaren Markenzeichen versehen. Ein zäher Nebel, den man fast mit Händen greifen konnte, senkte sich, drohte den Tag auszulöschen und dämpfte die Geräuschkulisse zu einem einförmigen Rauschen. Den ganzen Tag war der Himmel zinngrau gewesen und schien neuen Schnee zu versprechen, der nicht fallen wollte.
Ich holte mir eine neue Fanta. Observationen machen durstig. Fragen Sie mich nicht, warum. In Filmen haben die Detektive entweder Harndrang oder maulen darüber, dass nichts Essbares in der Nähe ist. Allenfalls trinken sie Kaffee aus einem Styroporbecher, obwohl keine Notwendigkeit besteht, sich warm zu halten. Scheinbar sind diese Widersprüche noch niemandem aufgefallen. Ich jedenfalls fror gepflegt vor mich hin und trank eiskalte Fanta, weil sie nur so schmeckt und den Durst löscht. Die roten Lichter des „Palais d’Amour“ strengten sich angesichts des wattigen Nebels an, wenigstens einen Teil ihrer marktschreierischen Werbewirksamkeit in die Umgebung zu tragen. Es war abzusehen, dass sie den Kampf verlieren würden. Ich hob meinen Koffer prüfend an und ließ die Verschlüsse aufschnappen. Alles war an seinem Platz. Ich urinierte hinter die Bude. Außer einem aufsässig schnüffelnden Pudel nahm niemand Notiz von mir. Es war zu kalt und zu neblig, um sich um die schemenhaften Figuren auf der Straße Gedanken zu machen. Die Witterung war perfekt. Perfekt für meine Zwecke.
Mein Metzger hieß übrigens Benedikt, was beweist, dass seine Eltern eine Kirchenkarriere statt einer Metzgerlehre für ihn im Sinn hatten. Benedikt machte auch heute keine Ausnahme von seinem gewohnten Tun. Seitensprung nach dem Kalender also. Wie praktisch, wenn man sein Leben so prächtig im Griff hat. Es mochte das Risiko einer vorzeitigen Entdeckung leicht erhöhen, aber der Nebel, der zäh wie Graupensuppe geworden war, zwang mich ganz nahe zu rücken. Die Menschen tappten wie Zombies umher und es hätte nicht viel gefehlt, dass sie mit den Händen ruderten, um die weißen Schwaden zu zerteilen. Autoabgase krochen über die Gehsteige und suchten vergeblich nach Abzugsmöglichkeiten. Der Wetterbericht hatte von vereinzelten Hochnebelfeldern gesprochen und wieder einmal schamlos danebengelegen.
Trotz aller Aufmerksamkeit hätte ich Benedikt fast verpasst. Sie würden staunen, wie viele vermummte Männer mit bauchigen Taschen bei nebligem Winterwetter unterwegs sind. Sie schlurfen mit gesenkten Köpfen, die sie gegen den Wind stemmen und sehen aus wie gestopfte Fleischwürste mit Hüten, Mützen und Kappen in einigen Rollen dunkler Textilien und festem Schuhwerk. Wenn man wie ich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs steht, macht das die Sache nicht leichter. Jeder hätte Benedikt sein können, aber zum Glück besuchte nicht jeder das „Palais d’Amour“.
Der Mann machte wirklich keine Umschweife. Er war ein Anhänger der direkten Aktion. Bis auf seine Seitensprünge war er ein Mann meines Geschmacks. Er musste so dicht an mir vorübergegangen sein, dass ich ihn mit Händen hätte greifen können und ging schweren Schrittes die Treppe zum Eingang des Etablissements hinauf wie jemand, der zuhause ist. Ohne zu zögern schlug er den Samtvorhang hinter der ramponierten Holztür zur Seite und wurde verschluckt. Ich hatte mich an eine Litfaßsäule an der Ecke des Hauses angelehnt, als warte ich sehnsüchtig auf die Pendlerin meines Herzens. Ab und an schaute ich auf die Uhr und schlang die Arme um mich, um wenigstens die Illusion menschlicher Wärme zu erzeugen. Ansonsten versuchte ich gelassen und ausdruckslos auszusehen.
Wahrscheinlich denken Sie, dass die Staffage wieder einmal überflüssig war. Sie hätten es wohl anders angefangen und wären im Schutze des Nebels sorgloser aufgetreten. Wer würde wohl auf einen Passanten aufmerksam werden, der sich ein wenig die Beine vertritt? Wer wird schon Argwohn erregen, wenn er nicht alberne Verhaltensweisen zur Tarnung an den Tag legt? Sie müssen noch viel lernen. Das sage ich ganz bewusst, obwohl ich noch jung bin. Es sind die winzigen Fehler, die sich summieren. Weisheit und Entschlossenheit sind vonnöten. Beherzigen Sie meine Worte.
Es war die Aufschrift auf der Stofftasche, die gut gefüllt von seinem Handgelenk baumelte, die meinen Metzger verriet. „Das Fleisch macht’s“ warb die Tasche mit weißen Lettern auf blauem Grund. Für einen Metzger mochte dies ein alltäglicher Satz sein. Für alle anderen war die Werbeaussage gewöhnungsbedürftig. Werbung ist darauf angelegt, Aufmerksamkeit zu erregen, eine Botschaft mit Erinnerungswert zu platzieren und Assoziationen hervorzurufen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Vorstellungsvermögen gaukelte mir bei dieser Zeile ein mehr als faustgroßes Stück rohen Fleisches vor, das seine Säfte auf eine Lage Küchenkrepp tropfte. Ich fand diesen Slogan der Fleischwirtschaft unausgegoren und kontraproduktiv. An jenem Abend allerdings war ich dankbar für den Wink mit dem Zaunpfahl. Anscheinend hatte ich mich trotz bester Vorsätze einlullen lassen. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich ein wenig über mich selbst ärgerte, während ich mit gerecktem Hals und gesteigerter Aufmerksamkeit verfolgte, ob das Licht im Zimmer 23 angehen würde. So sehr ich auch die Fenster zählte und mich selbst überprüfte. Es konnte kein Zweifel bestehen. Zimmer 23 war bereits erleuchtet. Der Mann konnte beim besten Willen nicht nach oben geflogen sein. Das bedeutete, dass sein Herzenspartner bereits anwesend war. Kaum zu glauben, aber diesen Umstand hatte ich einfach nicht bedacht, weil er bisher noch nicht vorgekommen war.
Ich begab mich ins Schlepptau einer grell geschminkten Dame von den Ausmaßen eines Kleinlasters, deren Turmfrisur das zulässige Höhenmaß des Eingangs zum Palast der Lüste eindeutig überschritt. Sie keuchte die Stufen hoch und präsentierte unter ihrem ausladenden Hintern eine Kraterlandschaft an Orangenhaut. Die roten Netzstrumpfhosen wehrten sich tapfer dagegen, in die Vertiefungen gezogen zu werden. Natürlich hatte sie mich bemerkt. Das war nicht weiter schlimm. Viele Männer betraten die Räume als anonyme Anhängsel der Damen, die mit dem Betreiber das Geschäftliche erledigten, während der Kunde mit abgewandtem Gesicht nach oben schlich. Nicht anders würde es bei mir sein. Der chinesische Schnellimbiss hatte vor kaum zehn Minuten eine heiße Mahlzeit geliefert, die der Inhaber des Hauses in einem Nebenzimmer verzehren würde. Gott sei gelobt für Menschen, die starre Gewohnheiten entwickelten und sich daran hielten.
Die fleischgewordene Versuchung vor mir versuchte sich in Konversation. Der Eingangsbereich war die perfekte Kulisse für einen Film noir samt den dazu gehörenden abgestandenen Gerüchen, auf die ich gerne verzichtet hätte. „Na Süßer, hatten wir eine Verabredung?“, nuschelte die Nutte. Wenn sie kein Kaugummi kaute, hatte sie ein gewaltiges Sprachproblem. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Sie machte keine Anstalten, sich nach mir umzudrehen. Als erfahrene Liebesdienerin wusste sie, dass Freier scheu wie Rehe sind, bevor sich die Tür zum Zimmer schließt. Alles war eine Frage der Diskretion.
„Hey Süßer, ich nehme mir den Schlüssel zu der 16“, rief sie wesentlich bestimmter in Richtung Nebenzimmer. Der andere Süße antwortete mit einem zustimmenden Brummen und Schlürfgeräuschen. „Du kannst uns gerne besuchen kommen. Uns fällt auch zu dritt etwas Nettes ein, Süßer“, gurrte sie asthmatisch. Ich nahm an, dass ich gemeint war und antwortete mit einem indifferenten Laut. Als sachkundiger Laie in Sachen Prostitution muss ich zugeben, dass meine Mutter um Klassen besser ist. Damit meine ich nicht nur das angenehmere Äußere, sondern vor allem das Anreizvokabular, das abwechslungsreich und lockend in individuell gestalteten Variationen vorgetragen wird. Durch den direkten Vergleich mit dieser lieblos abgenudelten Kirmesnummer stieg sie in meiner Achtung.
Die enge Holzstiege protestierte mit einem Zitteranfall des Geländers, als sich die Nutzerin von 16 nach oben wuchtete. Sechzehn ergab auch die Quersumme sieben und es war gut vorstellbar, dass der weibliche Koloss bei allen denkbaren Spielarten der Liebe den Sieg davontrug. Natürlich war diese Überlegung keine seriöse Anwendung der Numerologie, sondern ein albernes Gedankenspiel. Immerhin half es, die aufsteigende Nervosität im Zaum zu halten. Eine Reihe akkurat ausgerichteter Geldspielautomaten dudelte in der Ecke des engen Raumes. Niemand ließ sich blicken. Das spärliche dunkelbraune Mobiliar wirkte im roten Licht abstoßend und ungesund.
Ich machte mich auf den Weg in den zweiten Stock. Dem Geruch nach zu urteilen, kochte jemand Kohlsuppe auf einem Zimmer. Vielleicht ging es nicht um ein deftiges Essen, sondern um eine mir bisher unbekannte Spezialbehandlung. Ich vermied den Blick in den Korridor des ersten Stockes. Eine Frau schrie. Sie war in Ordnung. Es war kein Hilfeschrei, sondern ein auswendig gelernter Text, den sie mehrfach täglich von sich gab, wenn sie genügend Kunden fand. Der Text lautete: „Weiter, weiter“. Ein Fernseher vom anderen Ende des Flurs antwortete mit einem volkstümlichen Trompetensolo, das plötzlich abbrach. Die Treppenstufen knirschten unter meinen Tritten. Ich schwitzte. Mit einem Knacken erlosch das Licht. Ein Fenster am Ende des Treppenabsatzes wies mir den Weg. Ich tastete mich voran und sah für einen Augenblick hinaus in den milchigen Nebel. Ein Stück Tapete rollte sich von der Wand.
Die 23 war das Eckzimmer direkt neben der grünen Leuchte mit der Aufschrift „Notausgang“.
Sorgfältig komplettierte ich meine Verkleidung und schaute mich noch einmal um. Dann zog ich das Stemmeisen aus der Innentasche der Lederjacke und setzte es an dem altertümlichen Schloss an. Die Hebelwirkung ließ die Tür nach innen schwingen. Das kurze Krachen alarmierte die Gestalt neben der Garderobe. Die Gestalt fuhr herum. Es war der Weihnachtsmann mit offenem Mantel. Von seinem erigierten Glied tropfte Schokosoße. Er starrte mich unter buschigen weißen Augenbrauen verständnislos an.
Dann schoss ich mit dem Taser.