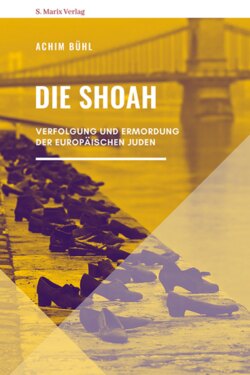Читать книгу Die Shoah - Achim Bühl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Die nationalsozialistische Planung der »Endlösung«
ОглавлениеDie nationalsozialistische Judenfeindlichkeit war ihrem Wesen nach ein eliminatorischer Antisemitismus. Die Eliminatorik umfasste die soziale Elimination der Juden, d. h. die systematische Ausgrenzung sowie Markierung der Juden als »nichtzugehörige Fremde«, die räumliche Elimination durch erzwungene Auswanderung, Abschiebung oder Deportation, die physische Elimination in Form von körperlicher Gewalt, Inhaftierung, Folterung und Mord sowie die genozidale Elimination als kollektive Vernichtung der Juden im Sinne eines Völkermords. Zwar war das genozidale Element von Anfang an im Wesen des nationalsozialistischen Antisemitismus als Option angelegt und spiegelte sich beispielsweise in der ideologischen Konstruktion eines weltumspannenden, endzeitlichen Kampfes zwischen dem »Arier« und dem »Semiten«, gleichwohl war der »Weg nach Auschwitz« nicht vorprogrammiert, sodass unterschiedliche Planungen und Konzepte bezüglich der Frage existierten, wie denn die sogenannte »Endlösung der Judenfrage« auszusehen habe und was darunter zu verstehen sei. Als verbindendes Element dieser Entwürfe erwies sich die Vorstellung von einem »Deutschland ohne Juden«, welche anfangs die räumliche Elimination zum Dreh- und Angelpunkt nationalsozialistischer Politik machte, indes bereits die Entscheidung zugunsten eines Genozids einschloss, falls sich ein »judenfreies Deutsches Reich« sowie ein »nationalsozialistisches Europa« nicht durch Auswanderung oder Deportation erreichen ließen.
Die vom Nazi-Regime unmittelbar nach 1933 eingeleiteten Schritte sollten die rechtliche Gleichstellung der Juden rückgängig machen, dem eigenen Wählerklientel in Form von Berufsverboten und »Judenboykott« unliebsame Konkurrenten vom Halse schaffen sowie erste Schritte einleiten, um den Druck in Richtung Auswanderung beziehungsweise Austreibung aufzubauen. Nach dem Anschluss Österreichs diente ursprünglich diesem Zweck die Reichszentrale für jüdische Auswanderung. Die »Polenaktion« im Herbst 1938 stellte einen ersten konzeptionellen Wendepunkt dar. »Es handelte sich um die erste von den Behörden organisierte Massendeportation von Juden«, schreibt Reich-Ranicki und sodann: »Verglichen mit späteren Transporten waren es noch menschliche, ja nahezu luxuriöse Bedingungen.« Zwar ist der Aussage zuzustimmen, dass eine Parallele zu späteren Vernichtungsdeportationen noch nicht vorlag – wenngleich die humanitäre Situation der Ausgewiesenen auch nicht verharmlost werden darf –, die neue Qualität der »Polenaktion« war indes dem Sachverhalt geschuldet, dass die nationalsozialistische Judenpolitik erstmals den Weg von der (erzwungenen) Auswanderung zur staatlich organisierten Vertreibung beschritt. Die sich mit der »Polenaktion« ankündigende Ablösung der forcierten Auswanderung durch Deportation warf dergestalt betrachtet ihre Schatten voraus. Die »Polenaktion« wies zugleich darauf hin, dass umfangreichere, effektive wie administrativ problemlose Abschiebungen beziehungsweise Vertreibungen die Verfügungsgewalt des Deutschen Reichs über das jeweils anvisierte Territorium der Abschiebung erforderlich machten.
Der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 ging mit einer qualitativen Verschärfung des Antisemitismus einher. Die Einsatzgruppen, die zum Zeitpunkt des Polenfeldzugs bereits existierten, ermordeten systematisch Tausende Polen, darunter auch viele Juden. Die Radikalisierung der Judenfeindschaft war in dieser Phase dem Sachverhalt geschuldet, dass durch das militärische Geschehen eines brutalen Eroberungskriegs nicht nur die Tötungshemmnis sank, sondern zugleich der »außenpolitische Kampf« zunehmend mit dem »Kampf gegen Rassenschädlinge« verschmolz. Der Konnex zwischen Patientenmord und Shoah bildete sich mit dem »Polenfeldzug« heraus und zeigte sich daran, dass unmittelbar nach dem Überfall Erschießungskommandos Insassen polnischer Heil- und Pflegeanstalten ermordeten und insbesondere jüdische Patienten keinerlei Überlebenschance besaßen. »Jüdischsein« wurde in der Vorstellungswelt der Mörder zur unheilbaren Krankheit, deren Ausbreitung nur durch die Ermordung der »Patienten« beizukommen sei, da sich der »Virus« ansonsten immer mehr ausbreite. Die Verschmelzung des militärischen Kriegs mit dem »Rassenkampf« zu einem bipolaren Vernichtungskrieg zeigte sich daran, dass Hitler im Oktober den geheimen Führererlass, der Karl Brandt (1904–1948), den Leiter seines persönlichen Ärztestabes, sowie Philipp Bouhler (1899–1945), den Chef seiner Privatkanzlei, dazu ermächtigte, die Ermordung von Psychiatriepatienten sowie von pflegebedürftigen Kranken im deutschen Reichsgebiet durch ausgewählte Ärzte durchführen zu lassen, auf den 1. September 1939 rückdatierte. Die sogenannte »T4-Aktion«, benannt nach der Berliner Tiergartenstr. 4, kostete ca. 275 000 Menschen das Leben, die zumeist durch den Einsatz von Giftgas ermordet wurden. Die Verknüpfung von Patientenmord und Shoah verdeutlicht der Tatbestand, dass sowohl das Personal der »T4-Aktion« als auch die im Rahmen dieser Aktion entwickelte Tötungstechnologie bei der »Aktion Reinhardt« – der Ermordung der Juden im Generalgouvernement – übernommen wurden. Die Existenz eines »T4-Reinhardt-Netzwerks« belegt der Sachverhalt, dass die Kommandanten des Vernichtungslagers Belzec, Christian Wirth (1885–1944) und Gottlieb Hering (1887–1945), der Lagerkommandant von Sobibor, Franz Stangl (1908–1971), sowie der Lagerkommandant von Treblinka, Irmfried Eberl (1910–1948), allesamt maßgebliche Akteure der »T4-Aktion« waren. Die »T4-Aktion« bildete eine der entscheidenden Wegmarken in Richtung der genozidalen Elimination. Die unmittelbare Verbindung verdeutlicht auch der Sachverhalt, dass sich Himmler Anfang 1941 an Bouhler wegen Unterstützung bei der Ermordung von gebrechlichen und kranken KZ-Häftlingen wandte. Im Rahmen der »Aktion«, die den Codenamen »14f13« erhielt, wurden ca. 20 000 Menschen ermordet.
Nach der Eroberung Polens im September 1939 änderten sich die Rahmenbedingungen für die nationalsozialistische Planung der »Endlösung«, insofern aus Sicht des Nazi-Regimes nunmehr Teile des besetzten Polens zur Verfügung standen, um Juden aus den angegliederten Gebieten Polens sowie Juden aus dem »Altreich« aufnehmen zu können. Der am 28. September 1939 geschlossene Freundschafts- und Grenzvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion brachte auch das Gebiet zwischen Bug und Weichsel und damit den Distrikt Lublin unter deutsche Kontrolle. Die Sichtweise, dass Teile Ostpolens nunmehr als »Abschiebebahnhof« zur Verfügung stünden, machten sich regionale Nazigrößen zu eigen. Am 13. Februar 1940 wurden 1107 Juden aus Stettin und Umgebung von SA und SS in die ostpolnische Stadt Lublin des Generalgouvernements abgeschoben. Das Konzept einer umfassenden bevölkerungspolitischen Neugestaltung Polens (»Generalplan Ost«), das die Umsiedelung sogenannter Volksdeutscher aus den im Rahmen des »Hitler-Stalin-Pakts« von der Sowjetunion besetzten Gebieten und die Vertreibung als »rassisch minderwertig« eingestufter Bevölkerungsteile wie Juden, Sinti und Roma sowie »nicht germanisierungsfähiger Polen« in das Generalgouvernement vorsah, stieß aufgrund seines Umfangs – in den »angegliederten« beziehungsweise annektierten Gebieten Polens lebten alleine über 500 000 Juden –, wegen des Widerstands führender Nationalsozialisten des Generalgouvernements sowie der zur Verfügung stehenden Fläche rasch an seine Grenzen.
Symptomatisch für das Misslingen der nationalsozialistischen »Raumordnungspolitik« erwies sich das Scheitern des »Nisko-Plans«. Der Nisko-Plan beabsichtigte, den ostpolnischen Raum des Distrikts Lublin zu einem sogenannten »Judenreservat« unter deutscher Verwaltung umzugestalten, das Juden aus annektierten Gebieten wie dem »Warthegau«, dem »Protektorat Böhmen und Mähren« sowie aus dem »Altreich« aufnehmen sollte. Die anvisierte Größenordnung der Zahl der umzusiedelnden Menschen belegt die Radikalisierung der Judenpolitik in Richtung eines genozidalen Vernichtungsantisemitismus, insofern die Größe des geographischen Raums nicht dafür geeignet war, derartige Menschenmassen aufzunehmen, geschweige denn sie auch nur annähernd versorgen zu können. Der Nisko-Plan nahm konzeptionell das Sterben der Verschleppten billigend in Kauf, denen als auszubeutende »Arbeitssklaven« Tod durch Unterernährung, Seuchen oder unmenschliche Arbeitsbedingungen drohte.
Die Relevanz des Projekts einer »Neuordnung Europas« auf »rassenpolitischer Grundlage« aus Sicht des Nazi-Regimes kommt darin zum Ausdruck, dass am 7. Oktober 1939 Heinrich Himmler zum Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums ernannt wurde und für die Zielsetzung der »Germanisierung« des geplanten Siedlungsraums im Osten sowie für die damit verbundenen großangelegten demographischen Vertreibungen die Verantwortung erhielt. Im Rahmen der anvisierten »Umsiedelungen« wurde im Distrikt Lublin in der Nähe des Städtchens Nisko ein »Arbeitslager« errichtet, das als »Durchgangslager« für Deportierte dienen sollte und dessen Insassen »Behausungen« für die geplante Deportation auch von »Reichsjuden« bauen sollten. Im Oktober 1939 brachten Transporte aus Mährisch-Ostrau, aus Katowice sowie aus Wien ca. 4800 Juden nach Nisko, um mit dem Bau des »Judenreservats« zu beginnen. Spätestens im April 1940 wurde der Nisko-Plan, der sich als undurchführbar erwies, fallengelassen.
Die militärischen Siege der deutschen Wehrmacht führten zwar dazu, dass im Sinne des nationalsozialistischen »Kampfs um Lebensraum« immer mehr Fläche zur Verfügung stand, gleichzeitig indes auch immer mehr »unerwünschte Bevölkerungsgruppen« in den Machtbereich des NS-Regimes gerieten. In dem von der deutschen Wehrmacht eroberten Teil Polens waren dies alleine knapp zwei Millionen Juden, wovon eine halbe Million in westpolnischen Gebieten lebte, die »einverleibt« werden sollten. Da es sich bei relevanten Teilen der jüdischen Bevölkerung um ärmere Schichten handelte, wurden durch deren Abschiebung in das Generalgouvernement weder Bauernhöfe noch Häuser und Gewerbebetriebe frei, sodass Baltendeutsche, deren Gebiete bedingt durch den »Hitler-Stalin-Pakt« an die Sowjetunion fielen, nicht wie seitens der NS-Propaganda verkündet ansehnliche Gehöfte erhielten, sondern häufig in Umsiedlungslagern untergebracht waren. Die Deportation nichtjüdischer Polen in das Generalgouvernement, die über entsprechenden Besitz verfügten, der als »Beute« an »Volksdeutsche« verteilt werden konnte, wurde daraufhin als vorrangig deklariert. Letztendlich erwies sich eine derart groß angelegte Bevölkerungsverschiebung, die Baltendeutsche, weitere »Volksdeutsche«, Polen, jüdische sowie nichtjüdische Deutsche aus dem »Altreich« umfasste, als nicht realisierbar.
Die nationalsozialistische Planung der »Endlösung« konzentrierte sich bedingt durch den Misserfolg sodann auf den Plan, europäische Juden innerhalb des deutschen Herrschaftsgebiets nach Übersee auszuweisen, wofür die südostafrikanische Insel Madagaskar – eine französische Kolonie – gewählt wurde. Der »Madagaskar-Plan« war keine genuine Erfindung der Nazis, insofern bereits britische wie niederländische Antisemiten in der Zwischenkriegszeit das Konzept propagiert hatten und 1937 eine polnische Kommission die Insel vor Ort erkundete, um eine potentielle Emigration polnischer Juden auszuloten. Im Frühjahr 1940 wurde der »Madagaskar-Plan« von deutscher Seite erwogen als sich der Konflikt zwischen Nazigrößen, die eine »Umsiedelung« der Juden aus den annektierten westpolnischen Gebieten in das Generalgouvernement präferierten, und Generalgouverneur Hans Frank (1900–1946) zuspitzte, der keinerlei Interesse daran zeigte, sich zum Herrscher eines Gebiets »jüdischer Arbeitssklaven« degradieren zu lassen. Die Hoffnung auf den Sieg über Frankreich und Großbritannien sowie der Tatbestand, dass durch die Besetzung relevanter Teile Westeuropas weitere Hunderttausende Juden in den deutschen Machtbereich gelangten und sich die Umsiedelung derart großer Zahlen in ein östliches »Judenreservat« als unrealistisch erwies, führten dazu, dass im Juni 1940 der Referatsleiter für »Judenfragen« im Auswärtigen Amt, Franz Rademacher (1906–1973), mit der Umsetzung des »Madagaskar-Plans« beauftragt wurde. In diesbezüglichen Aufzeichnungen Rademachers heißt es:
»Da Madagaskar nur Mandat wird, erwerben die dort ansässigen Juden nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Allen nach Madagaskar deportierten Juden wird dagegen vom Zeitpunkt der Deportation ab von den einzelnen europäischen Ländern die Staatsangehörigkeit dieser Länder aberkannt. Sie werden dafür Angehörige des Mandats Madagaskar.« (Schmid 1983: 29)
Der Sachverhalt, dass der »Madagaskar-Plan« vorübergehend zu einem Stopp der Ghettoisierung der Juden im Generalgouvernement führte, ist als Beleg dafür zu werten, dass die »Übersee-Unternehmung« von Seiten des Nazi-Regimes durchaus ernsthaft verfolgt wurde. In der Ausarbeitung des Reichssicherheitshauptamts zum Madagaskar-Projekt vom August 1940 wird die Zahl der Juden, die nach Madagaskar verschleppt werden sollten, mit vier Millionen angegeben. Wie im Wannsee-Protokoll so wird auch hier die Zahl länderspezifisch aufgelistet. Neben Deutschland, dem Generalgouvernement, dem Protektorat Böhmen und Mähren werden die Benelux-Länder sowie Dänemark, Norwegen, die Slowakei und Frankreich aufgeführt. Gegen die Ernsthaftigkeit des »Madagaskar-Plans« spricht nicht, dass auch die südostafrikanische Insel weder auf Grund ihrer Fläche noch wegen ihrer Unwirtlichkeit dazu geeignet war, derart viele Juden aufzunehmen, und auf der Insel sporadisch gar die Pest ausbrach, insofern diese Tatbestände verdeutlichen, dass der »Madagaskar-Plan« eine weitere Wegmarke in Richtung des Übergangs von der räumlichen zur genozidalen Elimination der Juden darstellte. Im Papier heißt es: »Zur Vermeidung dauernder Beziehungen anderer Völker mit Juden ist eine Überseelösung insularen Charakters jeder anderen vorzuziehen.« Die deutsche Niederlage gegen Großbritannien und der dadurch versperrte Seeweg beendeten indes auch diesen in Erwägung gezogenen Plan der »Endlösung«.
Das Ende des »Madagaskar-Plans« führte zu neuerlichen Deportationen. Im Herbst 1940 wurden 70 000 Franzosen aus Elsaß-Lothringen, das dem Deutschen Reich angegliedert werden sollte, in das unbesetzte Frankreich deportiert, worunter sich auch viele französische Juden befanden. Am 22. und 23. Oktober 1940 wurden 6000 Juden aus Baden und der Saarpfalz gleichfalls nach Vichy-Frankreich deportiert, die im französischen Lager Gurs interniert wurden. Anfang des Jahres 1941 fanden weitere Deportationen in die polnischen Ostgebiete statt, unter den Betroffenen befanden sich 5000 Juden aus Wien sowie 4000 Juden aus den annektierten polnischen Gebieten. Die Planung des Überfalls auf die Sowjetunion stoppte vorerst die Deportationen aus logistischen wie militärischen Gründen.
Für die Forschung mag es unbefriedigend sein, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nie einen schriftlichen Befehl Hitlers zur Ermordung der europäischen Juden gab oder aber dieser vernichtet wurde beziehungsweise in Archiven unauffindbar blieb. Die Geschichtswissenschaft muss die Existenz einer gewissen »Blaupause« hinnehmen, welche die Frage offenlässt, wann und wie genau der Beschluss gefasst wurde, die Ermordung von Millionen europäischer Juden als »finales Konzept« diverser Planungen zu beschreiten. Bis heute wird über den genauen Zeitpunkt eines mündlich erfolgten »Führerbefehls« unter Historikern gestritten. Gemäß klassischer Studien der Shoah-Forschung soll ein mündlicher »Führerbefehl« bereits im Frühjahr oder aber im Frühsommer 1941 unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion erfolgt sein. Jüngere Studien verkoppeln die Beschlussfassung bezüglich der Ermordung der europäischen Juden nicht wie in älteren Studien mit der »Siegeseuphorie« (Juli 1941), sondern mit der Stagnation des Ostfeldzugs. Diesbezügliche Arbeiten gehen davon aus, dass ein »Sibirien-Plan« ähnlich wie der »Madagaskar-Plan« als territoriales Konzept ernsthaft verfolgt wurde (»Abschiebung in den Osten«), dieser jedoch scheiterte als deutlich wurde, dass der Vormarsch der deutschen Wehrmacht ins Stocken geriet und ein naher Sieg in weite Ferne rückte. Vertreter dieses Ansatzes benennen als Zeitpunkt einer Beschlussfassung über die Ermordung der europäischen Juden meist November 1941.
Als Ansatz existiert darüber hinaus die Position, dass der Entscheidungsprozess im engsten Kreis der Nazigrößen (Hitler, Göring, Himmler) ein zweiphasiger Vorgang war. Zunächst habe Einigkeit über die Ermordung der sowjetischen Juden bestanden. Der einsetzende Massenmord im Osten, der Siegesrausch in der Anfangsphase des »Unternehmens Barbarossa« wie die alsbald zur Verfügung stehende Technik in Gestalt des Zyklon B habe zu einer weiteren Radikalisierung des Mordplans geführt, der schließlich sämtliche europäische Juden innerhalb des deutschen Machtbereichs (»Endlösung«) umfasste. Eine zweistufige Entschlussfassung geht häufig mit der Ansicht einher, dass die Entscheidung für den Überfall auf die Sowjetunion das Votum für eine genozidale Elimination der sowjetischen Juden einschloss. Lege man eine entsprechende Planungsphase im Vorfeld des Überfalls auf die Sowjetunion zugrunde, so sei dieser »erste Genozid-Beschluss«, für den gleichfalls keine schriftlichen beziehungsweise eindeutigen Dokumente vorliegen, im Frühjahr 1941 erfolgt. Das Wirken der Einsatzgruppen im Osten als mobile Erschießungskommandos in den ersten Wochen des Kriegs, der von der deutschen Wehrmacht ausgegebene »Kommissarbefehl« vom 6. Juni 1941, der die Tötung von Politkommissaren der Roten Armee anordnete, sowie die zuvor getätigte Anweisung Hitlers an die Wehrmachtführung am 3. März 1941: »Die jüdisch-bolschewistische Intelligenz als bisheriger Unterdrücker muss beseitigt werden« verdeutlichten die Qualität des Eliminatorischen, die schon im Vorfeld des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion als »Führerwunsch« erkennbar gewesen sei. Mit den Anweisungen Hitlers für den geplanten Ostfeldzug habe die Eliminatorik die Grenze vom Vernichtungsgedanken zum genozidalen Massenmord überschritten. Zwar sei den Aussagen der Leiter der Einsatzgruppen in den Nachkriegsprozessen nicht zu trauen, gleichwohl sei es auffallend, dass die Mehrheit ausgesagt habe, ihnen sei bereits vor dem Überfall auf die Sowjetunion bei einer Einweisung in Berlin am 17. Juni oder bei einem Treffen kurz darauf der geheime Befehl zur Erschießung aller (sowjetischen) Juden mündlich erteilt worden. In einer schriftlichen Mitteilung Heydrichs vom 2. Juli 1941 sei zwar »lediglich« von der Exekution aller »Juden in Partei- und Staatsstellungen« die Rede, Heydrich habe jedoch die Mitteilung bereits im Juni 1941 vor den Einsatzgruppen- und Einsatzkommandoführern durch die Bemerkung, »dass das Ostjudentum das Reservoir des Bolschewismus sei, und deshalb nach Ansicht des Führers vernichtet werden müsse« interpretativ gerahmt. Der Hinweis darauf, dass in der Anfangsphase ein unterschiedliches Agieren der Einsatzgruppen festzustellen sei, stelle kein schlüssiges Gegenargument bezüglich des Vorliegens des »ersten Genozid-Beschlusses« im Frühjahr 1941 dar, insofern angesichts der Tragweite des Mordprogramms davon auszugehen sei, dass die einen eher, die anderen später begriffen, was von ihnen erwartet wurde. Während die einen anfänglich »nur« die jüdischen Männer im wehrfähigen Alter exekutierten, hätten die anderen bereits bei ihren ersten »Aktionen« Männer, Frauen und Kinder jeglichen Alters erschossen. Insofern sei zwar von der Sache her eine Radikalisierung bezüglich der Ermordung der sowjetischen Juden in den ersten Wochen des Vernichtungskriegs erfolgt, diese sei jedoch nicht auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung zurückzuführen, sondern vielmehr dem Kommunikations- und Verständnisprozess geschuldet, der sich angesichts der singulären Ungeheuerlichkeit des Vorgangs gleichwohl recht rasch mit der Intention des Befehlsgebers gedeckt habe. Der Massenmord an den sowjetischen Juden seitens der Einsatzgruppen bilde dergestalt betrachtet die erste Phase der systematischen Ermordung der europäischen Juden, welche die zweite Phase »getriggert« habe, insofern mit dem Angriff auf die Sowjetunion alle Dämme gebrochen seien. Zweistufige Modelle gehen im Unterschied zu klassischen Shoah-Studien davon aus, dass der »erste Genozid-Beschluss«, sich »lediglich« auf die sowjetischen Juden bezog, während erst der »zweite Genozid-Beschluss« die Ermordung sämtlicher europäischer Juden innerhalb des deutschen Machtbereichs vorsah. Je nach Autor ist dieser dann im Juli 1941 oder erst im September 1941 erfolgt. Für Juli 1941 wird häufig das Ermächtigungsschreiben Görings für Heydrich vom 31. Juli 1941 als Beleg angeführt:
»In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.1.39 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa. Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen. Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen.« (Klein 2000: 28)
Für Sommer 1941 wird ebenso der Sachverhalt benannt, dass Rudolf Höß (1900–1947), der erste Lagerkommandant von Auschwitz, angegeben habe, der Beschluss für die Ermordung der europäischen Juden sei im Juli 1941 gefasst worden. Bereits Anfang August habe Goebbels eine Unterredung mit Hitler wie folgt kommentiert:
»Wir reden auch über das Judenproblem. Der Führer ist der Überzeugung, dass seine damalige Prophezeiung im Reichstag, dass, wenn es dem Judentum gelänge, noch einmal einen Weltkrieg zu provozieren, er mit der Vernichtung der Juden enden würde, sich bestätigt. Sie bewahrheitet sich in diesen Wochen und Monaten mit einer fast unheimlich anmutenden Sicherheit.« (Goebbels, Bd. 4, 1992: 1658–1659)
Dokumente wiesen ferner darauf hin, dass bereits Ende Juli 1941 Victor Brack (1904–1948), der Organisator des Patientenmordes (»Euthanasie«) sowie der Mitverantwortliche für die Massenvergasung von Juden in den Vernichtungslagern, in die europaweite Mordabsicht eingeweiht gewesen sei. Kritische Auseinandersetzungen mit den Belegen, die bereits die klassische Shoah-Forschung aufführte, haben einige Historiker – unabhängig davon, ob sie ein Zweiphasenmodell vertreten oder nicht – zur Annahme bewogen, der Genozid-Beschluss bezüglich der europäischen Juden sei erst im September 1941 erfolgt. Hierfür wird u. a. der Sachverhalt benannt, dass Hitler noch im August 1941 trotz diverser lokaler Vorstöße die Deportation deutscher Juden blockierte und erst Mitte September erklärte, die deutschen Juden wie die Juden aus dem Protektorat seien unverzüglich abzuschieben. Angeführt wird ferner der Tatbestand, dass Massenerschießungen außerhalb der Sowjetunion wie in Serbien und Galizien erst im September einsetzten. Alle skizzierten Forschungsansätze stimmen indes dahingehend überein, dass die Monate zwischen März und November 1941 den entscheidenden Zeitraum bildeten und spätestens gegen Ende des Jahres 1941 im Kreis der engsten Führung Einigkeit über das europaweit dimensionierte Mordprogramm herrschte. Vor allem jüngere Studien zeichnen sich dadurch aus, dass sie den diesbezüglichen Zeitpunkt erst auf November/Dezember 1941 datieren.
Um einen Völkermord derartigen Ausmaßes wie die Shoah zu begehen, reichten Erschießungskommandos indes nicht aus, sodass bereits im September »Experimente« mit der Vergasung von Juden durchgeführt wurden. Anfang Oktober plante man im Todeslager Chełmno (Kulmhof) den Einsatz stationärer Einrichtungen, im November 1941 wurden bei der Ermordung von Juden im Warthegau mobile Gaswagen eingesetzt. Zwischen März und Juli 1942 wurden auf polnischem Territorium zahlreiche Vernichtungslager gebaut, wie u. a. Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek und Auschwitz. Der systematische, nunmehr nahezu fordistisch-industriell betriebene Völkermord an den europäischen Juden hatte zur Konsequenz, dass die Deportationen nicht mehr das alleinige Ziel räumlicher Elimination verfolgten, sondern vielmehr die genozidale Elimination in den Vordergrund der Verschleppung rückte und das eigentliche Wesen der Deportationen ausmachte. Der Terminus Deportation bedeutete fortan eine Verschleppung in deutsche Vernichtungslager des Ostens zwecks Ermordung der verschleppten Juden. Die Koordination für die Vernichtungsdeportationen übernahm das Referat IV B4 des Reichssicherheitshauptamtes unter Adolf Eichmann. Zwar verfügte Eichmann nur über einen kleinen Mitarbeiterstab, er konnte indes auf vielfältige andere Dienststellen zugreifen, auf Einsatzgruppen und auf Kräfte der deutschen Wehrmacht sowie auf kollaborierende Polizisten und Beamte verbündeter oder besetzter Länder. Neben logistischer Unterstützung seitens der deutschen Reichsbahn erhielt Eichmann ebenfalls Unterstützung durch das Auswärtige Amt, das mit eigenen Judenreferenten unmittelbar in das Deportationsprogramm involviert war.
Die systematische Deportation der deutschen Juden begann im Oktober 1941. Die erste größere, europaweite Deportationswelle der Shoah lässt sich auf Frühjahr und Sommer 1942 datieren, eine zweite folgte nach einer durch den Kriegsverlauf bedingten Pause Anfang 1943. Eine dritte Welle erfolgte im Jahr 1944, als für jedermann offensichtlich war, dass der Krieg verloren war. Insbesondere die dritte Phase verdeutlicht, dass die militärische Seite des Kriegs für den deutschen Nationalsozialismus lediglich eine der beiden elementaren Seiten darstellte, der »Rassenkampf« und die Vernichtung des europäischen Judentums die zweite. Zwar mochten der Weltkrieg, der »Kampf um Lebensraum« sowie der Plan einer umfassenden bevölkerungspolitischen wie räumlichen Neuordnung Europas unter der Vorherrschaft des deutschen Nationalsozialismus bereits verloren sein, den »Rassenkampf« gegen den »jüdischen Weltverschwörer« wollte man indes allemal gewinnen und diesbezüglich für die Nachkriegsordnung irreversible Fakten schaffen.