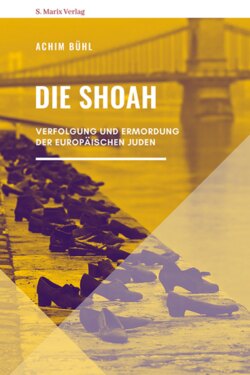Читать книгу Die Shoah - Achim Bühl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Die Ausgrenzung der Juden Deutschlands 1933–1938
ОглавлениеWenige Wochen nach der Machtübernahme verdeutlichte die Gesetzgebung des Regimes, dass der Antisemitismus das Zentrum der nationalsozialistischen Ideologie darstellte und zur Tat drängte. Bereits in den ersten Tagen kam es zwar zu Gewalttätigkeiten gegen Juden, noch stand jedoch zumeist deren Mitgliedschaft in einer politischen Partei im Vordergrund der Übergriffe. Nach dem deutschlandweit durchgeführten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 wurde am 7. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Das erste rassistische Gesetz des Nazi-Regimes führte den sogenannten »Arierparagraphen« ein, der sogleich ohne Zwang von Vereinen und Verbänden sowie in der Privatwirtschaft übernommen wurde. Beamte, die »nicht arischer Abstammung sind«, so heißt es im Gesetzestext, seien in den Ruhestand zu versetzen. Da die Begrifflichkeit des Ariers ohne definitorischen Rückgriff auf den Terminus des Juden nicht zu spezifizieren war, bestimmte die Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, dass als nichtarisch zu gelten habe, wer über einen oder mehrere jüdische Großelternteile verfüge. Ebenfalls am 7. April 1933 wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlassen, das es gestattete, Rechtsanwälten mit einem oder mehreren jüdischen Großelternteilen die Zulassung zu entziehen. Am 22. April 1933 folgte die Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen, die den »nichtarischen« Ärzten die kassenärztliche Zulassung entzog. Drei Tage darauf erfolgte am 25. April 1933 das Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen, das die Definition des »Nichtariers« aus dem »Berufsbeamtengesetz« übernahm und festlegte, dass der prozentuale Anteil der »Nichtarier« im Schul-sowie im Hochschulbereich den Anteil der »Nichtarier« an der reichsdeutschen Bevölkerung nicht übersteigen dürfe.
Eine Verschärfung der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung leiteten die »Nürnberger Rassengesetze« ein, darunter das am 15. September 1935 verabschiedete Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (»Blutschutzgesetz«). Das »Blutschutzgesetz« verbot die Eheschließung sowie den außerehelichen Sexualverkehr zwischen »Juden« und »Nichtjuden«. Die dadurch erfolgte Einführung des juristischen Tatbestands der »Rassenschande« führte im Zeitraum zwischen 1935 und 1943 zu über 2000 Verurteilungen. Das ebenfalls auf dem »Nürnberger Reichsparteitag der NSDAP« verabschiedete »Reichsbürgergesetz« machte die Juden zu Bürgern zweiter Klasse indem es zwischen Reichsbürgern (»Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes«) und Reichsangehörigen (»Angehörige rassefremden Volkstums«) mit geringeren Rechten unterschied. Da zu diesem Zeitpunkt keine juristische Definition vorlag, wer als Jude gelten sollte, und auch das Reichsbürgergesetz dies noch offen ließ, erfolgte am 14. November 1935 eine Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Als Jude galt im Deutschen Reich künftig, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großelternteilen abstammte (sogenannter »Volljude«). Als Jude zählte ebenso, wer von zwei jüdischen Großeltern abstammte und der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte oder mit einem jüdischen Ehepartner verheiratet war (sogenannter »Geltungsjude«). Als »jüdischer Mischling« galt fortan eine Person, die von zwei (»jüdischer Mischling ersten Grades«) oder von einem Großelternteil (»jüdischer Mischling zweiten Grades«) abstammte und über keinerlei Bindungen zum Judentum verfügte. Die Einstufungen entschieden im weiteren Verlauf über Leben und Tod und wurden in Deutschland, in den besetzten Gebieten sowie von den verbündeten Ländern in definitorischer wie in praktischer Hinsicht höchst unterschiedlich gehandhabt.
Das Bestreben des Nazi-Regimes, die Juden zu erfassen verdeutlichte mehrere Monate nach der Machtübernahme die Volkszählung vom 16. Juni 1933, die noch nicht die spätere »Juden-Definition« des deutschen Nationalsozialismus zugrunde legte, d. h. im Sprachgebrauch der Statistik »Glaubensjuden« auswies. Bei einer Anzahl von 499 682 Personen betrug der Anteil der »Glaubensjuden« an der Gesamtbevölkerung knapp 0,8 %, wobei sich die jüdische Bevölkerung vor allem in den Großstädten konzentrierte. Noch vor Berlin mit einem jüdischen Anteil von 3,8 % lag an erster Stelle Frankfurt mit 4,7 %. Aus der Sicht des deutschen Nationalsozialismus waren die Ergebnisse der Volkszählung höchst unbefriedigend, da die Nazis Entrechtung und Verfolgung der Juden nicht auf das Merkmal der »Andersgläubigkeit« bezogen, sondern auf das Konstrukt der »Andersrassigkeit«, welche biologische Minderwertigkeit postulierte. Das Ideologem vom Juden als »Gegenrasse« suggerierte eine »volkskörperzersetzende Gefahr«, behauptete den drohenden Untergang der »arischen Rasse« und beschwor einen endzeitlichen Kampf zwischen dem rassisch wertvollen »Arier« und dem »vorderasiatischen Rassengemisch« des Israeliten hinauf.
Im Unterschied zur Volkszählung vom Juni 1933, die konzeptionell noch von der Weimarer Republik geplant wurde, verfolgte Reinhard Heydrich (1904–1942) als Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes (»Gestapo«) das Ziel einer »restlosen Erfassung« der Juden auf Basis der nationalsozialistischen »Rassentheorie«. Bereits vor den »Nürnberger Gesetzen« wies Heydrich die örtlichen Stellen der Gestapo an, »Judenkarteien« anzulegen, welche die Mitgliederlisten jüdischer Gemeinden, Vereine und Verbände nutzen sollten. Die für 1938 geplante Volkszählung, die wegen des »Anschlusses Österreichs« auf den 17. Mai 1939 verschoben wurde, legte im Unterschied zur Erhebung von 1933 erstmals die »Nürnberger Gesetze« zugrunde. Die Volkszählung von 1939 fragte folglich: »War oder ist einer der vier Großelternteile der Rasse nach Volljude? (Ja oder nein)« und erfasste die Angaben in einer »Ergänzungskartei« für Großvater und Großmutter väterlicher- wie mütterlicherseits. Bei einer Gesamtbevölkerung von 69 316 846 Personen im sogenannten »Altreich« wurden 233 846 Personen als »Volljuden« eingestuft, 213 930 als »Glaubensjuden«, 8500 als »Geltungsjuden«, 52 005 als »Mischlinge 1. Grades« sowie 32 669 als »Mischlinge 2. Grades«. Der Anteil der auf Grundlage der Nürnberger Gesetze als Juden geltenden Personen betrug 0,35 %. Die Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 17.8.1938, die am 1. Januar 1939 in Kraft trat, stellte einen ersten Versuch dar, Juden öffentlich zu markieren. Juden wurden zur zusätzlichen Annahme des Vornamens »Israel« gezwungen, Jüdinnen mussten als zweiten Vornamen »Sarah« tragen. Die Namensänderung war sowohl beim Standesamt als auch bei der Ortspolizeibehörde des Wohnsitzes anzuzeigen. Am 5. Oktober 1938 erfolgte die Verordnung über Reisepässe von Juden, welche die Pässe von Juden für ungültig erklärte und deren Einziehung vorsah. Die Reisepässe sollten mit Geltung für das Ausland erst wieder gültig werden, »wenn sie von der Passbehörde mit einem vom Reichsminister des Innern bestimmten Merkmal versehen werden, das den Inhaber als Juden kennzeichnet«. Als entsprechende Kennzeichnung wurde ein in roter Farbe gestempeltes »J« vorgesehen (sogenannter »Judenstempel«).
Die Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden zwischen 1933 und 1938 verdeutlicht alleine die Vielzahl antisemitischer Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die bereits vor 1939 in Kraft traten, von denen einige exemplarisch aufgelistet seien: »Juden werden aus dem großdeutschen Schachbund ausgeschlossen (9.7.1933)«, »Juden werden aus Gesangsvereinen ausgeschlossen (16.8.1933)«, »Badeverbot für Juden am Strandbad Wannsee (22.9.1933)«, »Berufsverbot für jüdische Musiker (31.3.1935)«, »Die Taufe von Juden und der Übertritt zum Christentum hat keine Bedeutung für die Rassenfrage (4.10.1936)«, »Mit Jüdinnen verheiratete Postbeamte werden in den Ruhestand versetzt (8.6.1937)«, »Nur ehrbare Volksgenossen deutschen oder artverwandten Blutes können Kleingärtner werden (22.3.1938)«. Am 25. Juni 1938 wurde es Juden verboten als Ärzte zu praktizieren mit Ausnahme der Versorgung jüdischer Patienten, am 27. September untersagte eine Verfügung jüdischen Rechtsanwälten ihre Tätigkeit. Zur Beraubung der Juden trug das bereits am 18. Mai 1934 erlassene Gesetz über Änderung der Vorschriften über die Reichsfluchtsteuer bei, das sich in den kommenden Monaten zu einem Instrument entwickelte, um jüdische Emigranten teil zu enteignen. Um den Zugriff auf jüdische Vermögen weiter zu erhöhen, sah eine Verordnung vom 26. April 1938 eine Anmeldung des Besitzes vor.
Im Herbst 1938 wurden Tausende Juden polnischer Staatsangehörigkeit, die zumeist schon seit etlichen Jahren in Deutschland lebten, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgewiesen. Hintergrund der Aktion bildete die Ankündigung der Regierung Polens, im Ausland lebenden polnischen Bürgern, die bis zum 31. Oktober ihre Pässe nicht erneuerten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Am 28. und 29. Oktober 1938 wurden daraufhin 17 000 polnische Juden aus verschiedenen deutschen Städten von der Polizei abgeholt und nach Polen abgeschoben, unter ihnen auch die Familie Grynszpan. Ihr 17-jähriger Sohn Herschel Grynszpan (1921–1942/45), der in Paris lebte, fasste daraufhin den Plan, seine Eltern durch die Ermordung des Legationssekretärs der deutschen Botschaft, Ernst Eduard vom Rath (1909–1938), zu rächen. Als vom Rath an den Folgen des Attentats starb, nutzte das Nazi-Regime den Vorfall, um die staatlicherseits inszenierten Novemberpogrome auszulösen. Über die sogenannte »Polenaktion« berichtet Marcel Reich-Ranicki (1920–2013), der 1938 in Berlin seine Abiturprüfung mit Erfolg bestand:
»Am 28. Oktober 1938 wurde ich frühmorgens, noch vor 7 Uhr, von einem Schutzmann (…) energisch geweckt. Nachdem er meinen Pass genauestens geprüft hatte, händigte er mir ein Dokument aus. Ich würde, las ich, aus dem Deutschen Reich ausgewiesen. Ich solle mich, ordnete der Schutzmann an, gleich anziehen und mit ihm kommen. Aber vorerst wollte ich den Ausweisungsbescheid noch einmal lesen. Das wurde genehmigt. Dann erlaubte ich mir, etwas ängstlich einzuwenden, in dem Bescheid sei doch gesagt, ich hätte das Reich innerhalb von vierzehn Tagen zu verlassen – und überdies könne ich auch Einspruch einlegen. Für solche Spitzfindigkeiten war der auffallend gleichgültige Schutzmann nicht zu haben. Er wiederholte streng: ›Nein, sofort mitkommen!‹ Dass ich alles, was ich in dem kleinen Zimmer besaß, zurücklassen musste, versteht sich von selbst.« (Reich-Ranicki 1999: 157)
Polen schloss daraufhin seine Grenzen, sodass die Deportierten sich unter elenden Bedingungen im Niemandsland wiederfanden. Die »Polenaktion« war ein »Scheitelpunkt«, der zu einer neuen Phase der Judenverfolgung überleitete. Die Radikalisierung im Laufe des Jahres 1938 ist nicht zuletzt daran ersichtlich, dass es bereits vor den Novemberpogromen zur Schändung sowie zur Zerstörung von Synagogen kam, so beispielsweise am 9. Juni 1938 in München und am 10. August 1938 in Nürnberg. Die Münchner Hauptsynagoge wurde bereits kurze Zeit später abgerissen. Wenig bekannt ist die sogenannte »Juni-Aktion«, die bereits vor den Novemberpogromen am 15. Juni 1938 zur Verhaftung von 1500 Juden und ihrer Einlieferung in deutsche Konzentrationslager führte.