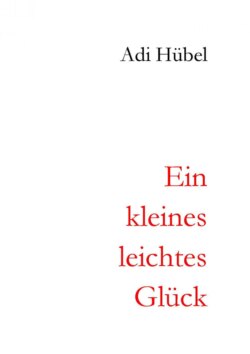Читать книгу Ein kleines, leichtes Glück - Adi Hübel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5. Menschenbilder
So exakt das Bild des Hauses sich zeichnet, so verschwommen erscheinen vorerst die Menschen, die Katharinas Kindheit umgaben, sie umsorgten, die liebten und straften. Nicht verwischt im Aussehen, doch in Handlungen und Zusammenhängen, im Muster des Alltags. Einzelne Bilder entstehen im Erinnern, einzelne Begebenheiten tauchen auf, ohne nachgefragt zu sein.
Der Großvater allen voran. Ein harter Mann, hoch gewachsen und schmal, erinnerbar meist mit der Pfeife im Mund, auf der Bank sitzend vor dem Haus, oder frühmorgens am Herd stehend, grantig, geizig, diese Eigenschaft durch nichts belegbar. Sein Spruch, mussten die Kinder nießen: Helf dir Gott. Und überhaupt die Sprüche in ihrer Vielfalt und Einförmigkeit. Immer wieder Mahnungen: Man sagt nicht Danke, man sagt Vergelt’s Gott. Oder: Man gibt nicht die linke Hand, gib die schöne Hand. Oder: Mach einen Knicks, wenn du grüßt. Der Großvater, Arbeiter in der nahen Kleinstadt, etwa sechs Kilometer entfernt, in einer Fabrik, die „Peitschenstecken", biegsame, aus Leder geflochtene Gerten zur Pferdehaltung herstellte. Damals, später dann, in der Zeit der beginnenden Reisewut, wurden es Campingartikel und Wohnwagen.
Die Großmutter, eine kleine zierliche Frau, wunderschön in der Erinnerung, die gute Fee, die den Schatz bewachte in der Vitrine, der alles gehörte, die Verfügungsgewalt hatte, die zuteilte, erlaubte, verbot, bestrafte. Sie war es auch, die Kathi nach einsamer zweistündiger Weltreise mit der Bahn freudig in die Arme nahm. Ihre Ferienkleidung trug sie im Schulranzen verpackt auf dem Rücken mit sich und hinten auf dem Gepäckträger sitzend, weich gepolstert mit einem Kissen, ging es auf dem Rad stadtauswärts, durch Birken bestandene Wiesen dem kleinen Haus der Großeltern zu. Liebevoll hielt Kathi die Großmutter umklammert, des Öfteren mit Nachdruck von ihr ermahnt, ja die Beine weit abzuspreizen. Entlang des düsteren schwarzen Waldstückes begann die Großmutter dann vorne auf ihrem Rad zu singen und vertrieb mit Mägdelein unter Holderbüschen und Königskindern,die nicht zusammen kommen konnten, alle Waldgeister und schrecklichen Räuber und sorgte somit dafür, dass sie unbeschadet das Dunkel hinter sich lassen, in den Hohlweg einbiegen und nach dem Aufstieg über den Hügel, mit frohem Lachen vor der Gartentür vom Rad springen konnten.
Während der Sommermonate, die Katharina einige Jahre in Kitzensberg in der Nähe von Isny liegend verbrachte, war das Haus meist übervoll mit Tanten und Basen und Vettern. Von den elf geborenen Kindern waren acht am Leben geblieben, fünf Töchter und drei Söhne. Die Tanten waren die wichtigen Instanzen. Sie hatten, außer der Lieblingstante Antonie, alle in die nähere Umgebung geheiratet und suchten nun, von ihren Männern durch Krieg und Gefangenschaft verlassen, Zuspruch und Hilfe im elterlichen Haus. Wie es der kleinen Gemeinschaft möglich war, sich über die Hungerjahre zu retten, blieb Kathi verborgen. Sicher ist nur, hier hatte sie genug zu essen, wenn auch nicht immer das, was ihr das Wasser im Munde fließen machte, und es gehörte zu ihren liebsten Sommergedanken, mit der Großmutter gegen Abend an die Beerenbüsche zu gehen, einen kleinen Eimer voll zu „brocken“, wie sie es nannte, und mit den anderen am blanken Holztisch vor dem Hause sitzend, die säuerlichen, roten Kügelchen in Milch schwimmend zu verzehren.
Nicht immer ging es friedlich zu in dem voll belegten Haus. Fühlte sich eine der Tanten benachteiligt, so machte sie sich Luft und da die starke Großmutter auch starke Töchter herangezogen hatte, zogen sich solche Auseinandersetzungen lautstark in die Länge. Gründe gab es mehr als genug in einer Zeit des Mangels. Da durfte nur eines der Kinder verbotenerweise sich eine noch nicht reife Spalierbirne abgepflückt haben, schon wurde dies als Beweis für die Unfähigkeit zur richtigen Erziehung gesehen, anstatt es der Gier der hungrigen Mägen zuzusprechen.
Katharina hatte schnell ihre Lieblingstante gefunden und diese sie. Später konnte Kathi sich diese Zuneigung gut erklären, hatte Tante Antonie doch nur zwei Jungen und keine Tochter. Toni, wie sie gerufen wurde, lebte mit ihrer Familie im Haus der Großeltern, in den unteren Räumen.
Der Großvater und Onkel Hans mussten, aus nicht bekannten Gründen, nicht in den Krieg ziehen, der den Kindern ansonsten als Väterverschlinger präsent war. Onkel Hans, freundlich, sanft und gerecht, gehörte Kathis Zuneigung. Hier gab es ein männliches Wesen, das immerfort greifbar war und blieb, und sich nicht wie der eigene Vater nach jährlich einmaligen, emotional turbulenten Aufenthalten, in Luft auflöste. Auch er arbeitete auswärts, in einem kleinen Schreinerbetrieb, hatte aber nach Feierabend in seiner eigenen Werkstatt für die Bauersleute der umliegenden Höfe manches zu tun.
Die Tanten, und die Kinder mit ihnen, halfen den Bauern und damals vor allen den Bäuerinnen der näher gelegenen Höfe beim Heuen, bei der Ernte, beim Viehhüten und beim Melken und Misten. Was Onkel Hans über seinen Beruf und sein verhaltenes Wesen, von den neuen Schiern ganz abgesehen, hinaus interessant machte, war seine Herkunft, die sich vor allem in seiner Sprache, in seinem herben und kargen Dialekt äußerte. Dabei war auch der Dialekt der Großeltern und Oberallgäuer, das Städtchen lag noch im Württembergischen, der Weiler schon im Bayerischen, nicht gerade vertraut und doch fand Kathi natürlicherweise vieles vom Klang und der Melodik, von starker, kurzer Wort- und Satzform der Mutter wieder. Der Onkel dagegen hätte auch aus dem fernsten Morgenlande kommen können, es war Kathi alles gleichviel oder gleich fern damals. Aus Murnau hatte ihn die Tante mitgebracht oder war er von alleine gekommen. Murnau, ein Ort, so unbekannt und fern und doch so freudvoll besetzt, wie später selten ein Ort, Murnau, ein Zauberwort.
Katharinas andere Onkel waren unbekannt und abwesend und erst in späteren Jahren wurde einer von ihnen, in ihrer Vorstellung schon lange als Heiliger oder zumindest großartiger Mann nistend, enttäuschende Realität. Seine Frau, diese angeheiratete Tante, klein, mollig, geschwätzig, aus Worms stammend, fand sich mit ihrer einzigen Tochter Marieluise bei den Großeltern ein. Sie vermochte es, durch endloses Erwähnen des Namens ihres verschollenen Mannes, diesen den anderen unauslöschlich einzuprägen. Wo gab es schon noch einen Menschen, der Eustach hieß. Eustach war unsichtbar allgegenwärtig. Sichtbar allgegenwärtig war Marieluise und es erfüllte Kathi mit Staunen und Erbitterung, wenn sie, die sie zu Hause hungerte, mit ansehen musste, wie Marieluise, unter den lächelnden Blicken der Tante, ein ach so rares weiches Ei auf dem Tellerrand verschmierte, wie sie unter Hinweis auf den fernen Papa die besten Stücke in den widerwillig geöffneten Rachen gestopft bekam und wie sie zum Abschluss der Mahlzeit ihre Hände im kostbarsten aller Leckereien, in dunklem, süßem Kakao badete. Von den Schwägerinnen gerügt, verwies Tante Eugenie auf den fernen Gatten und die Trauer um ihn. Diese und eine strenge Hand, dem einzig gebliebenen Pfand der Liebe gegenüber, lasse sich nicht vereinbaren.
Doch Eustach, der Onkel, blieb nicht, wo immer er gewesen war, er kehrte zurück und brachte Kathis Glauben an Autoritäten ins Wanken, denn Onkel Eustach schielte heftig und unablässig. Des Weiteren hatte er, wohl durch die Einwirkungen des Krieges, ein Bein verloren, besaß jedoch, als Kathi ihn kennenlernte, schon eine, allerdings nie sichtbare Prothese. Diese Tatsache blieb zwar interessant, doch zweitrangig. Ausschlag gebend für Kathis Verhältnis zu ihm war der nicht beherrschbare Blick. So unsicher sich seine Augäpfel in den Höhlen bewegten, so unsicher war sie von Anfang an in ihrem Verhalten einem solch unkontrolliert schielenden Erwachsenen gegenüber. Wäre er wenigstens ein Kind gewesen, hätte sie sich darüber lustig machen oder über eine spätere Besserung nachsinnen können. Für einen erwachsenen Mann gehörte sich so etwas einfach nicht und Kathi schämte sich für ihn. So gut es ging, hielt sie sich von ihm fern.
Der älteste der Geschwister ihrer Mutter, Gebhard, hatte auf einen Hof in der Nähe geheiratet und blieb Kathi fast unbekannt. Engelbert, der jüngste, schien sein Dasein der Hartnäckigkeit der Großeltern zu verdanken. Als nach vier Töchtern dicht aufeinander folgend, noch ein Sohn geboren wurde, dieser aber schwach und nicht lebensfähig bei der Geburt starb, wurde er, da zu den Engeln gegangen, nachträglich Engelbert getauft. Einen Engelbert verloren, wollten die Eltern eine zweiten, konnten jedoch auch diesen dem Himmel nicht abtrotzen. Doch da aller guten Dinge drei sind, ließen sie nicht nach in ihrem Mühen und schafften es schließlich, den dritten und letzten Sohn namens Engelbert zu zeugen, zu gebären, zu taufen und am Ende auch großzuziehen.