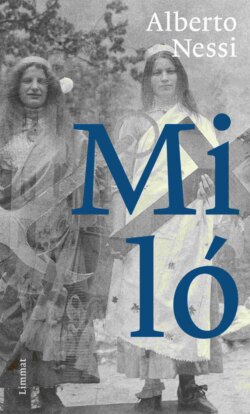Читать книгу Miló - Alberto Nessi - Страница 9
5
ОглавлениеNicht alle wissen, wo das Clavalité-Tal liegt. Das Wort lässt an einen Knüppel denken, mit dem man der faschistischen Republik den Kopf einschlagen kann, an ein Tal, das man durchqueren kann, an die berühmte égalité, von der in den Geschichtsbüchern die Rede ist. Es vermittelt ein Gefühl von Öffnung, von Aufatmen, sogar von Adel; man könnte meinen, Monsieur de Clavalité mit dem Falken auf der Schulter auf die Burg von Fénis reiten zu sehen. Lauscht man der Melodie des Wortes, kann man an den Wind denken, der weit durch die Pinien, Lärchen und Flaumeichen braust, an die hungrigen Füchse, die nachts durch die Niederungen streichen. Jetzt jedoch gibt es keinen Monsieur, keine Fantasien: Und die Füchse sind die Rebellen, die hier ihre Höhle gebaut haben, die jeden Tag Waffen, Esskastanien, Reis und Tabak herbeischaffen und dafür sorgen müssen, ihre Haut zu retten. In dieser Senke, die in Friedenszeiten einer sanft gewellten Lichtung voll guter Kräuter gleicht, wohnt nun die Angst.
An diesem Abend eilen Milós Gedanken unter dem Wintermond dahin: Wird Sterben wirklich sein, als erwachte man aus tiefem Schlaf? Steif vor Kälte kehrt er von einem seiner Erkundungsgänge im Tal zurück, und plötzlich fällt ihm dieser Kinderreim ein, das Jahr im Sprichwort: «Ein Baum hat zwölf Äste, jeder Ast hat vier Nester, jedes Nest hat sieben Junge, jeden Tag fliegt eines fort und das nächste kommt.» Den sagte ihm seine Großmutter in Fénis immer vor, wenn er als Kind in den Ferien aus Vevey zu ihr kam mit Mama Joséphine, die jetzt dort in der Schweiz bestimmt an ihren Sohn denkt, während er am Rand des Abgrunds geht.
Jeden Tag fliegt eines fort und das nächste kommt: Wie viele Tage mögen vergangen sein, seit sie sich in der Wohnung in Aosta versammelt haben? Es war am Abend des 8. September, Badoglio hatte den Waffenstillstand mit den Alliierten verkündet. Doch in den Zeitungen wurde die Meldung mit einem Trauerrand veröffentlicht. Was war da los? Der berühmte Badoglio, der Herzog von Addis Abeba, hatte gesagt: «Der Krieg geht weiter.»
Miló dachte: «Wenn der Krieg weitergeht, geht auch der Faschismus weiter.» Und er hatte beschlossen, jene Versammlung in der Wohnung in der Via Croix de Ville zu organisieren. Binel nahm teil, der ihm die Artikel von Gramsci gegeben hatte und am 25. Juli mit ihm zusammen verhaftet worden war; Chabloz kam, der mit Ivrea und Turin Verbindung hielt, und einige Cogne-Arbeiter waren da, die Brot und Frieden auf die Mauern der Stadt geschrieben hatten. Ida stand auf dem Balkon Schmiere, und im Erdgeschoss hörte man die Schritte einer hinkenden Frau, während an der Straßenkreuzung die faschistische Miliz vorbeimarschierte. Wie viele Tage ist das her?
Miló erinnert sich an die Septemberabende, als sie beschlossen hatten, ins Gebirge zu gehen. Was hatte ihn zu diesem Entschluss bewegt? Ein Wind, der aus seiner Schweizer Jugend herüberwehte, von den Gerüsten, auf denen er den Ungehorsam erlernt hatte, von den erlittenen Demütigungen, dem Faustschlag der flics mitten ins Gesicht, von seiner Mutter, der Zigarrenarbeiterin, die schnell am Genfersee entlangging, von den freien Möwen, die er am Himmel über dem See hatte fliegen sehen. Es war ein Wind, der ein neues Wort unter die Menschen brachte, eine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Nun warfen die Soldaten des königlichen Heeres die Koppeln fort und liefen davon, die Offiziere machten sich aus dem Staub, der Staat brach zusammen, und die Bourgeoisie machte sich in die Hose, der König, seine Generäle und Höflinge waren nur darauf bedacht, ihre Haut zu retten: Was sollte man tun? Was bedeutet «Waffenstillstand»? Miló und die anderen entschieden, für diese neue Hoffnung zu kämpfen.
Miló stapft durch den Schnee des Clavalité-Tals. Aosta ist weit, und der Winter ist auf über tausend Metern ein elendes Vieh. Die Aufständischen – die Banditen, sagen die anderen – sind etwa ein Dutzend, wie die Äste des Baums in dem Kinderreim, aber die Faschisten der Republik von Salò denken, dort oben seien mehr als hundert, und wagen nicht anzugreifen.
Um den Unterschlupf zu erreichen, hat er den Maultierpfad eingeschlagen, auf der einen Seite im Mondschein bleiche Felszacken, auf der anderen Schluchten und Abgründe. Gib gut acht, wohin du deine Füße setzt. Das Knirschen der Klettereisen begleitet die sich überschlagenden Gedanken. Miló denkt an seine Frau Ida: Sie ist als Stafette im ganzen Tal unterwegs, und eines Tages erschien sie bei einem solchen Schneesturm mit einem Paket oben in der Berghütte, dass sie selbst nicht wusste, wie sie das geschafft hatte. Sie näht Schulterriemen und Säckchen für die Handgranaten, sogar eine Nähmaschine haben sie ihr in die Hütte gebracht. Ida macht auch den Vierten beim Kartenspiel mit den Männern der Bande und hat Verbandsmaterial und Mullbinden im Schrank. Sie backt Pizza und kocht Spaghetti. Sie hat keine Angst. Sie nimmt den Zug bis Pont-Saint-Martin, dann läuft sie hinauf bis Gaby. In Ivrea geht sie auf den Markt, um Hosen und Hemden für die Bande zu kaufen. Doch nun ist sie wenigstens in Sicherheit mit Renata, ihrer kleinen Tochter, die ein Jahr nach der Hochzeit geboren wurde. Sie hat einen gefälschten Personalausweis: Ins Gebirge zu gehen war auch für sie eine Entscheidung auf Leben und Tod.
Es ist anstrengend, durch den Schnee zu stapfen, doch heute Abend erhellt der Vollmond den Schritt. Der Mond lässt Füchse und Gedanken tanzen. Und plötzlich erscheint auf dem Weg tsamba de bouque, der in den Vollmondnächten über die Felder strich, bewaffnet mit einer Sense. Das Hinkebein. Wenn er einen Menschen traf, verfolgte er ihn, um ihn mit seiner Waffe zu töten, so erzählte die Großmutter im Stall von Fénis; aber man braucht sich nur hinter einem Baum zu verstecken, dann geht tsamba de bouque davon. Au claire de la lune je l’ai vu, à l’ombrette je l’ai perdu …
Miló flüchtet sich in den Bauch einer Felsspalte, um geschützt eine Zigarette zu rauchen. Sorgsam achtet er darauf, das Flämmchen zu verbergen. Wie viele Tage sind seit dem 8. September verbrannt, wie viele Vögel aus dem Nest fortgeflogen, seit die Rebellen entschieden hatten, nein zu sagen? Die ersten wohnten in der Berghütte von tante Pélagie, dann sind sie auf neunhundert Meter hinaufgestiegen, und jetzt noch höher, auf zwölfhundert, wo sich ein weiter Himmel über das Matterhorn und den Monte Rosa spannt: gegenüber das Valtournenche, das Tal mit den Strommasten, die gesprengt werden sollen. Von dort oben überblickt der Wachposten die große Straße am Talboden.
Miló denkt an die Bande: an den Backofen, der im Bau ist, den Generator, den sie zu konstruieren versuchen, das Holz, das auf die Axt wartet, die Auseinandersetzungen um die Gemeinschaftskasse, das Kalb, das geschlachtet werden soll, das Roggenmehl, das sie für die peilà beschlagnahmen müssen, die Unterstützung seitens der Bevölkerung, die immer mehr abnimmt. Und dieser miese Kerl aus Fénis? Man hat ihn sagen hören: «Wenn der Krieg noch zehn Monate weitergeht, brauche ich nie mehr zu arbeiten.» Und auch diesem anderen Erzfaschisten vom Schwarzmarkt muss man einen Besuch abstatten …
Ein Schritt, noch ein Schritt. Zur Bande gehört auch Victor, der Engländer: Eines Tages hat er sich im Dorf mit Grappa volllaufen lassen, die Genossen mussten ihn zurückschleppen und haben ihn mit Wassertragen und Ausschluss von den Aktionen bestraft. Außerdem ist da noch der andere Engländer, sie nennen ihn «Lord», und Italo ist eifersüchtig auf ihn, weil er ihm beim Tanz die Frau ausspannt. Es gibt Reibereien zwischen ihnen, und einige drohen, sich abzuseilen und wieder zu Cogne zu gehen. Kürzlich ist Michele zu uns gestoßen, der monatelang in Montenegro war als Maschinengewehrschütze beim vierten Regiment der Alpini. Er hängt an der Flasche, und wenn er betrunken ist, legt er sich mit jedem an. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Am 25. Januar sind die Engländer bis vierzig Kilometer vor Rom vorgedrungen, hieß es in Radio London.
Mühsam setzt Miló im Schnee ein Bein vor das andere. Das Militärkommando fällt ihm ein, das seiner Bande kaum Beachtung schenkt, weil sie sagen: Das sind Kommunisten, die wollen keine Autonomie. Doch bedeutet es, wieder neue Zäune zu ziehen, wieder andere Mauern zu bauen, wenn man die Freiheit will? Das Aostatal ist nur ein kleines Fleckchen der weiten Welt, die man aus den Ketten befreien muss.
Sie haben einen Ofen in die drei Berghütten getragen, wo ihr neuer Sitz ist, haben Betten und Schränke gebaut, die Musketen gelagert, das Hotchkiss-Maschinengewehr und die Breda mit der Munition, die Handgranaten und die Pistolen. Nebendran steht ein alter Brunnen: La Suelvaz heißt der Ort. Es klingt wie der Name eines Indianerverstecks.
Im September sind als Erste Silvio, Toio, Pierino, Italo, Giovanni, Arturo und die beiden versprengten Engländer mit ihm hinaufgegangen. Eines Nachmittags erschien Chabloz in Begleitung eines ehemaligen Freiwilligen aus dem Spanienkrieg, der Gemsen jagen wollte; doch er hat sich geweigert, die Munition ist knapp. Jetzt sind neue Elemente dazugekommen. Unter anderem ein Gefreiter der Miliz, der Partisan werden will. Kann man ihm trauen? Ist er vielleicht ein Spitzel? Und außerdem haben die Besitzer von La Suelvaz gesagt, sie müssten weg, die Faschisten zeigen die Krallen, die Bevölkerung in Fénis hat Angst, die Deutschen kontrollieren. Werden sie noch weiter hinauf ziehen müssen, nach Morgnetta, ins Jagdhaus von Baron Peccoz? Während er zwischen weißen und schwarzen Schatten vorangeht, denkt Miló an alle diese Dinge: Er ist der Anführer der Bande. Den Mittelpunkt seiner Gedanken bilden die Sabotageakte, jetzt plant er einen großen Coup beim Kraftwerk von Covalou im Valtournenche. Dafür braucht es Disziplin, aber nicht diesen stumpfsinnigen Gehorsam der Marionetten der faschistischen Pseudorepublik: Die Rebellen müssen ihre Disziplin freiwillig, aus Überzeugung aufbringen. Am 21. Februar schreibt der Kommandant ins Tagebuch der Bande:
Schwere Disziplinlosigkeit hat sich Giordano zuschulden kommen lassen. Im Auftrag von Miló sollte er mehrere barres à mine und ein Rohr holen, Material, das zur Ausführung eines Sabotageakts benötigt wurde; er hatte versichert, das Material werde im Lauf des Tages bereitgestellt. Er ist erst nach fast zwei Tagen zurückgekehrt und kann seine Abwesenheit nicht rechtfertigen. Würde ich es ihm vorwerfen, wäre es ungerecht, da auch andere Bandenmitglieder in ähnliche Fehler verfallen sind. So kann es nicht weitergehen. Es ist absurd, eine Rebellengruppe trotz grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten und chronischer Nachlässigkeit bei der Erfüllung ihrer elementarsten Pflichten aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich ist es größtenteils meine Schuld, weil ich das System der Selbstkontrolle ausprobieren wollte anstelle der Disziplin, die sich von der direkten Autorität ableitet.
Ich habe eine Entscheidung getroffen und teile sie der Gruppe mit. Ich gebe die Methode der Selbstkontrolle auf und führe die der Disziplin ein. Ich übernehme alle Verantwortung gegenüber den verschiedenen Komitees, die die Gruppe sowohl politisch als auch finanziell tragen, und ebenso gegenüber der Gruppe und meinem Gewissen.
Ich erkläre das Experiment mit der Methode der Selbstkontrolle nicht für gescheitert, es wird schöner und dauerhafter fortgesetzt werden können, aber ich konstatiere, dass den Gruppenmitgliedern die moralische und politische Reife fehlt, um spontan und mit vollem Bewusstsein in Zusammenarbeit mit dem Anführer der Gruppe alle Verantwortung zu tragen, die aus unserer Lage als Geächtete entsteht.