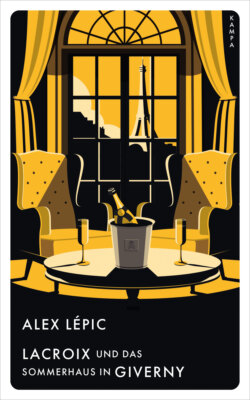Читать книгу Lacroix und das Sommerhaus in Giverny - Alex Lépic - Страница 3
2
ОглавлениеIm Büro schrumpften die Aktenberge, denn die zweite Augusthälfte bot sich dafür an, Berichte zu schreiben. Paganelli tat diese Arbeit gegen seine Natur auf geradezu vorbildliche Weise, denn er langweilte sich.
In den zwei Wochen vor der rentrée war die Stadt wie ausgestorben. Die Pariser aalten sich an den Stränden, und sogar die Verbrecher machten Urlaub. Ein paar Taschendiebe, die es auf die vollen Geldbörsen der Amerikaner abgesehen hatten – das war alles. Die Habgierigen und Eifersüchtigen warteten, bis die Geschäfte wieder geöffnet und die untreuen Ehegatten nach Paris zurückgekehrt waren.
Capitaine Rio war mit den Zwillingen auf ihre Heimatinsel nach Mayotte geflogen – mit Camille, ihrer Frau. Die Krise zwischen ihnen war noch nicht gänzlich überstanden, aber es war ein zarter Versuch der Annäherung. Lacroix hatte Rios Urlaubsantrag mit einem Lächeln unterschrieben.
Paganelli war hiergeblieben. Direkt nach der rentrée machte er sich auf nach Korsika, in die alte Heimat. Die Strände in Ajaccio waren dann »pariserfrei«, wie er stets betonte, nicht ohne laut zu lachen.
Lacroix trat aus seinem kleinen Büro in den großen Raum, in dem Paganelli saß, gegenüber stand der verlassene Schreibtisch seiner Kollegin. Der Korse las in einer Akte und hob immer wieder den Blick, um auf den Bildschirm seines Computers zu sehen.
»Ich gehe schon hinaus«, sagte Lacroix, »Sie erreichen mich noch für eine Stunde im Chai, danach habe ich ein dîner. Sie können mir aber daheim auf den Anrufbeantworter sprechen, wenn es etwas Dringendes geben sollte, d’accord?«
»Keine Sorge, Chef«, sagte Paganelli gedankenverloren. »Wenn es so weitergeht, habe ich meine Jahresberichte fertig, bevor Rio zurückkommt. Was soll ich dann machen? Inventur in der Waffenkammer?« Er grinste.
»Nun, allzu oft fühlt sich die Ruhe vor dem Sturm so an«, gab Lacroix zurück.
Der Korse blickte auf und sah ihn prüfend an, dann lächelte er unter seinen dunklen Brauen. Seine Mitarbeiter fürchteten Lacroix’ Intuition.
»Nun gehen Sie schon, Maigret«, sagte Paganelli, »ich melde mich, wenn etwas passiert.«
Lacroix nickte brummend. Der Korse liebte es, den Commissaire mit seinem Spitznamen zu necken, den er zudem selbst in die Welt gesetzt hatte, weil Lacroix wie der berühmte Maigret meist einen Hut trug und gerne Pfeife rauchte. Lacroix mochte Paganelli trotz seiner kleinen Provokationen, deshalb verzieh er ihm, doch dass es der Spitzname sogar in die Presse geschafft hatte, ärgerte ihn sehr.
Der Commissaire ging wieder in sein Büro, griff nach dem leichten braunen Sommermantel und dem Hut und stieg dann im Flur die drei Treppen hinab, vorbei am kleinen Museum der Pariser Polizeigeschichte, das im zweiten Stock eingerichtet war. Es war eine kostenlose Ausstellung in den verstaubten Räumen des Kommissariats. Paris war schon vor zweihundert Jahren eine Weltmetropole gewesen und damit natürlich auch eine Stadt des Verbrechens, und so ließen sich Exponate von damals finden, Waffen, Uniformen, gruselige Mordbeschreibungen. Die meisten Besucher waren Schulklassen und Polizisten aus dem ganzen Land, die einmal sehen wollten, wie die erfahrenen Kollegen der Hauptstadt-Polizei heute und damals ihre Arbeit machten.
Lacroix nickte im Vorbeigehen den Beamten zu, die den Eingang bewachten, dann trat er hinaus in den spätsommerlichen Tag.
Der Feierabendverkehr auf dem Boulevard Saint-Germain hatte schon eingesetzt, die Wagen fuhren gemächlich in Richtung Pont de Sully. In anderen Monaten war hier Dauerstau, nicht nur zu Hauptverkehrszeiten. Auf der Busspur jagten die Taxis vorbei, und die grün-weißen Busse klingelten, wenn sie die Spur wechselten.
Lacroix überquerte die Straße und genoss den kurzen Bummel über das breite Trottoir, bestaunte die herrlich gestalteten Schaufenster der Einrichtungsboutiquen und Haute Couture-Läden. Dann bog er rechts in die Rue de Seine ein und betrat nur zwei Minuten später sein Stammlokal mit der roten Markise. Glücklicherweise hielt Yvonne Abeille nichts von Sommerurlaub, und so war hier fast jeden Tag im Jahr geöffnet – bis auf den ersten Weihnachtstag, den Abend vorm neuen Jahr und den 28. Januar. An dem Tag hatten Yvonne und ihr Mann Geburtstag – gemeinsam, was für ein Zufall. Diese drei Tage waren ihr heilig.
Am alten Zinktresen des Bistros Chai de l’Abbaye war keine Spur von den üblichen Verdächtigen. Lacroix sah auf die Uhr und nickte. Alain hatte in seinem Obstladen gegenüber noch zu tun, jetzt, da die Leute aus den Büros strömten. Lacroix’ Bruder Pierre-Richard hingegen musste noch die Achtzehn-Uhr-Messe halten, in der Basilique Sainte-Clotilde, weiter unten im siebten Arrondissement.
Doch da trat schon Yvonne, die Wirtin, aus der Küche, deren Blick sogleich zur Uhr wanderte.
»Ah, du bist aber früh dran, mon cher.«
»Dominique und ich haben eine Einladung zum dîner, da wollte ich vorher noch einen Moment durchatmen.«
»Und passt zum Durchatmen besser ein Wein oder ein Bier?«
Lacroix lächelte und nickte ihr dankbar zu. Sie griff zu einem der kleinen Gläser, ging zum Zapfhahn mit der Aufschrift Meteor und ließ das kalte goldgelbe Bier in das Glas laufen.
Kleine Gläser. Immer kleine Gläser. Niemals trank Lacroix aus großen Gläsern. Das Bier wurde zu schnell schal und verlor seinen Esprit, und das hatte diese wunderbare Marke aus dem Elsass nun wirklich nicht verdient.
Sie stellte es vor ihm ab, und er trank in großen Schlucken, der Tag hatte ihn durstig gemacht.
»Was ist die plat du jour?«, fragte er Yvonne.
»Eine getoastete tartine mit Schinken aus Bayonne und altem fromage de chèvre.«
»Die hätte ich sehr gerne«, sagte er.
»Sagtest du nicht, du wolltest zu einem dîner?«, fragte Yvonne.
»Ich glaube, das wird nicht sehr üppig. In diesen Kreisen …«, Lacroix senkte die Stimme, »ist es nie sehr üppig.«
»Hm«, murmelte Yvonne und zapfte ein zweites Bier, »aber das ist nicht alles, oder?«
Lacroix sah auf und blickte sie ruhig an. Er wusste, dass sie alle seine Regungen und Stimmungen kannte. Wahrscheinlich verbrachte er an Werktagen mehr wache Stunden im Chai als in seiner Wohnung in der Rue Cler.
»Du hast recht. Ich glaube, der Abend könnte höchst unerfreulich werden.«
»Erzähl …«
»Lieber nicht«, sagte Lacroix. »Ich brauche wirklich diesen Moment.«
»Na dann«, sagte Yvonne und änderte sogleich ihre Miene, sie wusste, wann sie den Commissaire besser in Ruhe ließ. Also rief sie, freilich viel lauter, in Richtung Küche: »Eine tartine für Monsieur Lacroix!«
Dann eilte sie in den Saal des Bistros, um an einem Tisch ein altes Paar zu bedienen, das eben Platz genommen hatte.
Das kalte Bier erfrischte ihn, belebte seine Gedanken, der herbe Geschmack kitzelte auf seiner Zunge.
»Madame de Touquet«, murmelte er, das Bild der alten Dame klar vor Augen. Ihr Haus und ihr Stammbaum waren gleichermaßen Institutionen in Giverny, diesem normannischen Dorf, zwei Stunden von Paris entfernt. Und doch redete man mehr über Madame de Touquet als mit ihr, denn sie verbarg sich gerne hinter den hohen Mauern des Anwesens. Er versuchte, sich an ihre Stimme zu erinnern. Es wollte ihm nicht recht gelingen. So merkwürdig es auch war: Er hatte mit der Dame in all den Jahren nur Smalltalk gehalten. Eigentlich mochte er diesen neumodischen Anglizismus nicht. »Smalltalk« – was sollte das sein? Andererseits beschrieb es ihre Unterhaltungen ganz gut, wenn sie sich zufällig im Dorf begegnet waren oder vor der kleinen mairie, einmal auch bei einem Fest in Monets Garten. Mehr nicht. Er kannte sie nicht gut, und doch wollte sie mit ihm reden. Merkwürdig war das. Lacroix verspürte die innere Unruhe, die er so gut kannte und die ihn gleichermaßen ärgerte und doch in Aufregung versetzte. Es war wie eine Vorahnung düsterer Ereignisse.
Gleich darauf verspürte er einen Windhauch, so schnell kam Yvonne zurück, blieb neben ihm stehen und schlug sich gegen die Stirn.
»Herrje, mon cher, das habe ich ganz vergessen: Vorhin, als ich drüben bei Alain Petersilie kaufen war, hat hier eine Frau angerufen. Mon mari«, sie wies in Richtung Küche, »hat den Anruf angenommen.«
»Ein herrisches Frauenzimmer«, rief Yvonnes Mann von nebenan, der am Herd stets jedes Wort vernahm, das am Tresen gesprochen wurde, Bestellungen natürlich ausgenommen.
Die Wirtin sah auf den Zettel. »Hier steht’s: Madame de Touquet ersucht Commissaire Lacroix, sie vor dem dîner zu beehren, um in Ruhe ein wichtiges Thema zu besprechen. Um 18:30 Uhr an bekannter Adresse.«
Lacroix runzelte die Stirn. »Hat sie wirklich beehren gesagt?«
Wieder rief Yvonnes Mann aus der Küche: »Ich habe es wortwörtlich mitgeschrieben.«
»Vergiss die tartine, Yvonne«, sagte der Commissaire seufzend. »Der Adel ruft – und die letzte Revolution ist leider zu lange her, als dass man ihn warten lassen sollte.«
Mit zerknirschter Miene und hungrigem Magen verließ er den Chai – doch so langsam gewann die Neugier die Oberhand: Was in aller Welt war so wichtig, dass Madame de Touquet ihn so dringend sprechen wollte?